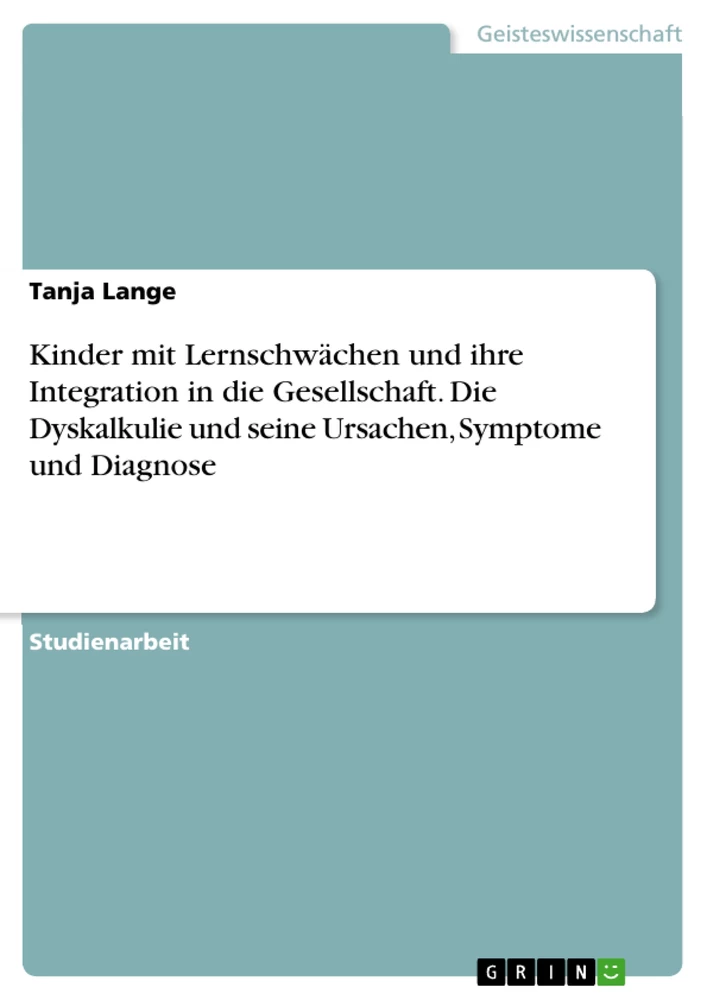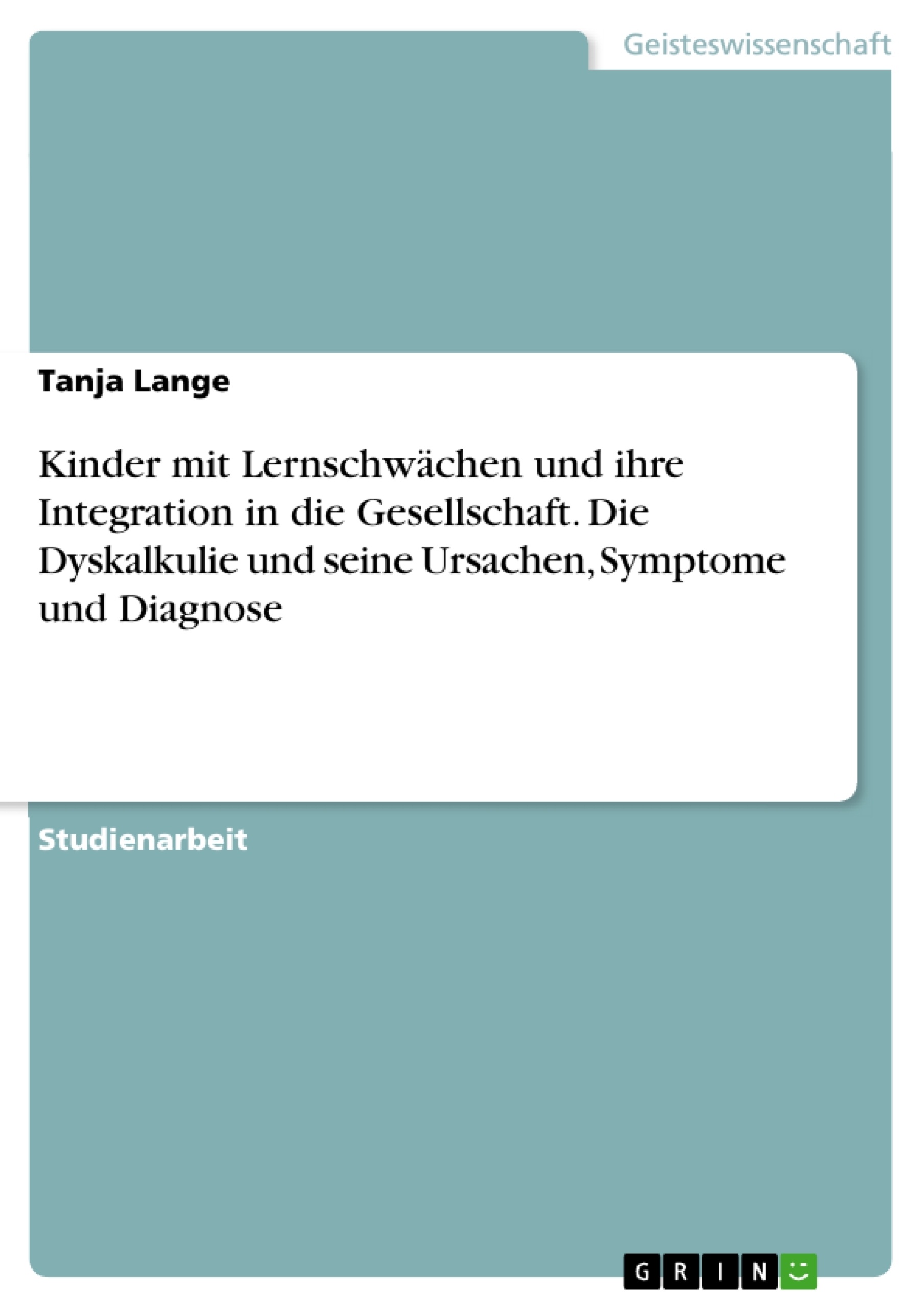Was ist eigentlich Dyskalkulie? Es zählt bereits zu den bekannten Lernschwächen wie ADHS und LRS. Funktioniert im Leben nichts mehr ohne Schwierigkeiten? Warum bekommen ausgerechnet Kinder mehr und mehr Schwierigkeiten die sie in ihrem Leben bewerkstelligen müssen? Hängt das mit der immer schwieriger werdenden sozialen Situation der Eltern zusammen? Sind Eltern und Lehrer nicht mehr in der Lage, Kinder ausreichend zu fördern um sie in die Gesellschaft zu integrieren?
Um Antwort auf diese Fragen zu finden, habe ich mich unter anderem mit XY, dem Schulleiter der XY– Grundschule in Stadt A unterhalten. Das Schulkonzept dieser Grundschule konzipiert besondere Förderprogramme für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie. Ich war erschrocken darüber, dass der Anteil der Kinder mit Lernschwächen nur an dieser Schule zwischen 10 und 15 % liegt – Tendenz steigend. Bei einer Schülerzahl von 317 Kindern, sind somit über 40 Kinder verhaltensauffällig! 40 Kinder im Grundschulalter! Im Gespräch mit XY wurde deutlich, dass der Umgang mit den Kindern immer schwieriger wird und intensive Betreuung durch die Lehrer nicht gewährleistet werden kann, zumal dies auch nur bedingt deren Aufgabe sei. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Eltern gestalte sich sehr schwierig, da hier immer noch die Meinung vertreten sei, eine Lernschwäche sei ein Zeichen für Dummheit. Die Folge ist, dass die betroffenen Kinder, die ja auch merken dass sie irgendwie anders sind, sich zurückziehen um nicht aufzufallen oder einfach von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen werden.
Was mich nach diesem Gespräch sehr nachdenklich machte, waren nicht die Dinge über die Herr XY sprach, sondern wie er über sie sprach: wie jemand, der aufgegeben hat. Sein Blick ging meist aus dem Fenster und seine Stimmlage war aggressiv und wütend. Und ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass Pädagogen schon bei Kindern im Grundschulalter einfach aufgeben. Auf dieses Thema werde ich in einem späteren Abschnitt noch einmal zu sprechen kommen. Nachdem ich mich detaillierter mit der Lernschwäche Dyskalkulie, deren Diagnostik und therapeutische Maßnahmen befasst habe, werde ich versuchen, mit Hilfe der Ursachenforschung eine Zusammenstellung der präventiven und integrativen Möglichkeiten durch die Schule, den Eltern und dem Jugendamt zu erarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Normalität
- 2.2 Integration
- 3. Dyskalkulie
- 3.1 Das Dilemma und die Definition von Lernbehinderung und Lernschwäche
- 3.2 Definition Dyskalkulie
- 3.3 Ursachen
- 3.4 Symptome
- 3.5 Diagnose
- 4. Schulpädagogische Aspekte
- 4.1 Integrativer Unterricht
- 4.2 Netzwerkarbeit - Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern, Institutionen
- 4.3 Möglichkeiten zur Integration von Ungleichheit in das System Schule
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht das Phänomen der Dyskalkulie bei Kindern und deren Integration in die Gesellschaft. Ziel ist es, die Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Dyskalkulie zu beleuchten und schulpädagogische Maßnahmen zur erfolgreichen Integration dieser Kinder zu diskutieren. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen für Pädagogen, Eltern und Institutionen.
- Definition und Auswirkungen von Dyskalkulie
- Schwierigkeiten bei der Integration von Kindern mit Lernschwächen
- Rollen von Eltern, Lehrern und Institutionen bei der Integration
- Integrative Unterrichtsmethoden und Förderprogramme
- Konzepte von Normalität und Integration im Kontext von Lernschwächen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Dyskalkulie ein und beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit, nämlich die zunehmende Anzahl von Kindern mit Rechenschwäche. Sie stellt die Frage nach den Ursachen und den Schwierigkeiten der Integration dieser Kinder in die Gesellschaft und kündigt die weiteren Kapitel an, die sich mit Definitionen, Ursachen, Symptomen, Diagnose und schulpädagogischen Aspekten auseinandersetzen. Ein persönliches Gespräch mit einem Schulleiter verdeutlicht die Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Lernschwächen und die oft fehlende Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Institutionen. Der erlebte Frustrationspegel der Lehrkraft wird als Anlass für eine tiefergehende Untersuchung dargestellt.
2. Definitionen: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Begriffe „Normalität“ und „Integration“. Es hinterfragt die gesellschaftlichen Normen und die damit verbundene Konstruktion von „Normalität“ und „Anormalität“. Anhand von Zitaten verschiedener Autoren wird die subjektive Natur von Normalität herausgestellt und die Frage aufgeworfen, wie gesellschaftliche Normen die Integration von Kindern mit Lernschwächen beeinflussen. Die Definition von Integration als Eingliederung in ein größeres Ganzes wird diskutiert, wobei der normative sozialpolitische Aspekt und das Menschenrecht auf inklusive Bildung im Vordergrund stehen.
3. Dyskalkulie: Kapitel 3 befasst sich umfassend mit dem Thema Dyskalkulie. Es definiert den Begriff der Lernbehinderung und Lernschwäche im Kontext von Dyskalkulie, um das Dilemma von Definition und Abgrenzung zu verdeutlichen. Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen, Symptomen und der Diagnose von Dyskalkulie. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die zum Verständnis der Erkrankung beitragen und den Weg für die anschließende Betrachtung der schulpädagogischen Aspekte ebnen.
4. Schulpädagogische Aspekte: Dieses Kapitel erörtert schulpädagogische Maßnahmen zur Integration von Kindern mit Dyskalkulie. Es behandelt den integrativen Unterricht und die wichtige Netzwerkarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Institutionen. Es werden Möglichkeiten untersucht, wie Ungleichheiten im Schulsystem adressiert und ausgeglichen werden können, um eine inklusive Lernumgebung für alle Kinder zu schaffen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung von integrativen Strategien und der Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Lernschwäche, Integration, Inklusion, Schulpädagogik, Netzwerkarbeit, Normalität, sonderpädagogischer Förderbedarf, inklusive Bildung, Zusammenarbeit Schule-Eltern-Institutionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dyskalkulie - Integration und Schulpädagogische Aspekte
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Dyskalkulie bei Kindern und deren Integration in Schule und Gesellschaft. Sie beleuchtet Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Dyskalkulie und diskutiert schulpädagogische Maßnahmen zur erfolgreichen Integration. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen für Pädagogen, Eltern und Institutionen und beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Auswirkungen von Dyskalkulie, Schwierigkeiten bei der Integration von Kindern mit Lernschwächen, die Rollen von Eltern, Lehrern und Institutionen bei der Integration, integrative Unterrichtsmethoden und Förderprogramme sowie Konzepte von Normalität und Integration im Kontext von Lernschwächen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein, Kapitel 2 (Definitionen) beleuchtet die Begriffe „Normalität“ und „Integration“, Kapitel 3 (Dyskalkulie) befasst sich umfassend mit der Dyskalkulie (Definition, Ursachen, Symptome, Diagnose), Kapitel 4 (Schulpädagogische Aspekte) erörtert integrative Maßnahmen und Netzwerkarbeit und Kapitel 5 (Resümee) fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Einleitung?
Die Einleitung verdeutlicht die zunehmende Anzahl von Kindern mit Rechenschwäche und die damit verbundenen Integrationsherausforderungen. Ein persönliches Gespräch mit einem Schulleiter unterstreicht die Schwierigkeiten im Umgang mit Lernschwächen und die oft mangelnde Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Institutionen. Der Frustrationspegel der Lehrkraft wird als Anlass für die Untersuchung genannt.
Wie werden Normalität und Integration definiert?
Kapitel 2 hinterfragt gesellschaftliche Normen und die Konstruktion von „Normalität“ und „Anormalität“. Es wird die subjektive Natur von Normalität anhand von Zitaten verschiedener Autoren hervorgehoben und der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Integration von Kindern mit Lernschwächen diskutiert. Integration wird als Eingliederung in ein größeres Ganzes definiert, wobei der normative sozialpolitische Aspekt und das Menschenrecht auf inklusive Bildung im Vordergrund stehen.
Was wird unter Dyskalkulie verstanden?
Kapitel 3 definiert Dyskalkulie im Kontext von Lernbehinderung und Lernschwäche. Es beleuchtet Ursachen, Symptome und Diagnosemethoden. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Erkrankung als Grundlage für die Betrachtung der schulpädagogischen Aspekte.
Welche schulpädagogischen Aspekte werden behandelt?
Kapitel 4 behandelt integrative Unterrichtsmethoden und die Bedeutung der Netzwerkarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Institutionen. Es werden Möglichkeiten zur Verbesserung der Inklusion und zum Ausgleich von Ungleichheiten im Schulsystem diskutiert, mit dem Fokus auf der praktischen Umsetzung integrativer Strategien und der Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dyskalkulie, Lernschwäche, Integration, Inklusion, Schulpädagogik, Netzwerkarbeit, Normalität, sonderpädagogischer Förderbedarf, inklusive Bildung, Zusammenarbeit Schule-Eltern-Institutionen.
- Quote paper
- Tanja Lange (Author), 2007, Kinder mit Lernschwächen und ihre Integration in die Gesellschaft. Die Dyskalkulie und seine Ursachen, Symptome und Diagnose, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121743