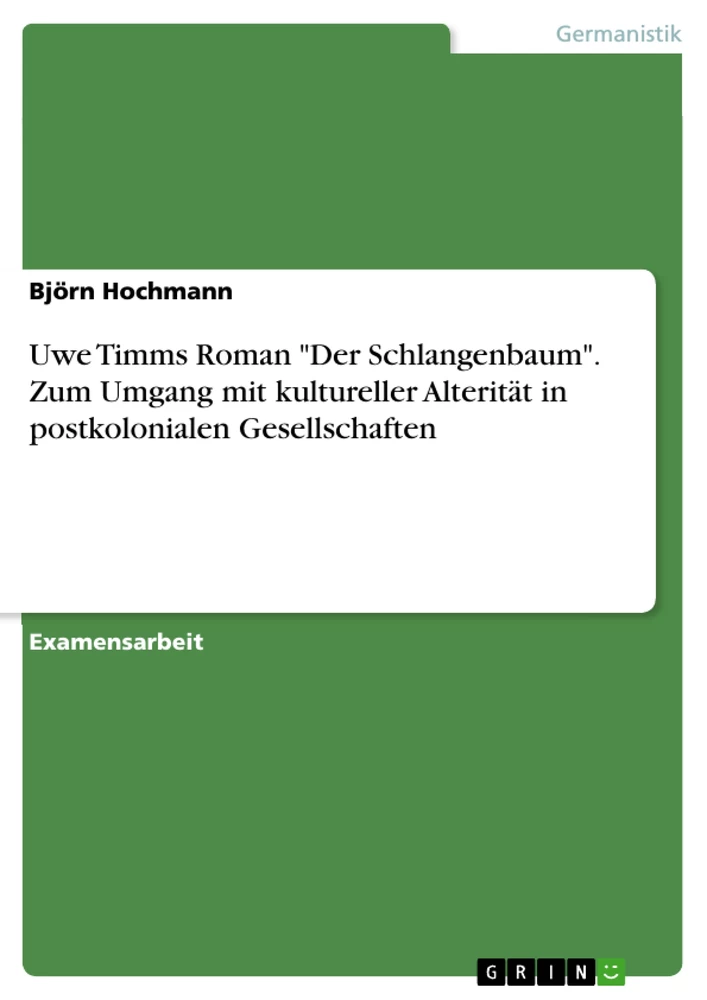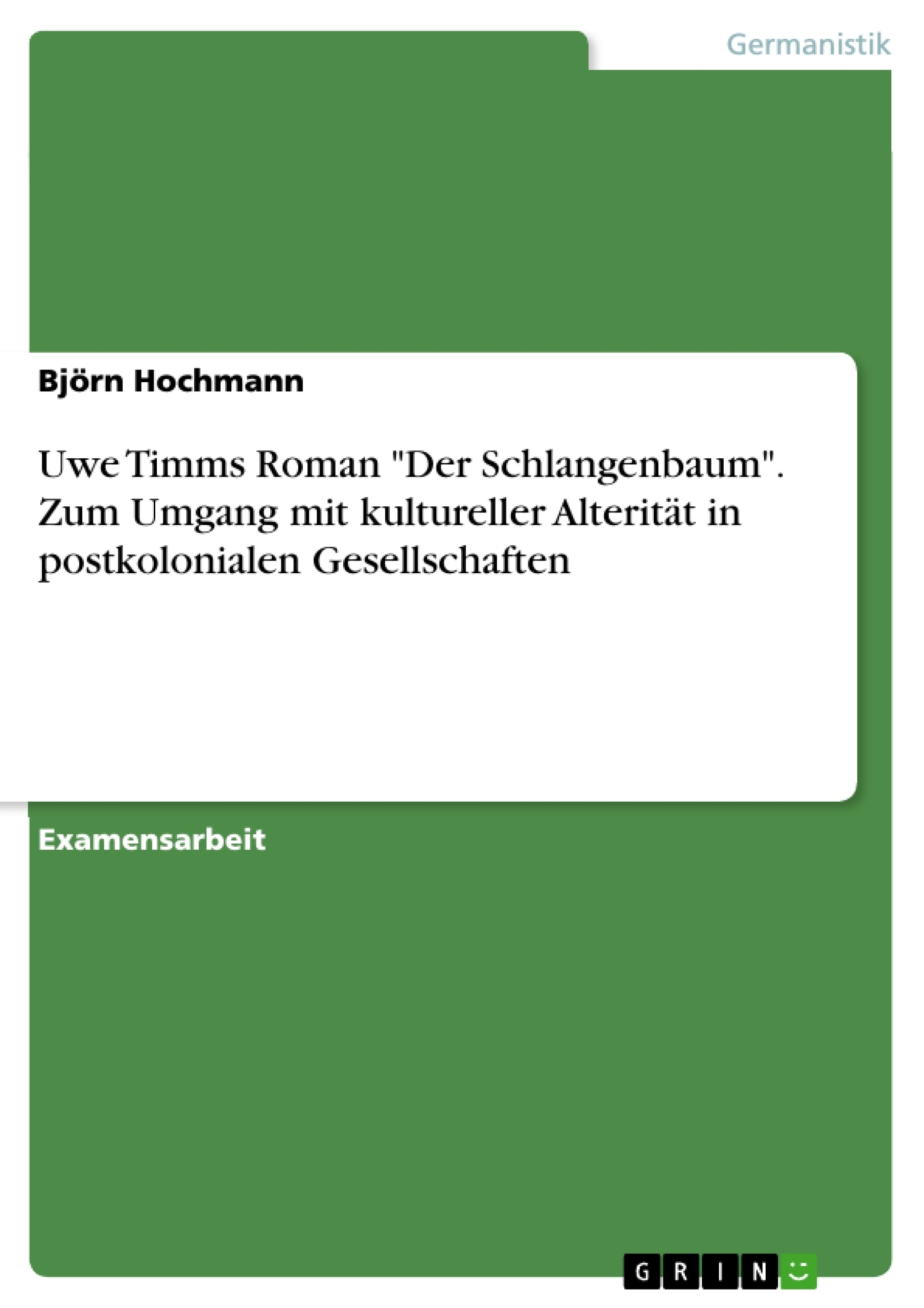Diese Examensarbeit untersucht die Repräsentation des Eigenen und Fremden in der deutschen Gegenwartsliteratur. Im Mittelpunkt der Analyse steht der Roman "Der Schlangenbaum" (1986) von UWE TIMM, in dem der Autor einen aktuellen Brennpunkt des Kulturkontakts aufgreift. Es soll an diesem Roman exemplarisch untersucht werden, welches Verhältnis das Eigene zum Fremden hat, wie mit kultureller Alterität in postkolonialen Gesellschaften umgegangen wird. Dabei sollen auch die dargstellten politischen Verhältnisse im Roman (Postkolonialismus, Nationalsozialismus in Südamerika, Militärdiktatur, Entwicklungshilfe, Eurozentrik etc.) die eng mit Autorität und Einflussnahme auf das Andere verbunden sind, in die Analyse miteinbezogen werden. Außerdem geht diese Arbeit auf das intertextuelle Verweissystem (Intertextualität) im "Schlangenbaum" ein. Dazu gehören u. a. Romane wie "Homo Faber" (Max Frisch) "Morenga" (Uwe Timm), "Herz der Finsternis" (Joseph Conrad) "Die Buddenbrooks" (Thomas Mann) oder "Ruyuela, Himmel und Hölle" (Julio Cortázar).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zu Inhalt und Form des Romans
- 2.1 Inhaltsüberblick
- 2.2 Zur Form des Romans
- 2.2.1 Die Erzählsituation
- 2.2.2 Die Zeitstruktur und die Figurenrede
- 2.2.3 Sprache und Stil
- 3 Entstehungsgeschichte und Handlungsraum des Schlangenbaums
- 4 Zum Begriff des Postkolonialismus
- 5 Das Eigene und das Fremde: Der komparatistische Blick
- 5.1 Zeichnungen des Fremden in TIMMS Roman Der Schlangenbaum
- 5.2 Wagner und das Fremde
- 5.2.1 Die Suche nach dem Ich
- 5.2.2 Wagner und Luisa: Das utopische Bild
- 5.2.3 Die Rolle der Sprache im interkulturellen Prozess für Wagner
- 5.2.4 Natur versus Zivilisation
- 5.3 Brechung und Parodie
- 5.4 Die eurozentristische Perspektive
- 5.5 Der Umgang mit dem Fremden: Ein zusammenfassender Ausblick
- 6 Die Darstellung der postkolonialen Welt im Schlangenbaum
- 6.1 Geschichtlicher Hintergrund des Romans
- 6.2 Die Leitmotive des Romans: Mythos und Realität
- 6.3 Neokolonialismus oder im Schatten der Paläste
- 6.3.1 Homo Technicus und das Problem des Fortschritts
- 6.4 Das Bekannte im Fremden: Die Militärjunta und der deutsche Faschismus
- 6.4.1 Luisa, Wagner und die argentinische Militär-Diktatur
- 6.4.2 Der Nazi im Exil
- 7 Zum intertextuellen Verweissystem im Schlangenbaum
- 7.1 Exkurs: Wagner und Walter Faber - ein Vergleich
- 8 Wagners Entwicklung
- 9 Das Schlusstableau des Romans
- 10 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Eigenen und Fremden in Uwe Timms Roman "Der Schlangenbaum" im Kontext postkolonialer Gesellschaften. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen der europäischen und der nicht-europäischen Kultur im Roman zu analysieren und die Strategien des Autors im Umgang mit kultureller Alterität zu beleuchten.
- Die Repräsentation des Eigenen und Fremden in der deutschen Gegenwartsliteratur
- Der Umgang mit kultureller Alterität in postkolonialen Gesellschaften
- Eurozentrismus und dessen Kritik im Roman
- Die Rolle der Sprache und der Erzählperspektive
- Der Einfluss von Geschichte und Politik auf die Darstellung der kulturellen Begegnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Repräsentation des Eigenen und Fremden in der deutschen Gegenwartsliteratur und begründet die Wahl von Uwe Timms "Der Schlangenbaum" als exemplarischen Fall. Sie verweist auf den anhaltenden Eurozentrismus in der europäischen Wahrnehmung der Welt und stellt die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte in den Mittelpunkt.
2 Zu Inhalt und Form des Romans: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt und die formale Struktur des Romans. Es analysiert die Erzählsituation, die Zeitstruktur, die Figurenrede, Sprache und Stil, um ein umfassendes Verständnis der Erzählweise Timms zu ermöglichen und die Grundlage für die anschließende Analyse der Thematik zu schaffen.
3 Entstehungsgeschichte und Handlungsraum des Schlangenbaums: Der Fokus liegt auf dem Kontext der Entstehung des Romans und der Bedeutung des Handlungsraums Argentinien für die Darstellung der postkolonialen Thematik. Die Analyse beleuchtet, wie die spezifischen historischen und geographischen Gegebenheiten die Gestaltung des Romans beeinflussen und die Darstellung der kulturellen Begegnung prägen.
4 Zum Begriff des Postkolonialismus: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse, indem es den Begriff des Postkolonialismus definiert und verschiedene theoretische Ansätze diskutiert. Es wird der Zusammenhang zwischen Kolonialgeschichte, kultureller Identität und der Darstellung von Machtverhältnissen erläutert.
5 Das Eigene und das Fremde: Der komparatistische Blick: Die Kapitel analysiert die verschiedenen Arten der Darstellung des Fremden im Roman und deren Funktion im Gesamtkontext. Es untersucht die Perspektiven der Figuren, insbesondere Wagners, und deren Entwicklung im Umgang mit dem Fremden. Die Rolle der Sprache im interkulturellen Prozess und das Spannungsfeld zwischen Natur und Zivilisation werden ebenfalls thematisiert.
6 Die Darstellung der postkolonialen Welt im Schlangenbaum: Dieses Kapitel fokussiert auf die Darstellung der postkolonialen Welt im Roman, indem es den historischen Hintergrund, die Leitmotive und die Problematik von Neokolonialismus erörtert. Die Verknüpfung zwischen der argentinischen Militärdiktatur und dem deutschen Faschismus wird als zentraler Aspekt der postkolonialen Erfahrung herausgearbeitet.
7 Zum intertextuellen Verweissystem im Schlangenbaum: Das Kapitel beleuchtet die intertextuellen Bezüge des Romans, insbesondere den Vergleich zwischen Wagner und Walter Faber, um die Bedeutung von literarischen Traditionen und deren Einfluss auf die Darstellung der Thematik aufzuzeigen. Die Analyse verdeutlicht, wie Timm literarische Vorbilder nutzt und neu interpretiert.
8 Wagners Entwicklung: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Entwicklung der Hauptfigur Wagner im Verlauf des Romans, seine Wandlung im Umgang mit dem Fremden und die Bedeutung dieser Entwicklung für das Gesamtverständnis des Werks. Die Analyse betrachtet Wagners persönliche Geschichte und deren Reflexion in seinem Verhältnis zu anderen Figuren.
Schlüsselwörter
Postkolonialismus, kulturelle Alterität, Identität, Eurozentrismus, Fremdheit, Deutschland, Argentinien, Uwe Timm, Der Schlangenbaum, interkulturelle Kommunikation, Kolonialgeschichte, Neokolonialismus, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu Uwe Timms "Der Schlangenbaum"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Eigenen und Fremden in Uwe Timms Roman "Der Schlangenbaum" im Kontext postkolonialer Gesellschaften. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen europäischer und nicht-europäischer Kultur und den Strategien des Autors im Umgang mit kultureller Alterität.
Welche Themen werden im Roman behandelt?
Der Roman behandelt Themen wie Postkolonialismus, kulturelle Alterität, Identität, Eurozentrismus, Fremdheit, interkulturelle Kommunikation, Kolonialgeschichte, Neokolonialismus und die Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Darstellung der argentinischen Militärdiktatur und deren Bezug zum deutschen Faschismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel. Sie beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den gewählten Roman begründet. Es folgt eine Inhalts- und Formanalyse des Romans, ein Abschnitt zur Entstehungsgeschichte und zum Handlungsraum, sowie eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Postkolonialismus. Der Hauptteil analysiert die Darstellung des Eigenen und Fremden, betrachtet die postkoloniale Welt im Roman, untersucht das intertextuelle Verweissystem und beleuchtet die Entwicklung der Hauptfigur Wagner. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Inhalt und Form des Romans, Entstehungsgeschichte und Handlungsraum, Postkolonialismus, dem komparatistischen Blick auf Eigenes und Fremdes, der Darstellung der postkolonialen Welt, dem intertextuellen Verweissystem, Wagners Entwicklung, dem Schlusstableau und einem Fazit. Jedes Kapitel enthält detaillierte Analysen der jeweiligen Aspekte.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet literaturwissenschaftliche Methoden, wie Inhaltsanalyse, Formanalyse, Erzähltheorie und postkoloniale Theorie. Es wird ein komparatistischer Blick eingenommen, der verschiedene Perspektiven und Interpretationen berücksichtigt. Die Analyse bezieht den historischen und politischen Kontext des Romans mit ein.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Postkolonialismus, kulturelle Alterität, Identität, Eurozentrismus, Fremdheit, Deutschland, Argentinien, Uwe Timm, Der Schlangenbaum, interkulturelle Kommunikation, Kolonialgeschichte, Neokolonialismus und Literaturanalyse.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Repräsentation des Eigenen und Fremden in Uwe Timms "Der Schlangenbaum" zu untersuchen und die Strategien des Autors im Umgang mit kultureller Alterität zu beleuchten. Es geht um die Analyse des Verhältnisses zwischen europäischer und nicht-europäischer Kultur im Roman und die kritische Auseinandersetzung mit dem anhaltenden Eurozentrismus.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für deutsche Gegenwartsliteratur, Postkolonialismus, interkulturelle Kommunikation und Literaturwissenschaft interessieren. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Germanistik und Vergleichenden Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Björn Hochmann (Author), 2008, Uwe Timms Roman "Der Schlangenbaum". Zum Umgang mit kultureller Alterität in postkolonialen Gesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121727