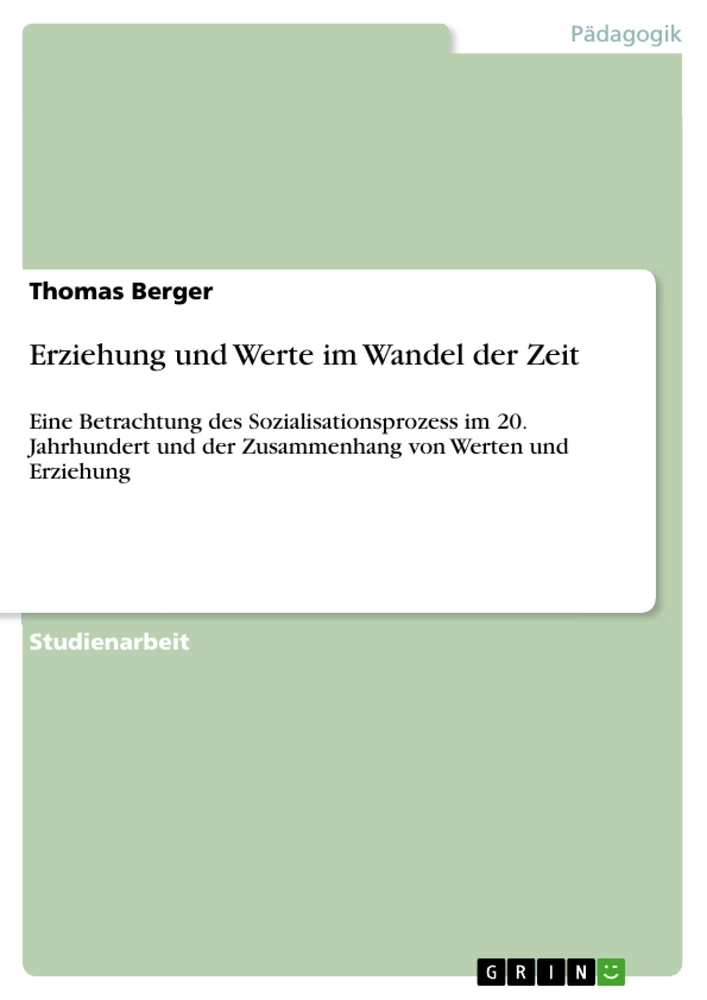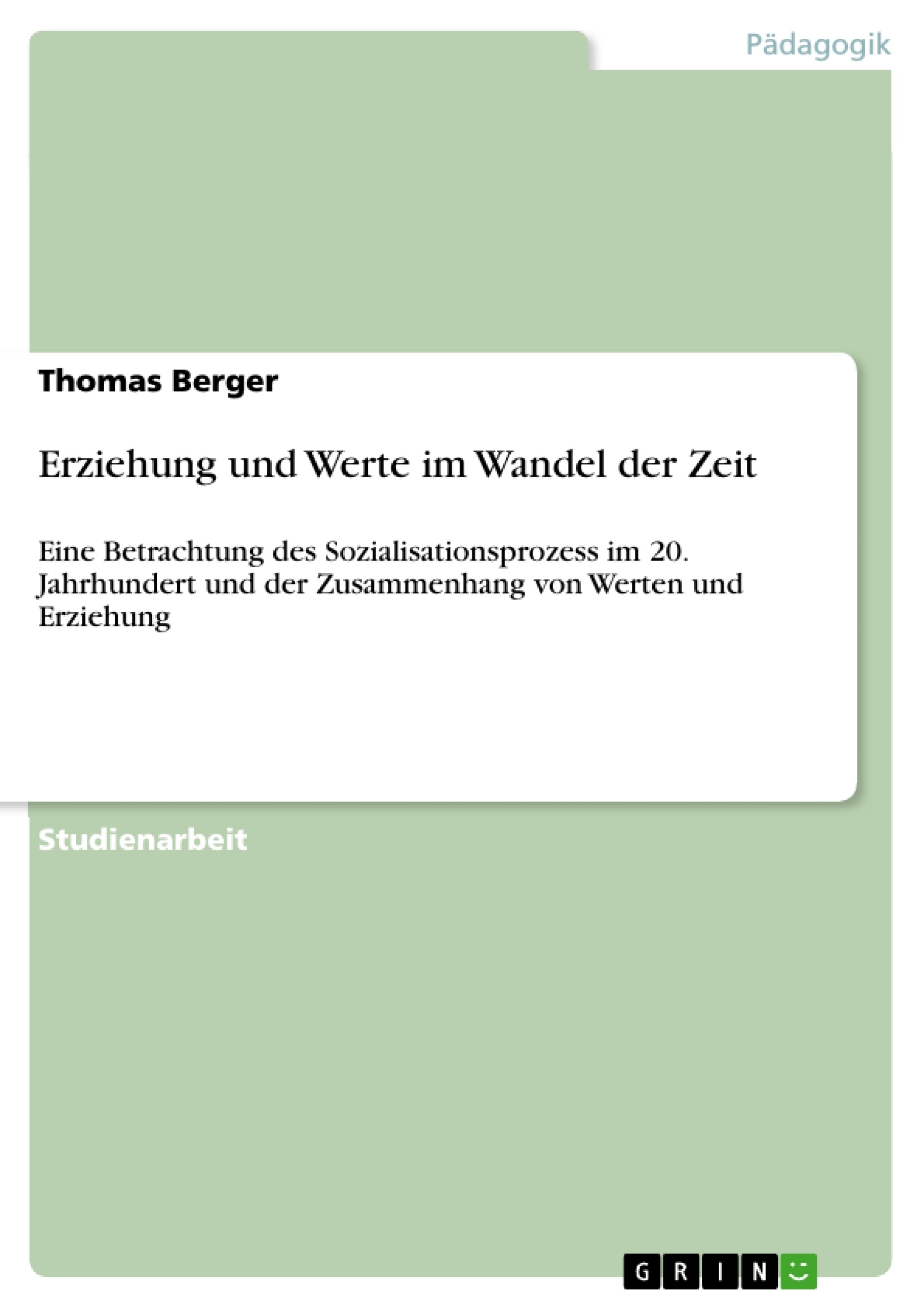Die vorliegende Arbeit untersucht nicht primär den Werteverfall und dessen Auswirkungen, sondern vielmehr, ob die Erziehungswissenschaft das geeignete Mittel ist um dem Verlust von Werten entgegenzutreten. Dabei sollen im Schwerpunkt die letzten 100 Jahre betrachtet werden, um festzustellen, ob es sich bei dem Werteverfall um den immer da gewesenen Generationenkonflikt handelt oder ob in den letzten Jahren durch veränderte Erziehungsstiele und geänderte Umweltbedingungen eine Verrohung der Gesellschaft eingesetzt hat. In diesem Zusammenhang sollen Veränderungen von Wertvorstellungen und Tugenden wissenschaftlich dokumentiert und veranschaulicht werden. Dabei soll auch kurz die Sozialisation und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Persönlichkeitsentwicklung vertieft werden. Im zweiten Kapitel soll erörtert werden, inwiefern der Werteverfall existent ist und dessen Auslöser dargestellt, sowie kritisch hinterfragt werden. Es soll gezeigt werden, welche Auswirkungen die Veränderung von Werten und Normen auf die heutige Gesellschaft hat und die Vor- und Nachteile dieser Änderung gegenübergestellt werden. Im letzten Abschnitt soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten die Gesellschaft hat negativen Auswirkungen mit Hilfe der Erziehung entgegenzutreten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erziehung
- 2.1 Erziehung und Sozialisation
- 2.2 Erziehungsstile
- 2.2.1 Der autoritär-repressive Erziehungsstil
- 2.2.2 Der Laissez-faire-Erziehungsstil
- 2.2.3 Der partnerschaftlich-demokratische Erziehungsstil
- 2.3 Erziehung heute
- 3. Der Werteverfall
- 3.1 Ursprung der Wertediskussion
- 3.1.1 Philosophische Betrachtung des Wertebegriffs
- 3.1.2 Sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise des Wertebegriffs
- 3.2 Klassifizierung des Wertebegriffs
- 3.3 Soziologische Modelle und Thesen zum Werteverfall
- 3.3 Ursachen der Werteverlagerung
- 3.4 Gefahren und Nebenwirkungen der Leistungsgesellschaft
- 4. Realisierbare Gegenmaßnahmen mit Hilfe der Erziehung
- 4.1 Die elterliche Erziehung
- 4.2 Die schulische Erziehung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Erziehung, gesellschaftlichen Wertvorstellungen und dem Wandel der Zeit. Im Fokus steht die Frage, ob der oft diskutierte „Werteverfall“ tatsächlich existiert und ob er durch veränderte Erziehungsstile und gesellschaftliche Bedingungen verursacht wird. Der Zeitraum der letzten 100 Jahre dient als Grundlage für die Analyse.
- Der Wandel von Erziehungsstilen im 20. Jahrhundert
- Die Definition und Entwicklung des Wertebegriffs
- Die Ursachen und Auswirkungen des vermeintlichen Werteverfalls
- Die Rolle der Erziehung im Umgang mit gesellschaftlichen Wertveränderungen
- Der Vergleich verschiedener Erziehungsansätze und deren Effektivität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Wertewandels und seiner Beziehung zu Erziehung ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Bestehen eines Werteverfalls und der Rolle der Erziehung bei der Bewältigung dieses Wandels. Die Arbeit fokussiert auf die letzten 100 Jahre und untersucht, ob der beobachtete Wandel auf einen Generationenkonflikt oder auf veränderte Erziehungsstile und Umweltbedingungen zurückzuführen ist. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodischen Schwerpunkte.
2. Erziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der Erziehung. Es werden unterschiedliche Definitionen und Erziehungsansätze beleuchtet, wobei der Technizismus und der Naturalismus als zentrale Paradigmen herausgestellt werden. Die Bedeutung von Erziehung für die Persönlichkeitsentwicklung und die gesellschaftliche Integration wird diskutiert. Die verschiedenen Erziehungsziele und die enge Verknüpfung von Erziehung und Sozialisation werden ebenfalls thematisiert.
2.1 Erziehung und Sozialisation: Dieses Unterkapitel vertieft den Zusammenhang zwischen Erziehung und Sozialisation. Es werden Veränderungen von Erziehungsstilen im Laufe des 20. Jahrhunderts betrachtet, mit einem Vergleich zwischen traditionellen und modernen Ansätzen. Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen, insbesondere der 68er-Bewegung, auf die Erziehung wird untersucht.
3. Der Werteverfall: Das Kapitel widmet sich der kontroversen Debatte um den Werteverfall. Es werden philosophische und sozialwissenschaftliche Perspektiven auf den Wertebegriff vorgestellt und unterschiedliche Theorien und Modelle zum Wertewandel analysiert. Die Ursachen für die vermeintliche Werteverlagerung werden erörtert, sowie mögliche Gefahren und negative Auswirkungen für die Gesellschaft aufgezeigt. Das Kapitel bildet die Grundlage für die spätere Analyse der Rolle von Erziehung im Umgang mit dem Wertewandel.
4. Realisierbare Gegenmaßnahmen mit Hilfe der Erziehung: In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Erziehung dazu beitragen kann, negativen Auswirkungen des Wertewandels entgegenzuwirken. Die Rolle der elterlichen und schulischen Erziehung wird dabei im Detail untersucht und konkrete Ansätze für eine zeitgemäße und effektive Erziehung werden diskutiert, die den Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels gerecht werden.
Schlüsselwörter
Erziehung, Wertewandel, Sozialisation, Erziehungsstile, Werteverfall, Generationenkonflikt, Leistungsgesellschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Gesellschaftlicher Wandel, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Wertewandel und Erziehung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Erziehung, gesellschaftlichen Wertvorstellungen und dem Wandel der Zeit. Der Fokus liegt auf der Frage, ob ein "Werteverfall" existiert und ob dieser durch veränderte Erziehungsstile und gesellschaftliche Bedingungen verursacht wird. Die Analyse erstreckt sich über die letzten 100 Jahre.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von Erziehungsstilen im 20. Jahrhundert, die Definition und Entwicklung des Wertebegriffs, die Ursachen und Auswirkungen des vermeintlichen Werteverfalls, die Rolle der Erziehung im Umgang mit gesellschaftlichen Wertveränderungen und den Vergleich verschiedener Erziehungsansätze und deren Effektivität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Erziehung (inklusive Unterkapitel zu Erziehung und Sozialisation sowie verschiedenen Erziehungsstilen), Der Werteverfall, Realisierbare Gegenmaßnahmen mit Hilfe der Erziehung und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Wie wird der Begriff "Erziehung" definiert und behandelt?
Das Kapitel "Erziehung" beleuchtet verschiedene Definitionen und Erziehungsansätze, darunter Technizismus und Naturalismus. Es diskutiert die Bedeutung von Erziehung für die Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Integration sowie die verschiedenen Erziehungsziele und den engen Zusammenhang von Erziehung und Sozialisation. Es werden auch Veränderungen von Erziehungsstilen im Laufe des 20. Jahrhunderts, insbesondere der Einfluss der 68er-Bewegung, betrachtet.
Wie wird der "Werteverfall" analysiert?
Das Kapitel "Der Werteverfall" untersucht die kontroverse Debatte um diesen Begriff aus philosophischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Es analysiert Theorien und Modelle zum Wertewandel, erörtert die Ursachen der vermeintlichen Werteverlagerung und zeigt mögliche Gefahren und negative Auswirkungen für die Gesellschaft auf.
Welche Gegenmaßnahmen werden vorgeschlagen?
Das Kapitel "Realisierbare Gegenmaßnahmen mit Hilfe der Erziehung" zeigt Möglichkeiten auf, wie Erziehung negativen Auswirkungen des Wertewandels entgegenwirken kann. Es untersucht detailliert die Rolle der elterlichen und schulischen Erziehung und diskutiert konkrete Ansätze für eine zeitgemäße und effektive Erziehung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erziehung, Wertewandel, Sozialisation, Erziehungsstile, Werteverfall, Generationenkonflikt, Leistungsgesellschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Gesellschaftlicher Wandel und Pädagogik.
Welchen Zeitraum umfasst die Analyse?
Die Arbeit konzentriert sich auf die letzten 100 Jahre, um den Wandel von Erziehungsstilen und Wertvorstellungen zu analysieren.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der oft diskutierte "Werteverfall" tatsächlich existiert und ob er durch veränderte Erziehungsstile und gesellschaftliche Bedingungen verursacht wird.
Welche Methode wird angewendet?
Die Einleitung skizziert die methodischen Schwerpunkte der Arbeit, welche im Detail im Text erläutert werden.
- Quote paper
- Thomas Berger (Author), 2008, Erziehung und Werte im Wandel der Zeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121658