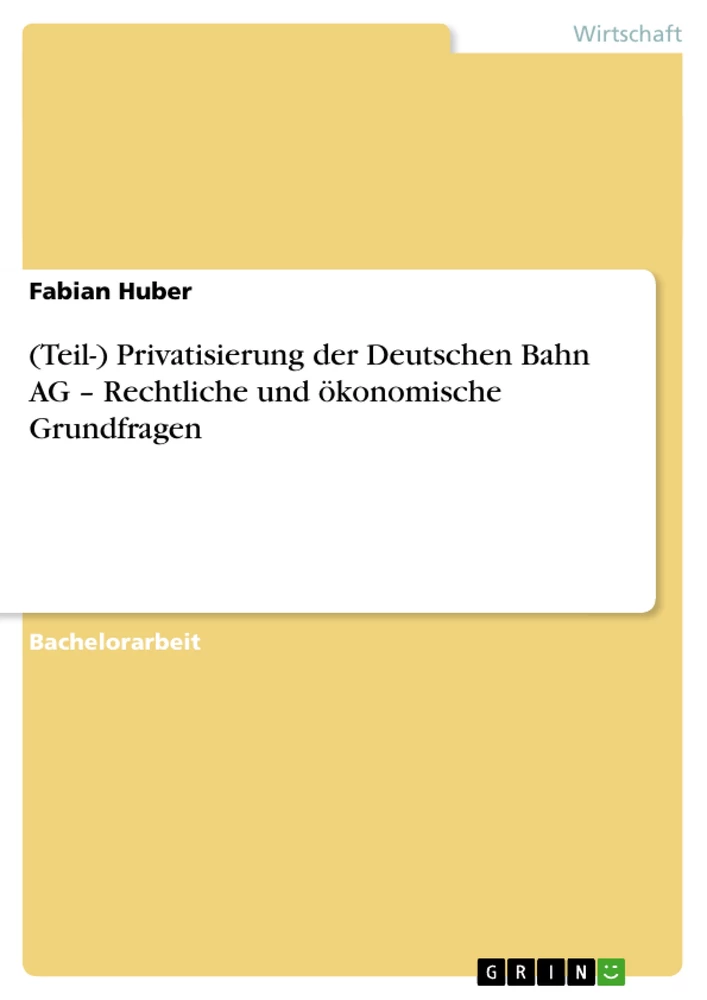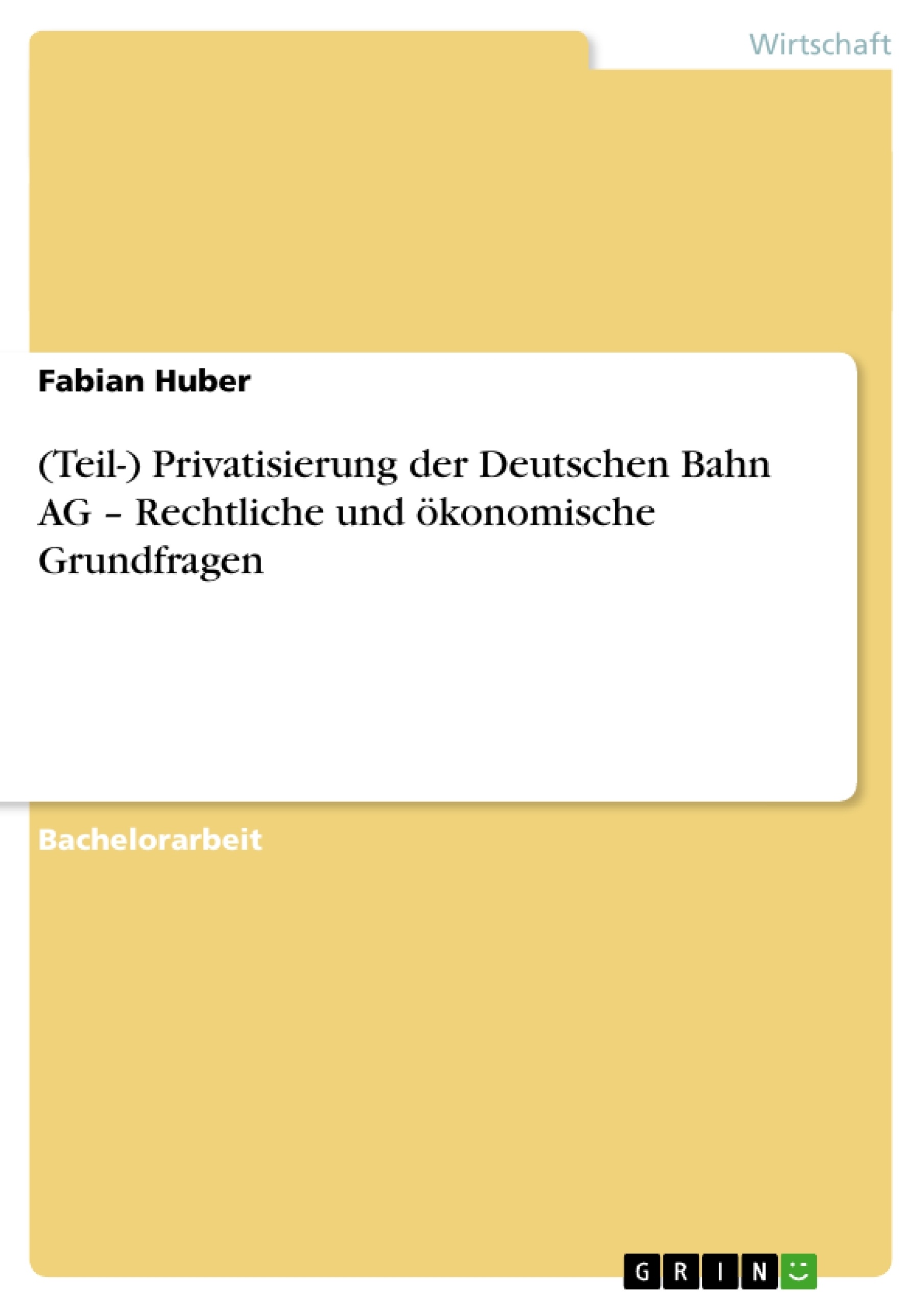Durch die Privatisierung der öffentlichen Bahnnetze wurde der ehemals gut funktionerende öffentliche Verkehr innerhalb von 40 Jahren praktisch ausgerottet. Dafür verantwortlich zu machen sind die Automobilkonzerne, die nach dem strategischen Aufkauf der Infrastruktur diese systematisch heruntergewirtschaftet haben, um die intermodale Konkurrenz auszurotten. Das ist die Beschreibung der Situation wie sie 1940 in Los Angeles vorzufinden war. Es ist das „brutalste historisch bekannte Besipiel“ (Haas, 2003, S. 3) für die Folgen einer Privatisierung und mag im Zusammenhang mit der Deutschen Bahn AG (DB AG) extrem klingen, sollte jedoch mit Bezug auf die (Teil-) Privatisierung der Deutschen Bahn AG, bei der die Lufthansa AG zeitweise als strategischer Investor gehandelt wird, in Erinnerung gerufen werden. Die Privatisierungsentwicklung bei der noch völlig im Eigentum des Bundes stehenden Deutschen Bahn AG steht derzeit im Zentrum des öffentlichen Interesses. Die Warnstreikmaßnahmen der neugegründeten Gewerkschaft der Lokführer (GdL) und ihr Kampf um Anerkennung als Tarifpartner haben ebenso die Schlagzeilen bestimmt wie die gesellschaftspolitische Diskussion um die Gestaltung des beabsichtigten Börsengangs. Während die einen in der Kapitalprivatisierung eine gigantische Verschleuderung von Volksvermögen sehen, erwarten andere eine finanzielle Entlastung des Steuerzahlers und einen Effizienz- und Qualitätszuwachs in der schienengebundenen Transportwirtschaft. Die von der Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung als beschlossenes Vorhaben angekündigte Privatisierung (CDU, CSU und SPD, 2005, S. 58) noch in dieser Legislaturperiode erscheint nach den Beschlüssen des Hamburger Parteitages der Koalitionspartei SPD ungewiss geworden zu sein. Der Vorstand der Deutschen Bahn AG und die Befürworter einer Privatisierung im politischen und wirtschaftlichen Bereich sind eifrig bemüht, das immer kleiner werdende Zeitfenster bis zum Ausbruch des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2009 für die Herbeiführung der (Teil-) Privatisierung zu nützen. Dass ein Börsengang der DB AG jedoch ausführlich vorbereitet und hinsichtlich rechtlicher und ökonomischer Kriterien sorgfältig abgewogen sein will, wird im Folgenden aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wandel der Staatsaufgaben – im Infrastruktur- und Versorgungssektor
- 3 Die Privatisierung
- 3.1 Zum Begriff der Privatisierung
- 3.2 Formen der Privatisierung
- 3.3 Internationale Privatisierungsbeispiele im Schienenverkehr
- 4 Historie der Deutschen Bahn und Reformnotwendigkeit
- 5 Ökonomische und Rechtliche Grundfragen
- 5.1 Rechtliche Grundfragen
- 5.1.1 Grundgesetzliche Regelungen
- 5.1.2 Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben
- 5.2 Ökonomische Grundfragen
- 5.2.1 Die klassische Wirtschaftstheorie – Marktversagen beim natürlichen Monopol
- 5.2.2 Aspekte der Neuen Institutionenökonomie
- 5.3 Zwischenergebnis
- 5.1 Rechtliche Grundfragen
- 6 Optionen für die DB AG
- 6.1 Strukturmodelle des PRIMON-Gutachtens
- 6.1.1 Das Integrierte Modell
- 6.1.2 Das Getrennte Modell
- 6.1.3 Die Hybridformen
- 6.2 Erkenntnisse des PRIMON-Gutachtens
- 6.3 Kritik des PRIMON-Gutachtens
- 6.4 Unbeachtete Alternative: Erhalt der DB AG als Staatskonzern
- 6.1 Strukturmodelle des PRIMON-Gutachtens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen und ökonomischen Aspekte einer (Teil-)Privatisierung der Deutschen Bahn AG. Ziel ist es, die Zulässigkeit und ökonomische Sinnhaftigkeit eines solchen Schrittes zu analysieren und verschiedene Optionen aufzuzeigen.
- Wandel der staatlichen Aufgaben im Infrastruktur- und Versorgungssektor
- Begriff und Formen der Privatisierung
- Rechtliche Rahmenbedingungen (Grundgesetz, EU-Recht)
- Ökonomische Analyse (klassische Wirtschaftstheorie, Neue Institutionenökonomie)
- Bewertung verschiedener Privatisierungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die (Teil-)Privatisierung der Deutschen Bahn AG vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Debatte. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Privatisierung und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf einer Analyse der rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen basiert, um schließlich verschiedene Optionen für die Zukunft der DB AG aufzuzeigen.
2 Wandel der Staatsaufgaben – im Infrastruktur- und Versorgungssektor: Dieses Kapitel analysiert den Wandel der staatlichen Aufgaben im Bereich der Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Es werden die Ursachen für den Rückzug des Staates aus diesem Bereich, wie Finanzkrise, neoliberale Ideen, technologische Entwicklungen, europäische Integration und internationaler Wettbewerb, erläutert. Der Staat soll sich auf die Schaffung von Rahmenbedingungen konzentrieren, während die konkrete Leistungserstellung zunehmend privatisiert wird. Die Frage, ob die DB AG zu den Aufgaben des Staates gehört und ob ein Rückzug gerechtfertigt ist, wird diskutiert.
3 Die Privatisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Privatisierung“ und differenziert ihn von Deregulierung, Entstaatlichung, Entbürokratisierung und Entbeamtung. Es werden die verschiedenen Formen der Privatisierung – formelle, funktionelle und materielle Privatisierung – detailliert beschrieben und anhand internationaler Beispiele im Eisenbahnsektor (Schweiz, Schweden, Großbritannien) illustriert. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden beleuchtet.
4 Historie der Deutschen Bahn und Reformnotwendigkeit: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Deutschen Bahn und die Gründe für die Notwendigkeit einer Reform. Der zunehmende Verlust von Marktanteilen, die wachsende Verschuldung und der Druck des intermodalen Wettbewerbs werden dargestellt. Frühere Reformversuche und die Bahnreform von 1994 werden erörtert, welche zur formellen Privatisierung der Deutschen Bundesbahn führte. Die Ziele dieser Reform und die Notwendigkeit weiterer Schritte werden beleuchtet.
5 Ökonomische und Rechtliche Grundfragen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen und ökonomischen Grundlagen für eine Privatisierung der DB AG. Im rechtlichen Teil werden die relevanten Bestimmungen des Grundgesetzes (Art. 87e GG) und des europäischen Gemeinschaftsrechts, insbesondere die Richtlinien zur Öffnung des Eisenbahnmarktes, untersucht. Der ökonomische Teil konzentriert sich auf das Marktversagen im Falle eines natürlichen Monopols (Eisenbahninfrastruktur) und diskutiert verschiedene Ansätze der Neuen Institutionenökonomie (PRT, PAT, Transaktionskostentheorie), um die Vor- und Nachteile öffentlicher und privater Leistungserstellung zu bewerten.
6 Optionen für die DB AG: Dieses Kapitel stellt verschiedene Strukturmodelle für eine materielle Teilprivatisierung der DB AG vor, die im PRIMON-Gutachten von Booz/Allen/Hamilton vorgeschlagen wurden. Das „Integrierte Modell“ und das „Getrennte Modell“ werden detailliert beschrieben und miteinander verglichen, wobei auch Hybridformen berücksichtigt werden. Die Erkenntnisse und die Kritik des PRIMON-Gutachtens werden diskutiert, einschließlich der methodischen Schwächen und der politischen Einflussnahme. Es wird die „unbeachtete Alternative“ des Erhalts der DB AG als Staatskonzern erörtert.
Schlüsselwörter
Deutsche Bahn AG, Privatisierung, Eisenbahnreform, Marktversagen, natürliches Monopol, Neue Institutionenökonomie, Grundgesetz, EU-Recht, PRIMON-Gutachten, Integriertes Modell, Getrenntes Modell, Wettbewerb, Regulierung, Haushaltseffekte, Verkehrsverlagerung, Modal Split, Daseinsvorsorge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der (Teil-)Privatisierung der Deutschen Bahn AG
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die rechtlichen und ökonomischen Aspekte einer möglichen (Teil-)Privatisierung der Deutschen Bahn AG. Sie untersucht die Zulässigkeit und ökonomische Sinnhaftigkeit einer Privatisierung und beleuchtet verschiedene Optionen für die Zukunft des Unternehmens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel staatlicher Aufgaben im Infrastruktur- und Versorgungssektor, den Begriff und die Formen der Privatisierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen (Grundgesetz, EU-Recht), ökonomische Analysen (klassische Wirtschaftstheorie, Neue Institutionenökonomie), die Bewertung verschiedener Privatisierungsmodelle und die historische Entwicklung der Deutschen Bahn.
Welche Privatisierungsmodelle werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die im PRIMON-Gutachten von Booz/Allen/Hamilton vorgeschlagenen Modelle: das „Integrierte Modell“, das „Getrennte Modell“ und Hybridformen. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Modelle im Detail analysiert und verglichen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die relevanten Bestimmungen des Grundgesetzes (Art. 87e GG) und des europäischen Gemeinschaftsrechts, insbesondere die Richtlinien zur Öffnung des Eisenbahnmarktes, werden eingehend untersucht.
Welche ökonomischen Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die klassische Wirtschaftstheorie, insbesondere die Analyse von Marktversagen bei natürlichen Monopolen, und die Neue Institutionenökonomie (PRT, PAT, Transaktionskostentheorie), um die Vor- und Nachteile öffentlicher und privater Leistungserstellung zu bewerten.
Welche Rolle spielt das PRIMON-Gutachten?
Das PRIMON-Gutachten dient als zentrale Grundlage für die Analyse verschiedener Privatisierungsmodelle. Die Arbeit diskutiert sowohl die Erkenntnisse als auch die Kritikpunkte des Gutachtens, einschließlich methodischer Schwächen und politischer Einflussnahme.
Wird die Möglichkeit des Erhalts der DB AG als Staatskonzern betrachtet?
Ja, die Arbeit erörtert explizit die „unbeachtete Alternative“ des Erhalts der DB AG als Staatskonzern und bewertet diese Option im Kontext der anderen diskutierten Szenarien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Wandel der Staatsaufgaben, Die Privatisierung, Historie der Deutschen Bahn und Reformnotwendigkeit, Ökonomische und Rechtliche Grundfragen, und Optionen für die DB AG. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten der (Teil-)Privatisierung der Deutschen Bahn AG.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu konkreten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Zulässigkeit und ökonomischen Sinnhaftigkeit einer (Teil-)Privatisierung der DB AG. Sie bewertet die verschiedenen Optionen und liefert eine fundierte Analyse der jeweiligen Vor- und Nachteile.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Bahn AG, Privatisierung, Eisenbahnreform, Marktversagen, natürliches Monopol, Neue Institutionenökonomie, Grundgesetz, EU-Recht, PRIMON-Gutachten, Integriertes Modell, Getrenntes Modell, Wettbewerb, Regulierung, Haushaltseffekte, Verkehrsverlagerung, Modal Split, Daseinsvorsorge.
- Quote paper
- BSc Fabian Huber (Author), 2008, (Teil-) Privatisierung der Deutschen Bahn AG – Rechtliche und ökonomische Grundfragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121566