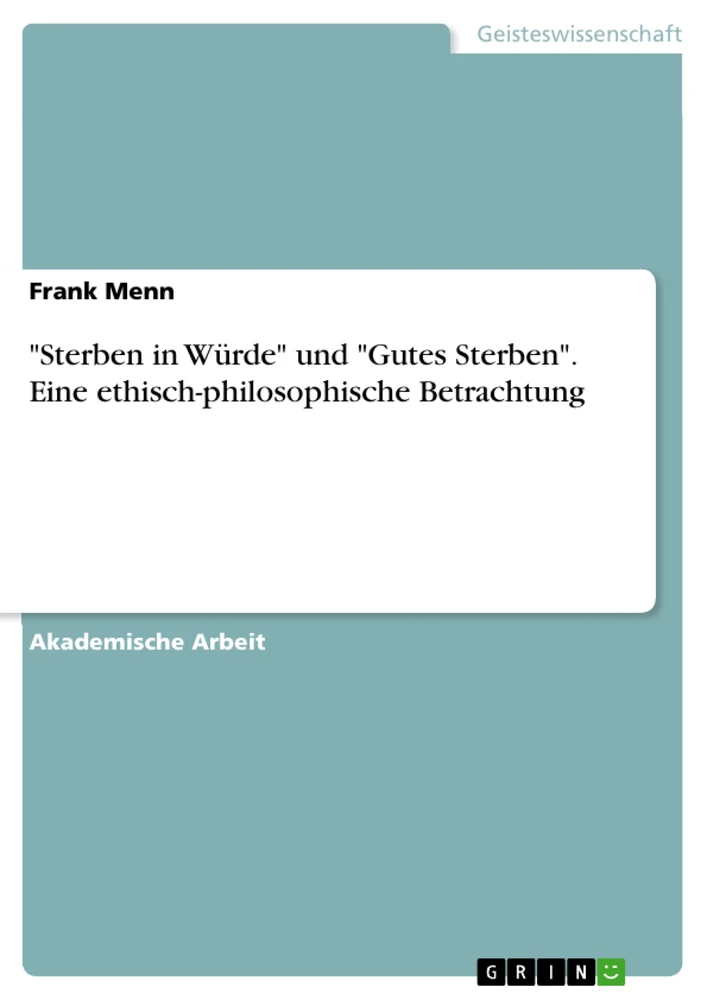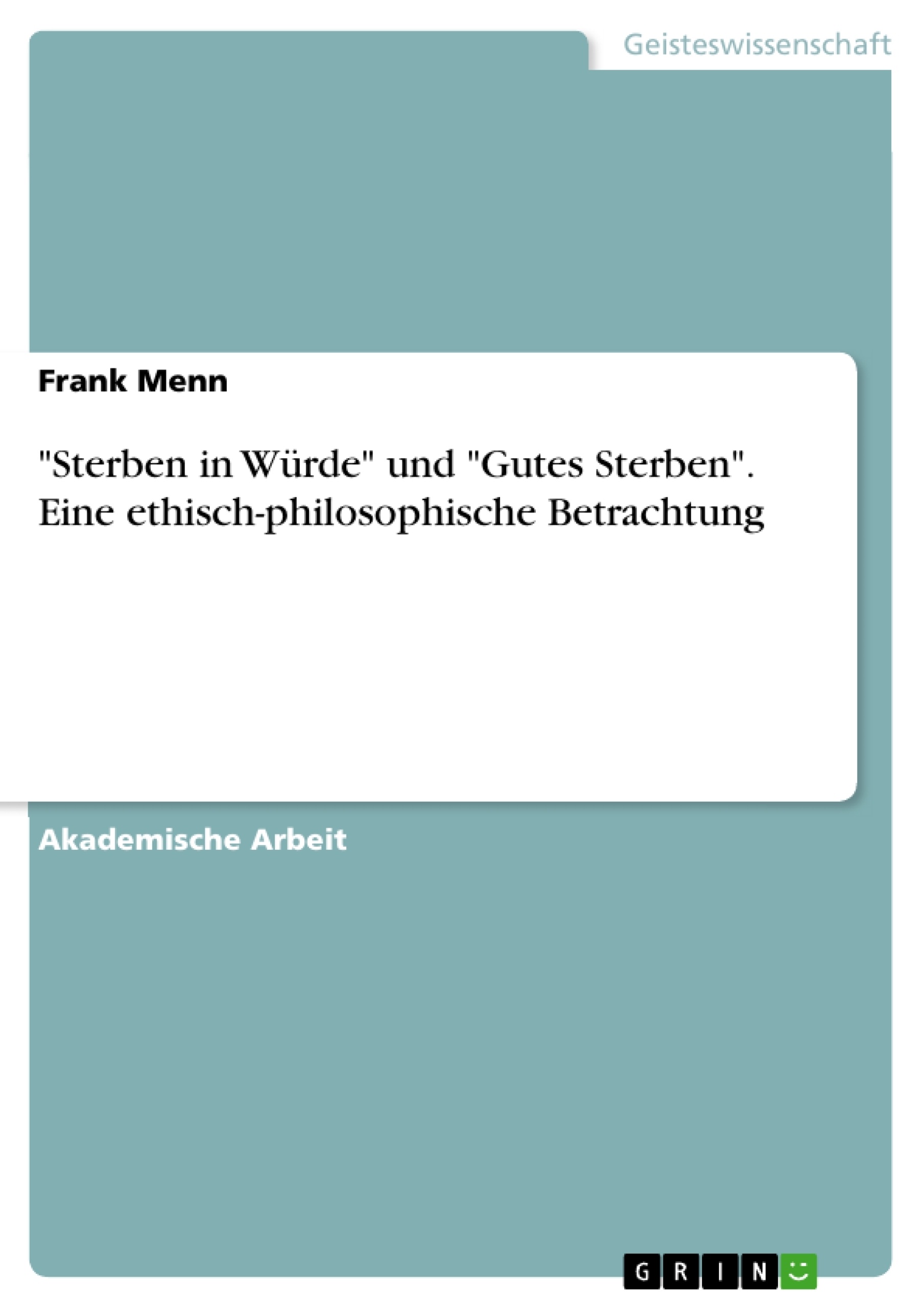Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die Begriffe „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“ auf ihren ethisch -philosophischen Ursprung und ihre inhaltliche Bedeutung hin zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für eine zeitgemäße Sterbekultur zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführende Gedanken
- 1.1. Was Menschen sich am Lebensende wünschen
- 1.2. Begriffsklärungen: Sterbeprozess, Sterbebegleitung und Sterbehilfe
- 1.2.1. Sterbeprozess
- 1.2.2. Sterbebegleitung
- 1.2.3. Sterbehilfe
- 2. Der Begriff der Würde
- 2.1. Der philosophisch-ethische Begriff von „Menschenwürde“
- 2.2. Der verfassungsrechtliche Begriff von „Menschenwürde“
- 3. Was bedeutet „Sterben in Würde“
- 3.1. Der Wunsch nach personaler Identität und körperlicher Integrität als Ausdruck von autonomer Würde
- 3.2. Sterben in Würde bei einem vollständigen Verlust von Autonomie?
- 3.3. Ist „Sterben in Würde“ ein „Gutes Sterben“?
- 3.4. Innere Voraussetzungen für ein gutes Sterben
- 4. Sterbehilfe und Sterbebegleitung
- 4.1. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe
- 4.2. Ist ein „Sterben in Würde“ immer auch ein „Selbstbestimmtes Sterben“?
- 4.3. Exkurs: „Sterbenlassen“ – deontologische und konsequentialistische Interpretation
- 4.4. Ethische Probleme der „Beihilfe zur Selbsttötung“ und des „Sterbefastens“
- 4.4.1. „Beihilfe zur Selbsttötung“
- 4.4.2. „Sterbefasten“
- 5. Schlussfolgerungen für eine „Ethik des Sterbens“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die ethisch-philosophischen Aspekte von „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“. Ziel ist es, die Begriffe zu klären und daraus Schlussfolgerungen für eine zeitgemäße Sterbekultur zu entwickeln. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl philosophische als auch juristische Perspektiven.
- Begriffsbestimmung von „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“
- Der philosophische und juristische Begriff der Würde
- Analyse des Sterbeprozesses und der Sterbebegleitung
- Ethische Bewertung von Sterbehilfe
- Entwicklung einer Ethik des Sterbens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführende Gedanken: Dieser einführende Abschnitt beleuchtet die Wünsche von Menschen am Lebensende, insbesondere den Wunsch nach einem würdevollen Sterben. Er differenziert zwischen individuellen Vorstellungen (Schmerzlinderung, Respektierung der Wünsche, soziale Begleitung) und der gesellschaftlichen Realität, die oft durch veränderte Wohnverhältnisse und familiäre Strukturen geprägt ist. Die Arbeit stellt heraus, dass die inhaltliche Bestimmung von „Sterben in Würde“ in der Gesellschaft vielfältig interpretiert wird und der Begriff sowohl von Befürwortern als auch Gegnern der Sterbehilfe verwendet wird, was eine kritische Auseinandersetzung notwendig macht.
1.2. Begriffsklärungen: Sterbeprozess, Sterbebegleitung und Sterbehilfe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe. Der Sterbeprozess wird in vier Phasen (Rehabilitation, Präterminal, Terminal, Final) unterteilt, wobei sich der Fokus auf die letzten beiden Phasen, die Terminal- und Finalphase, im Kontext von „Sterben in Würde“ konzentriert. Sterbebegleitung wird im Zusammenhang mit Palliativmedizin definiert, die Leidenslinderung und kommunikative Begleitung umfasst. Sterbehilfe wird in „Sterbenlassen“, „Beihilfe zur Selbsttötung“ und „Tötung auf Verlangen“ unterteilt, wobei die rechtliche Situation in Deutschland berücksichtigt wird.
2. Der Begriff der Würde: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der Würde aus philosophischer und juristischer Perspektive. Der philosophisch-ethische Ansatz, insbesondere bei Kant, betont die Achtung der Menschenwürde als unantastbaren Wert. Der verfassungsrechtliche Aspekt bekräftigt die Bedeutung der Menschenwürde als Grundlage des Rechts.
3. Was bedeutet „Sterben in Würde“: Der Abschnitt erörtert den Wunsch nach personaler Identität und körperlicher Integrität als Ausdruck autonomer Würde. Er fragt, wie der Begriff „Sterben in Würde“ im Falle eines vollständigen Verlusts der Autonomie zu verstehen ist, und beleuchtet den Zusammenhang zwischen „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“, einschließlich der inneren Voraussetzungen für ein gutes Sterben.
4. Sterbehilfe und Sterbebegleitung: Das Kapitel analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe und untersucht den Zusammenhang zwischen „Sterben in Würde“ und „Selbstbestimmtem Sterben“. Ein Exkurs behandelt „Sterbenlassen“ aus deontologischer und konsequentialistischer Sicht. Schließlich werden die ethischen Probleme der „Beihilfe zur Selbsttötung“ und des „Sterbefastens“ erörtert.
Schlüsselwörter
Sterben in Würde, Gutes Sterben, Menschenwürde, Sterbeprozess, Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Palliativmedizin, Selbstbestimmung, Autonomie, Ethik, Deontologie, Konsequentialismus, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen zu "Sterben in Würde": Eine ethisch-philosophische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die ethisch-philosophischen Aspekte von „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“. Ziel ist es, die Begriffe zu klären und daraus Schlussfolgerungen für eine zeitgemäße Sterbekultur zu entwickeln. Die Arbeit berücksichtigt sowohl philosophische als auch juristische Perspektiven.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffsbestimmung von „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“, den philosophischen und juristischen Begriff der Würde, eine Analyse des Sterbeprozesses und der Sterbebegleitung, die ethische Bewertung von Sterbehilfe und die Entwicklung einer Ethik des Sterbens. Sie untersucht den Wunsch nach personaler Identität und körperlicher Integrität als Ausdruck autonomer Würde und fragt, wie der Begriff „Sterben in Würde“ im Falle eines vollständigen Verlusts der Autonomie zu verstehen ist.
Wie wird der Begriff "Sterben in Würde" definiert?
Die Arbeit untersucht den Begriff „Sterben in Würde“ aus verschiedenen Perspektiven und zeigt, dass er in der Gesellschaft vielfältig interpretiert wird. Sie differenziert zwischen individuellen Vorstellungen (Schmerzlinderung, Respektierung der Wünsche, soziale Begleitung) und der gesellschaftlichen Realität. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff, da er sowohl von Befürwortern als auch Gegnern der Sterbehilfe verwendet wird.
Wie wird der Sterbeprozess beschrieben?
Der Sterbeprozess wird in vier Phasen unterteilt (Rehabilitation, Präterminal, Terminal, Final). Der Fokus liegt auf den letzten beiden Phasen (Terminal- und Finalphase) im Kontext von „Sterben in Würde“.
Wie wird Sterbebegleitung definiert?
Sterbebegleitung wird im Zusammenhang mit Palliativmedizin definiert und umfasst Leidenslinderung und kommunikative Begleitung.
Welche Arten von Sterbehilfe werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen „Sterbenlassen“, „Beihilfe zur Selbsttötung“ und „Tötung auf Verlangen“ und berücksichtigt dabei die rechtliche Situation in Deutschland.
Welche Rolle spielt der Begriff der Würde?
Die Arbeit untersucht den Begriff der Würde aus philosophischer (insbesondere Kant) und juristischer Perspektive. Der philosophisch-ethische Ansatz betont die Achtung der Menschenwürde als unantastbaren Wert, während der verfassungsrechtliche Aspekt die Bedeutung der Menschenwürde als Grundlage des Rechts bekräftigt.
Wie wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe behandelt?
Das Kapitel analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe und untersucht den Zusammenhang zwischen „Sterben in Würde“ und „Selbstbestimmtem Sterben“.
Welche ethischen Probleme werden im Zusammenhang mit Sterbehilfe diskutiert?
Die Arbeit erörtert die ethischen Probleme der „Beihilfe zur Selbsttötung“ und des „Sterbefastens“ aus deontologischer und konsequentialistischer Sicht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für eine „Ethik des Sterbens“, basierend auf der Klärung der Begriffe „Sterben in Würde“ und „Gutes Sterben“ und der Berücksichtigung philosophischer und juristischer Perspektiven.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Sterben in Würde, Gutes Sterben, Menschenwürde, Sterbeprozess, Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Palliativmedizin, Selbstbestimmung, Autonomie, Ethik, Deontologie, Konsequentialismus, Bundesverfassungsgericht.
- Quote paper
- Frank Menn (Author), 2022, "Sterben in Würde" und "Gutes Sterben". Eine ethisch-philosophische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215607