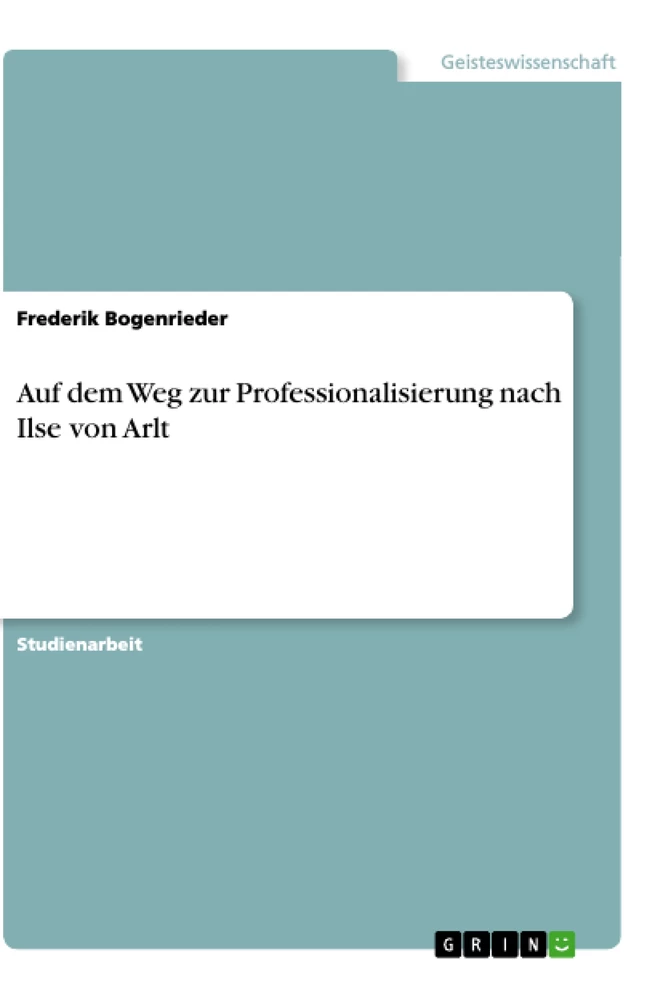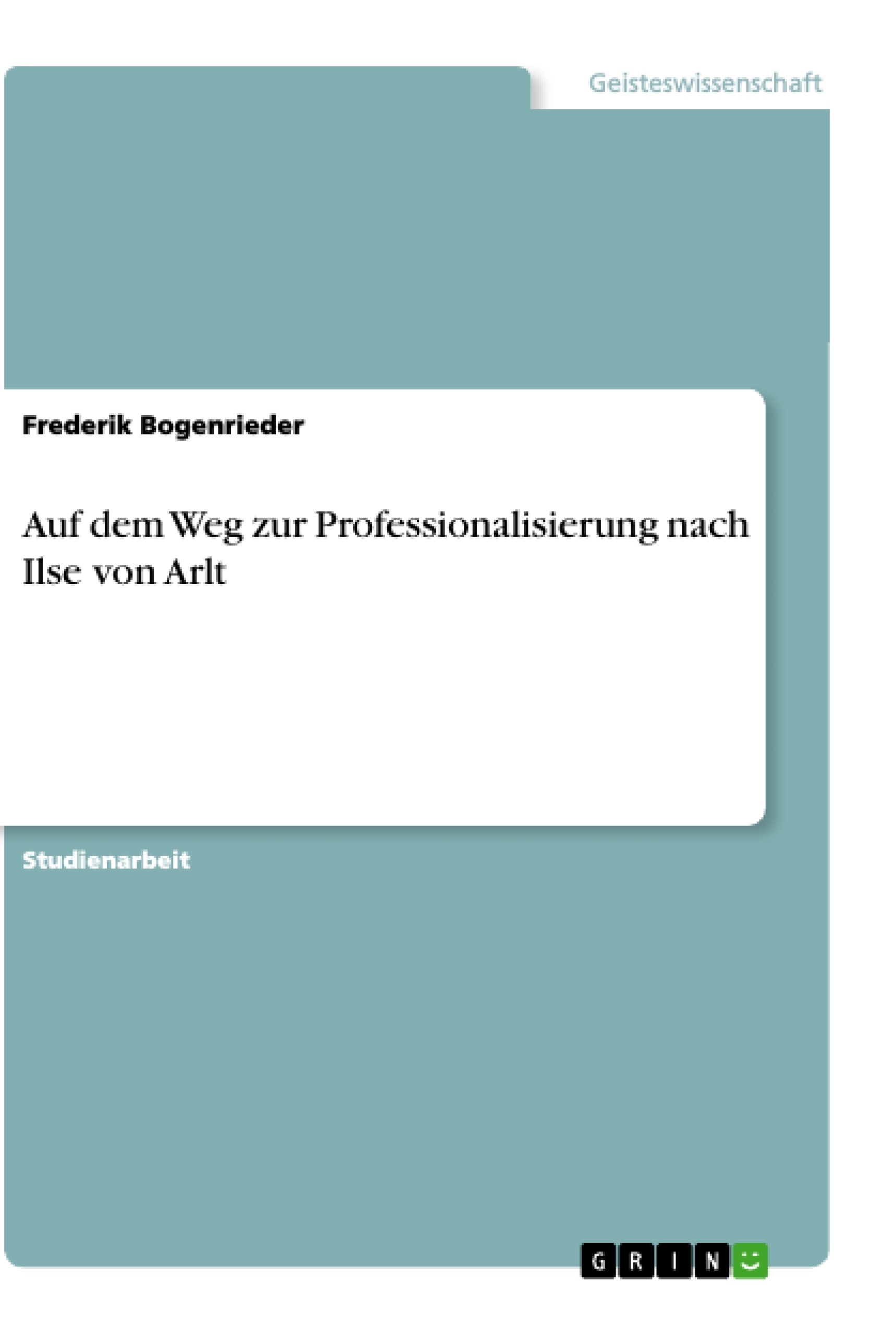Ilse von Arlt (1876-1960) gilt als eine der frühen Pionierinnen wissenschaftsgeleiteter Sozialer Arbeit. Sie beschäftigte sich eingehend mit Fragen der Armut und ihrer Behebung. Ihr ganzes Leben hindurch verfolgt sie das Ziel, die Fürsorge, oder wie sie es nennt, die „Volkspflege“, zu professionalisieren. Dies verknüpf sie mit dem aus ihrer Sicht zwingend notwendigen Ziel, eine Wissenschaft von den grundlegenden Bedingungen der Armut und ihrer Behebung hervorzubringen. Nach der Erkenntnis, dass die Methoden der deskriptiven Nationalökonomie unzureichend für die Erforschung des Phänomens der Armut sind, verfolgt sie den Ansatz, über die menschlichen Bedürfnisse auf die notwendigen Bedingungen zur Behebung der Armut zu schließen. Auf Grundlage der Erkenntnisse ihrer Feldforschungen entwickelte sie weitreichende Gedanken, wie das theoretische Gerüst einer zwingend erforderlichen Armutsforschung. Kennzeichnend ist ihre durchweg wissenschaftliche und systematische Vorgehensweise. Sie formuliert „Gesetzmäßigkeiten“ der Fürsorge, entwickelt und praktiziert Konzepte sowie Ansätze die die Ausbildung Fürsorgetätiger professionalisieren. Darüber hinaus entwickelte sie ein stark ausdifferenziertes Bedürfniskonzept.
Die nachfolgende Arbeit ist der Versuch, die auf dieser bedürfniskundlichen Grundlage entwickelte Fürsorgetheorie in ihren zentralen Punkten abzubilden und wesentliche Aussagen Arlts der heutigen Sozialen Arbeit zugänglich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1 Ilse von Arlt Biografischer Hintergrund
2 Die Fürsorgetheorie Ilse von Arlts
2.1 Fürsorge als angewandte Armutsforschung
2.2 Bedürfnisse als Ausgangspunkt aller Fürsorge
2.3 Ziele der Fürsorge und der Ausbildung
2.4 Kritik der Fürsorge
Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 "Beziehungen zwischen Bedürfnisbefriedigung des einzelnen und allgemeinen Notständen."
Einleitung
Ilse von Arlt (1876-1960) gilt als eine der frühen Pionierinnen wissenschaftsgeleiteter Sozialer Arbeit. Sie beschäftigte sich eingehend mit Fragen der Armut und ihrer Behebung. Ihr ganzes Leben hindurch verfolgt sie das Ziel, die Fürsorge, oder wie sie es nennt, die „Volkspflege“, zu professionalisieren. Dies verknüpf sie mit dem aus ihrer Sicht zwingend notwendigen Ziel eine Wissenschaft von den grundlegenden Bedingungen der Armut und ihrer Behebung hervorzubringen. Nach der Erkenntnis, dass die Methoden der deskriptiven Nationalökonomie unzureichend für die Erforschung des Phänomens der Armut sind, verfolgt sie den Ansatz über die menschlichen Bedürfnisse auf die notwendigen Bedingungen zur Behebung der Armut zu schließen. Auf Grundlage der Erkenntnisse ihrer Feldforschungen entwickelte sie weitreichende Gedanken, wie das theoretische Gerüst einer zwingend erforderlichen Armutsforschung. Kennzeichnend ist ihre durchweg wissenschaftliche und systematische Vorgehensweise. Sie formuliert „Gesetzmäßigkeiten“ der Fürsorge, entwickelt und praktiziert Konzepte sowie Ansätze die die Ausbildung Fürsorgetätiger professionalisieren. Darüber hinaus entwickelte sie ein stark ausdifferenziertes Bedürfniskonzept.
Die nachfolgende Arbeit ist der Versuch, die auf dieser bedürfniskundlichen Grundlage entwickelte Fürsorgetheorie in ihren zentralen Punkten abzubilden und wesentliche Aussagen Arlts der heutigen Sozialen Arbeit zugänglich zu machen.
Zu Anfang folgt eine detaillierte Ausführung ihrer Biografie, dies schien mir wichtig, um ein besseres Verständnis dieser bislang eher unbekannten Pionierin und besonderen Persönlichkeit der Sozialen Arbeit zu schaffen. Auch bin ich der Meinung, dass erst durch das Nachvollziehen ihres Werdegangs ein vollständiges Bild sowie ein tiefergehendes Verständnis ihrer Theorie inklusive ihrer Aussagen und Forderungen erlangt werden kann.
Dann erfolgt eine Erläuterung der von Ilse Arlt eingeforderten Armutsforschung und Wege zu ihrer praktischen Umsetzung. Dabei wird die dringliche Relevanz einer solchen Wissenschaft verdeutlicht und aufgezeigt, wie erst die „genaue Kenntnis der Bedingtheit menschlichen Gedeihens“ eine professionelle Legitimationsbasis für Fürsorgetätige bietet.
Danach folgt eine Darstellung der von Ilse Arlt erarbeiteten Bedürfniskunde, die sich auf dem immanenten Verständnis gründet, dass die menschlichen Bedürfnisse den Ausgangspunkt aller Fürsorge bilden.
Anschließend erfolgt eine kurze Skizzierung der Ziele der Fürsorge und der Ausbildung in der Arlts grundlegende Arbeitshypothese, dass der Hilfswille zu den grundlegenden Kräften des Menschen gehört, veranschaulicht wird. Daneben werden die von Ilse Arlt daraus erschlossenen Kernstücke der Hilfe, der Lebensfreude und der Gegenleistung kurz angeführt.
Zuletzt eine Darstellung der von Arlt formulierten Kritik der Fürsorge, in der sie eine Liste von Mängeln, d.h. Unzulänglichkeiten der Fürsorge benennt. Diese werden anhand einiger ausgesuchter Punkte erläutert.
Ich möchte anmerken, dass viele weitere Aspekte noch zu nennen wären. Ich habe mich in dieser Arbeit auf die wesentlichsten Punkte beschränkt, die meines Erachtens einen übersichtlichen Einstieg in die Theorie Ilse Arlts bieten. Das gesamte Werk im Rahmen dieser Hausarbeit zu schildern wäre unmöglich, ihr Werk und Schaffen umfasst eine große Fülle an Schriften, Aufsätzen, Büchern und zahlreichen, sonstigen Veröffentlichungen die teilweise weit verstreut und schwer zugänglich sind (Engelke et al. 2009: 278).
1 Ilse von Arlt Biografischer Hintergrund
„[…]. Schwerer aber war es mit dem Hilfstrieb, denn so viel ich mir auch aus Zeitungen und Büchern aneignete, so ernsthaft ich als Autodidakt Nationalökonomie und Sozialwissenschaften studierte, es dauerte bis in den Anfang meiner Zwanzigerjahre, bis mir die Erkenntnis aufdämmerte, nicht bloss ich sei so dumm, um zu wissen, wie man misshandelten Kindern, verlassenen Greisen, armen Frauen hilft, sondern dieses Wissen fehlte überhaupt“ (Arlt 2010b: 125).
Ilse von Arlt wird 1876 in Wien geboren. Ihre Mutter, Marie von Arlt, ist Malerin und ihr Vater, Dr. Ferdinand von Arlt, ist Augenarzt. Ihr Großvater entstammt einer armen Bergbauernfamilie. An der Wiener Universität ist er ein berühmter Professor für Augenheilkunde und wird aufgrund seiner Verdienste in den Adelsstand erhoben. Ilse v. Arlt lebt zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern im Hause des Großvaters. Frey (Frey 2005: 28) führt aus, dass sie hier von Kindheit an mit Wissenschaft und Wissenschaftlern vertraut ist und von dem akademischen Milieu, das sie umgibt, geprägt wird. Dort erhält sie auch Privatunterricht und schließt ihre Schulprüfungen mit Auszeichnung ab. (Engelke et al. 2009: 266; Frey 2005: 27f.).
Die einer Ärztedynastie entstammende Ilse (Erlt 1995) interessiert sich schon als Kind für die großen Fragen der Armut. Aus Anekdoten ihrer Kindheit ist bekannt, dass sie sich in den Ferien mit den finanziellen Sorgen ihres Schwimmlehrers befasste. Sie kümmerte sich ebenfalls um die Versorgung der Angestellten, die bei der Familie beschäftigt waren (vgl. Erlt 1995). Ihre „Entdeckungsreisen in die Lebensräume der ungesicherten Bevölkerungsschichten“ bahnten sich somit schon früh an (Frey 2005: 28f.).
1892 verließ die Familie Wien und wohnte bis 1902 in Graz (Lambers 2016: 72). Durch ihre 1901 erschienene, erste Veröffentlichung eines Zeitungartikels der von einem Kongress für Wohnungsfragen in München handelt, werden die führenden Sozialpolitiker Prof. Dr. Philippovich in Wien und Prof. Dr. Mischler in Graz auf sie aufmerksam und bieten ihr an ein Referat über die „Gewerbliche Nachtarbeit der Frauen in Österreich“ für die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeitsschutz zu halten (Arlt 2010b: 125f.; Frey 2005: 29). Da Frauen zu dieser Zeit keinen Zugang zu Universitäten haben, ermöglicht erst die Gunst der beiden Professoren, dass sie als Gasthörerin Vorlesungen und Seminare der beiden besuchen darf. Zuvor musste sie eine ihr angebotene Stelle als Erzieherin aufgrund ihrer schwachen körperlichen Verfassung ablehnen und hatte, auch weil es ihre Wunschwissenschaft – die Erforschung der Armut, noch nicht gibt, als Autodidaktin studiert (vgl. Arlt 1950: 9). Sie interessiert sich für Nationalökonomie, Pädagogik und Medizin (Engelke et al. 2009: 267). Aus der Nationalökonomie heraus entlehnt und entwickelt Arlt den für ihre Theorie der Armut entscheidenden Ansatz der Bedürfnisorientierung (Lambers 2016: 72).
Um sich selbst ein Bild von der Armut zu machen und um Forschungen zu betreiben sucht sie die Orte der Armut in Österreich auf. Durch die Publikationen ihrer Ergebnisse wird die Fachwelt auf sie aufmerksam. Aufgrund ihrer Veröffentlichungen und der Empfehlung Philippovichs bekommt sie eine Stelle als erste Gewerbeinspektorin Österreichs angeboten, die sie erneut, wegen ihrer schlechten körperlichen Konstitution, nicht antreten kann. Von 1901-1905 wird ihr ausnahmsweise erlaubt Vorlesungen der Nationalökonomie an der Wiener Universität zu besuchen, einen Abschluss macht sie nicht (Engelke et al. 2009: 267).
Schließlich gründet sie 1912 in Wien zusammen mit der Sektion „Soziale Erziehung“ des allgemeinen österreichischen Frauenvereins, der „Sozialpädagogischen Gesellschaft“, und der „Österreichische[n] Gesellschaft für Kinderforschung“ die erste Fürsorgerinnenschule, um dort ihre Vision von einem eigenständigen Beruf, der Wohlfahrtspflegerin, zu verwirklichen. Die Schule trägt den Namen die „Vereinigten Fachkurse für Volkspflege“ und wird von Arlt geleitet. Neben ihr unterrichten dort auch angesehene Fachdozenten. Mit der Namensgebung „Volkspflege“ statt dem verbreiteten „soziale Arbeit“ versucht sie zu verdeutlichen, dass sie für eine Hilfstätigkeit ausbilden will, nicht wie sie war, sondern wie sie werden sollte.
Ihr Buch „Die Grundlagen der Fürsorge“, das auch als Lehrbuch dient, erscheint 1921 mit Subventionen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung. Sie veröffentlicht eine Vielzahl von Artikeln die Fragen der Armut behandeln und ist Herausgeberin von Ratgebern für die Lebenshaltung. In Anlehnung daran, erhält sie den Ehrentitel „Bundesfürsorgerat“, als Anerkennung ihres Engagements und ihrer Leistungen.
1938 wird ihre Schule von den Nationalsozialisten geschlossen. Da sie von den Einkünften der Schule lebt und keine finanziellen Rücklagen hat, beginnt für Arlt eine Zeit größter Armut. Weil ihrer Großmutter mütterlicherseits eine jüdische Abstammung nachgewiesen wird, erhält sie ein Publikationsverbot und ihre Bücher werden vernichtet. Arlt, die alleinstehend ist, lebt während der Kriegsjahre zurückgezogen und wird von ihren (ehemaligen) Schülerinnen, Bekannten und Verwandten mit Lebensmitteln unterstützt.
Nach Kriegsende 1946 eröffnet sie wieder ihre Schule, die aber 1950, wegen finanzieller Schwierigkeiten, endgültig schließen muss. Ein weiterer Grund dafür ist auch, dass die Fürsorgeschulen und Akademien der Stadt und der Caritas durchgesetzt werden. Im Jahr 1955 wird Ilse Arlt mit dem Dr. Karl Renner-Preis ausgezeichnet, dieser vermochte aber nicht die mittlerweile betagte Frau wieder ins Licht einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken. Ihr Spätwerk „Wege zu einer Fürsorgewissenschaft“ erscheint 1958 und greift ihre Grundannahmen auf, die in den „Grundlagen der Fürsorge “ zu finden sind. Ferner ergänzt und aktualisiert sie diese. Ihren Nachlass, der zahlreiche und umfangreiche Materialsammlungen beinhaltet, vermacht sie der Fürsorgeschule der Stadt Wien. Ilse von Arlt stirbt 1960 im Alter von 84 Jahren (Engelke et al. 2009: 267f.).
Ihr Leben und Werk geraten in Vergessenheit und sollten erst wieder ab 1995 durch eine verdienstvolle Diplomarbeit von Ursula Erlt (Erlt 1995) und nachfolgend von Silvia Staub Bernasconi, Cornelia Frey (Frey 2005), Peter Pantucek und Maria Maiss (Pantucek und Maiss 2009) wieder ins Bewusstsein der Praktiker und Forschenden der Sozialen Arbeit gelangen (Pantucek und Maiss 2008). Heute ist Ilse Arlt Namensgeberin des 2007 an der FH St. Pölten (Österreich) gegründeten Instituts für Soziale Inklusionsforschung.
2 Die Fürsorgetheorie Ilse von Arlts
2.1 Fürsorge als angewandte Armutsforschung
„Soll die Fürsorge ihren ungeheueren Aufgaben in der modernen Welt entsprechen, so muß sie sich des Werkzeuges bedienen, das anzuwenden wir gewöhnt sind, der Wissenschaft!“ (Arlt 2010b: 53). Mit dieser Forderung, die Arlt ihren Ausführungen der von ihr eingeforderten Armutsforschung voranstellt, verweist sie auf die zwingende Notwendigkeit der wissenschaftlichen Fundierung, um die offenkundigen Unzulänglichkeiten bisheriger Fürsorge zu beseitigen und den mannigfaltigen Problemlagen einer modernen Welt zu entsprechen (Arlt 2010b: 53; Engelke et al. 2009: 271).
In ihrer Gegenstandsbestimmung der Fürsorge versucht sie diese in der Bekämpfung von Armut zu fassen (Lambers 2016: 74). Fürsorge ist für Arlt angewandte Armutsforschung.
„Ihre Aufgabe ist: das Erkennen von eingetretenen oder drohenden Schäden, das Verstehen ihrer unmittelbaren und entfernteren Ursachen, ihren weiteren Wirkungen, mögen sie der Person selbst oder der Umwelt anhaften, Verständnis für das Tempo der Lageverschlechterung. Die Analyse sämtlicher günstiger oder ungünstiger Faktoren, die Kenntnis der möglichen und der vorhandenen Hilfsweisen, die Wege zu ihrer Einleitung und das Überprüfen ihrer Wirksamkeit“ (Arlt 2010b: 53).
Um die Grundwissenschaft von der Armut und ihrer Behebung zu verwirklichen führt sie aus: „Notwendig ist also:
1.) Wissenschaftliche Durcharbeitung der Armutstatsachen und der Fürsorgeprobleme in ihren verschiedensten Formen. Ausarbeiten von Definitionen, Festsetzung von Meßmethoden, Auffassen der Notstände als Bewegung, Rückschau auf mehrere Generationen, Ausarbeiten der Armuts-, Wirtschafts- und Fürsorgegeschichte jedes Landes, bei internationaler Vergleichung der Hilfsmethoden, eingehendes Berücksichtigen von Verfassung, Rechtswesen, Unterrichtswesen, Herkommen und Brauchtum, Klima, Wohndichte, Produktion jedes Landes, Feststellen der Grenznot jedes Landes (unter Grenznot verstehe ich den tiefsten in einem Lande geduldeten Notstand).
2.) Ausarbeiten der Wechselbeziehungen zwischen der Fürsorgewissenschaft und anderen Wissenschaften.
3.) Umfassende allgemeine Vorbildung der fürsorgetätigen Männer und Frauen.
4.) Gelegenheit für möglichst viele – praktisch alle – Menschen zu einem Wirken für andere, denn Altruismus gehört zu den wesentlichen Eigenschaften des Menschen, durch deren Verkümmern sein eigenes Gedeihen gefährdet wird“ (Arlt 2010b: 54).
Da mit dem Wort Wissenschaft oft Missbrauch getrieben werde, sei für den Bereich des Helfens der strenge Maßstab angelegt. Wissenschaft führt sie aus „ist systematisiertes Wissen, eine geordnete, durch Ideen und Hypothesen zur Einheit verbundene Vielheit von Erfahrungen und auf Erfahrungen beruhenden Begriffen, Urteilen und Schlüssen.“ (Arlt 2010b: 54).
Bei der Frage was die „Wissenschaft von Not und Hilfe“, die sie als eine interdisziplinäre Wissenschaft versteht, hervorbringen soll sieht sie u. a. folgende Punkte als wichtig an:
„1.) Die Bestimmung von Maßstäben für Art und Ausmaß [der Not und Hilfe] im Einzelfall.
2.) Eine Übersicht über das Vorkommen von Armut zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Ländern, als Ergänzung der diese Seite des Lebens fast völlig vernachlässigten Geschichtsschreibung.
3.) Die Hilfen in ihrem häufigen Neuentstehen, ihrem häufigen Zugrundegehen oder ihrer Entartung zu schildern, die durch Gesetze gesicherten Fortschritte, die Mannigfaltigkeit der Motivationen, die Sachverständigkeit der Durchführung zu erkennen. Den hilfreichen oder hemmenden Zeitgeist zu analysieren, das Verschwinden und Wiederauftauchen zu bemerken, ihr rein lokales Entstehen und Wirken, oder ihre welt- oder mindestens kontinentale Kraft zu sehen.
4.) Der persönliche Faktor: Die großen Persönlichkeiten [des Helfens], ihr Wirken, die Wurzel ihres Schaffens, Psychologie der Helfer, ihre Reaktion auf die Umwelt, die Reaktion der Umwelt auf sie.
5.) Quellenforschung für dies alles.“ (Arlt 2010b: 54f.)
Weiter fordert sie: „Die Fürsorge muß endlich jenes Wissen entwickeln, das
a) den fürsorgenden Berufen des Arztes, des Lehrers, des Richters, der Krankenpflegerin Einblick in die Gesetzmäßigkeit und Erscheinungsformen der Hilfsbedürftigkeit und die Arbeitsrichtungen des Helfens gibt,
b) dem Historiker und Sozialpolitiker Anhaltspunkte für die einstigen Zustände und die daraus resultierenden Entwicklungstendenzen verschafft,
c) die freiwilligen Helfer mit den bestehenden Leistungen, ihren Verantwortungen und Möglichkeiten vertraut macht, damit sie sich nutzbringend einbringen können“ (Arlt 2010b: 57).
Arlt kritisiert: „Es fehlt die Kenntnis jener kleinsten Tatsachen, die für die Armut bestimmend und für die Fürsorge richtunggebend sein könnten“(Arlt 2010b: 57f.). Armutsforschung müsse bei der Ergründung der basalen menschlichen Bedürfnisse oder Gedeihenserfordernisse beginnen. Diese seien u.a. aus den beobachtbaren und messbaren Gedeihensmängeln zu erschließen (vgl. Arlt 1958: 60).
„Die Gedeihenserfordernisse sind bestimmbar, und nun läßt sich der jeweils vorliegende Abstand vom Richtigen messen“ (Arlt 2010b: 61). Das zentrale Ziel der Armutsforschung Ilse Arlts ist die Bestimmung des jeweiligen Abstands zwischen dem was zum Gedeihen notwendig ist und dem was aufgrund der Armut fehlt. Die Operationalisierung dieses Abstands gelingt ihr durch die von ihr bestimmten menschlichen Grundbedürfnisse, diese sind exakt definiert und überprüfbar. Somit ergibt sich eine genaue Messbarkeit und Festbarkeit. (Frey 2005: 75)
„Die ungeheuere Verantwortung, als Fürsorger in das Leben anderer einzugreifen, kann nur jener tragen, der die Grundlage aller Fürsorge, die genaue Kenntnis der Bedingtheit menschlichen Gedeihens, aus eigener Anschauung und im Geiste der Wissenschaft erworben hat“ (Arlt 2010a). Hierin wird die große Bedeutung der „genauen Kenntnis der Bedingtheit menschlichen Gedeihens“ sichtbar, erst die Aneignung dieses Wissens biete eine professionelle Legitimationsbasis für Fürsorgetätige (Staub-Bernasconi 2002: 30).
2.2 Bedürfnisse als Ausgangspunkt aller Fürsorge
„Den Ausgangspunkt aller Fürsorge müssen die menschlichen Bedürfnisse abgeben; nur von ihrer genauen Einschätzung kann die folgerichtige und vollständige Behebung von Notständen ausgehen“ (zit. aus Engelke et al. 2009: 272)Damit beschreibt Arlt, dass fürsorgerische Intervention dort einsetzen muss, wo die Bedürfnisbefriedigung unter dem zum menschlichen Gedeihen notwendigen zurückbleibt. Dabei bildet die genaue Kenntnis von dem jeweiligen unterschreiten der Schwelle eines Bedürfnisses (Notgrenze) und ihrer Bedingungen die Basis professionellen fürsorgerischen Handelns.
Nach Arlts Auffassung ist Armut eine Negation und kann deshalb nicht Ausgangspunkt für positive Arbeit sein, wie die Fürsorge es sei. Des Weiteren führt sie an, dass es, weil sie so vielseitig sei, keine genaue und endgültige Definition der Armut bzw. des Armen geben könne. Mangels einer genauen Definition verwehrt sich auch der Weg einer wissenschaftlichen Erforschung des Phänomens der Armut. Eine Lösung für dieses Dilemma findet sie im positiven Gegenstück der Armut – im menschlichen Gedeihen (Frey 2005: 74f.; Arlt 2010b: 61).
Sie verfolgt damit den Ansatz, von den Gedeihensmängeln auf die menschlichen Gedeihenserfordernisse und damit auf die menschlichen Bedürfnisse zu schließen (Arlt 2010b: 61). Umgekehrt gilt, für die von Ilse Arlt eingeforderte Armutsforschung, erst die Kenntnis der menschlichen Bedürfnisse ermöglicht die Grundlage für aussagekräftige Armutserhebungen. Weiter definiert sie Armut als Mangel der Mittel zur richtigen Bedürfnisbefriedigung (Arlt 2010b: 64): „Armut ist sonach die wirtschaftliche Unmöglichkeit zur ausreichenden Befriedigung aller oder einzelner der menschlichen Grundbedürfnisse nach: Ernährung, Wohnung, Körperpflege, Bekleidung(…)“ (Lambers 2016: 75).
Für Ilse Arlt sind Bedürfnisse von innerpsychischen und gesellschaftlichen Entstehungs- und Befriedigungsbedingungen abhängig. „Bedürfnisse sind „seelische, Vorgänge“ die der Bedürfnisbefriedigung vorangehen, d.h.
1. die durch innere Lebensvorgänge oder äußere Umstände entstanden und ausgelöst werden,
2. die bewusst (als Unlust) oder nicht bewusst sein können,
3. die den Wunsch nach Beseitigung der Unlust auslösen, aber deren Befriedigung bis zu einem bestimmten Maß aufgeschoben oder in Konkurrenz mit anderen Bedürfnissen treten und mithin unterdrückt werden kann,
4. die über erworbene Bilder der Bedürfnisbefriedigung gesteuert werden,
5. die – als Begehren – sittlich-ethischer Beurteilung unterliegen,
6. die kurze oder sich über Jahre erstreckende Handlungen der Bedürfnisbefriedigung auslösen“ (1921, S. 37f.)
Dabei ist zwischen „regelmäßigen Lebensbedürfnissen“, die jederzeit befriedigt werden müssen und „fallweisen sonstigen Bedürfnissen“ zu unterscheiden (S.36).“ (zit. aus Staub-Bernasconi 2002: 28)
In Arlts Bedürfnistheorie benennt sie 13 Grundbedürfnisse/Bedürfnisklassen, die sie auf Grund folgender Erhebungsmethoden ermittelt hat:
1. die tägliche Anschauung
2. die präzise Erhebung des gedeihenden und nicht gedeihenden Lebens;
3. die Analyse von Elendsschilderungen und Schilderungen aus der gediehenden Welt in der „schönen Literatur“;
4. Analyse von Reisebeschreibungen aus verschiedenen Ländern;
5. Analyse von Reformbewegungen gegen Alkohol, für hygienische Ernährung.
Diese Bedürfnisklassen sind: 1. Ernährung, 2. Wohnung, 3. Körperpflege, 4. Bekleidung, 5. Erholung, 6. Luft, 7. Erziehung,8. Geistespflege, 9. Rechtsschutz, 10. Familienleben, 11. Ärztliche Hilfe und Krankenpflege, 12. Unfallverhütung und erste Hilfe, 13. Ausbildung zur wirtschaftlichen Tüchtigkeit (Engelke et al. 2009: 273)
Sie vertritt die Auffassung, dass diese Grundbedürfnisse naturgegeben, allen Menschen gemeinsam sind und darüber hinaus stehen sie in unterschiedlicher Weise miteinander in Verbindung. Die Qualität der Befriedigung eines Bedürfnisses wirkt sich auf die Qualität der anderen Bedürfnisse und insgesamt auf das menschliche Gedeihen aus (Pantucek und Maiss 2008).
Dabei unterscheidet sie zusätzlich zu den Bedürfnissen verschiedene Altersstufen und besondere Bedürfnisklassen. Die Altersstufen gliedert sie in 0-1, 1-3, 3-6, 6-14, 14-18, das reife Mannes- und Frauenalter und das Greisenalter, die besonderen Bedürfnisklassen in: Sieche, Kranke, Blinde, Behinderte, Frauen in Ausnahmezuständen. Die Bedürfnisse gelten zwar gleichermaßen für arm und reich, aber ihre Ausprägung ist je nach Altersstufe und individueller Besonderheiten verschieden. (Frey 2005: 76f.; Arlt 2010b:62f.).
Die Beziehungen zwischen mangelhafter Bedürfnisbefriedigung und einzelnen bzw. allgemeinen Notständen; nach dem Ursache – Wirkung – Prinzip, zeigt sich eindrücklich in der folgenden, eigens von Ilse Arlt angefertigten Abbildung (links sind die Grundbedürfnisse 1-13 aufgelistet und rechts der durch mangelhafte oder fehlerhafte Bedürfnisbefriedung ausgelöste Notstand A-K):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 "Beziehungen zwischen Bedürfnisbefriedigung des einzelnen und allgemeinen Notständen."
Quelle: Coverbild (Arlt 2010b)
Für jedes der menschlichen Bedürfnisse lässt sich laut Arlt eine genau zu bestimmende „Notschwelle“ erkennen. Die Notschwelle kennzeichnet „die Mindesterfordernisse der Bedürfnisbefriedigung“ (Arlt 1921). Dadurch gelange man zur Messbarkeit der Bedürfnisbefriedigung und des Notstandes. Der Befriedigungsgrad eines jeweiligen menschlichen Grundbedürfnisses sei mehr oder weniger exakt zu bestimmen (Engelke et al. 2009: 273f.).
Die „Notschwelle“ ist individuell zu verstehen. Daneben hat Ilse Arlt den Begriff der „Grenznot“ eingeführt, dieser verweist über den Einzelfall hinaus und kann mit dem Begriff der „relativen Armut“ geleichgesetzt werden: „Der Entwicklungsstand eines Volkes wird nicht nur durch seine Höchstleistungen bestimmt, sondern auch durch seine Grenznot. Das ist die tiefste geduldete Entbehrung“ (Frey 2005: 85).
„Bedürfnisbefriedigung ist Arlt zufolge abhängig von der Verfügung über folgende Mittel und Ressourcen in einem bestimmten gesellschaftlichem Handlungsraum (1921, S. 32 und 37):
1. die wirtschaftlichen Möglichkeiten, sich die gewünschten Dinge zu beschaffen – dank Besitz an Sachgütern oder deren Benützung;
2. das eigene oder fremde Können – Kenntnisse und Fertigkeiten (heute: Bildung, Beruf bzw. Kompetenzen) und
3. die Möglichkeit, über die eigene Zeit und die Zeit anderer zu verfügen.
Und schließlich verweist sie auf zwei problematische Wege, um sich von den Sorgen für den nächsten Tag zu befreien: Entweder man strebt nach Gewalt, Macht und Reichtum, das heißt nach der Verfügung über die Arbeitsleistung und den Besitz anderer. Oder man versucht die Bedürfnisbefriedigung planmäßig zu vereinfachen, das Wünschen einzuschränken, um seine Existenz mit dem kleinsten Maß an Aufwand zu sichern.(1921, S. 36)“ (Staub-Bernasconi 2002: 29f.)
Armut, lässt sich ergänzend sagen, ist Arlt zufolge somit Mangel an wirtschaftlichen Mitteln und/oder an Zweckstreben und/ oder an Zeit und/oder an Können.
„Für die Befriedigung von Bedürfnissen sind aus der Perspektive Ilse Arlts vor allem die entsprechenden sozialpolitischen Maßnahmen verantwortlich. Diese Maßnahmen haben dort einzusetzen, wo die Bedürfnisbefriedigung von Menschen wesentlich hinter dem zu ihrem Gedeihen Notwendigen zurückbleibt. Dabei ist folgerichtig alle Arbeit vom grundlegenden Anspruch auf Bedürfnisbefriedigung und dieser von der Zerlegung nach Einzelbedürfnissen abhängig. Arlt vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die Verantwortung, welche die Fürsorger/innen auf sich nehmen, wenn sie in das Leben anderer eingreifen, nur diejenigen tragen können, die die Grundlagen der Fürsorge – d.h. die genaue Kenntnis der Bedingtheit menschlichen Gedeihens – aus eigener Anschauung und im Geiste der Wissenschaft erworben haben“ (zit. aus Frey 2005: 78)
Das bedeutet : „Erst die Schulung unserer Auffassung in dieser Hinsicht kann uns befähigen, für jene mitzubestimmen, deren ganzer Lebensinhalt dauernd oder zeitweise in der Sorge um die Befriedigung der dringendsten augenblicklichen Bedürfnisse besteht (Arlt 1921: 6).
Arlt ist der Auffassung, dass nicht die Armutszustände als Ausgangspunkt der Hilfe zu sehen sind, sondern die menschlichen Bedürfnisse (Frey 2005: 94). Für die Fürsorge hält sie fest, „die Ganzheit des Lebens hat beständig vor uns zu stehen, der Mensch als Ausgangspunkt und Ziel unserer Arbeit“ (Arlt 2010b).
2.3 Ziele der Fürsorge und der Ausbildung
Die Grundannahme Ilse Arlts, dass der Hilfswille zu den grundlegenden Kräften es Menschen gehört, schließt sie aus dem Umstand, dass es zu allen Zeiten und in allen Kulturen, hilfsbereite und gütige Menschen gegeben habe. Daraus leitet sie ihre Arbeitshypothese ab; eine gewisse Hilfsbereitschaft zähle zu den wesentlichen Merkmalen des Menschen (Arlt 2010b: 39f.; Engelke et al. 2009: 276).
Dabei benennt sie zwei Kernstücke der Hilfe: „Lebensfreude – dies ist eines der Kernstücke der Hilfe, ist das Kriterium, die unumstößliche Zielsetzung statt des bloßen Leidenlinderns. Das zweite Kernstück heißt Gegenleistung, nicht im Sinne einer Bezahlung, sondern einer Kunst, der Demütigung vorzubeugen, in dem man den Befürsorgten seinerseits irgendwie helfen läßt“ (Arlt 2010b: 42).
Damit verweist sie erstens auf die Notwendigkeit der fürsorgerischen Hilfen, nicht nur Leiden zu lindern, sondern vielmehr auch das Steigern der Lebensfreude zu ihrer Zielsetzung zu machen. Leiden lindern kann nur die Lösung sein. Lebensfreude – ist als wesentlicher Ausgangspunkt zu verstehen, von dem aus erfolgreich Hilfe geleistet werden kann. Zweitens durch die Möglichkeit einer Gegenleistung der Befürsorgten Demütigung vorzubeugen. Dies schafft für Adressat*innen Sozialer Arbeit die Möglichkeit zur Partizipation und kann im besten Fall dazu führen den Zugang zum Gemeinwesen durch eigene Beiträge zu ermöglichen. (Frey 2005)Diesem Punkt kommt auch, in Anbetracht dessen, dass Demütigung im Sozialwesen weit verbreitet ist, eine bedeutende Relevanz zu (vgl. Frey 2005: 94f. ; Pantucek und Maiss 2008).
Die Zielsetzung der Armenpflege soll stets über materielle Leistungen hinaus, durch Anleitung, Belehrung, Vermittlung und Beratung die Selbsthilfe der Armen, Verarmten und Verarmenden fördern. Am ehesten gelingen könne dies durch eine rationelle, generalisierte Ausbildung aller Fürsorger*innen. Deshalb möchte Arlt die in verschiedenste Berufsgruppen eingeteilten sozialen Frauenberufe im Beruf der „Wohlfahrtspflegerinnen“ zusammenfassen (vgl. Engelke et al. 2009: 276f.).
In Bezug auf die von ihr gegründeten Vereinigten Fachkurse für Volkspflege hat Arlt die wichtigsten Lehrziele so definiert: „Ziel der Ausbildung war es, die Schülerinnen zur Erkennung von Ausnahmesituationen und zur Erforschung der Hilfe zu befähigen. Der erste Jahrgang lernte alle Faktoren kennen, welche das menschliche Gedeihen fördern und hemmen. Im zweiten Jahr standen die theoretischen und praktischen Hilfsmöglichkeiten im Vordergrund der Lehre“. […] „Es wurden grundsätzlich die Voraussetzungen der Fürsorge gelehrt, nicht aber für irgendeine Fürsorgeform abgerichtet.“ (zit. aus Frey 2005: 86).
„Volkspflege ist die Hilfsweise, die nach genauer Erfassung der Not die Hilfe stets unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Grundbedürfnisse volkswirtschaftlich richtig aufbaut und bei der Durchführung Volksart und Volkssitte berücksichtigt“ (zit. aus Frey 2005: 87).
Wie Arlt die Ideen, die ihr besonders am Herzen lagen, in der Ausbildung umgesetzt hat werden in folgenden Punkten besonders deutlich:
- Gelernt werden soll die Beobachtung und die Würdigung der Klientel, nicht ihre Abwertung und Verurteilung.
- Es wird geübt, strukturelle Probleme nicht mit individuellen Problemen zu vermischen.
- Die Kritik hat sich auf die Armut zu richten, nicht auf die Personen der Hilfebedürftigen.
- Es geht nicht um die Individualisierung von Notlagen, sondern um eine personenorientierte Sichtweise auf die Klientel.“ (vgl. Frey 2005: 89).
Und schließlich, in einer bemerkenswerten Aussage Ilse Arlts, hält sie für die Ausbildung Fürsorgetätiger fest: „Das wichtigste, die Menschenliebe, kann man nicht lernen. Es muß von vornherein da sein, aber bei vielen Diskussionen zeigte sich, daß die Schülerinnen zwar wirklich aus Menschenliebe den Fürsorgeberuf gewählt hatten, durch Zeiteinflüsse jedoch vielfach gehemmt waren, sie voll zuzugeben und zu erleben. Immer wieder kam die Frage der Euthanasie auf, und immer wieder meinte die Jugend, der moderne Mensch müsse sich dazu bekennen. Erst die Ausdeutung ihrer eigenen Erfahrungen bei der Krankenpflege brachte sie zur idealen ärztlichen Auffassung der Unverletzbarkeit des Menschenlebens“ (Arlt 2010b: 121).
2.4 Kritik der Fürsorge
Ihre Kritik der Fürsorge beginnt Arlt mit einer Würdigung dessen „was der Hilfswille in den […] letzten 70 Jahren geleistet hat […]“ (Arlt 2010b: 13). Dabei konstatiert sie, dass die Lebenserwartung der Europäer*innen stetig gestiegen, die Kindersterblichkeit stark zurückgegangen ist. Die Einführung der verschiedenen Versicherungsformen, das gesetzliche Verbot der Kinderarbeit, die gesetzliche Festlegung des 8 Stundentags und der bezahlte Urlaubsanspruch aller Werktätigen sieht sie als „die wichtigste[n] Voraussetzung[en] für die Besserung im Volksgedeihen […]“ (Arlt 2010b: 13ff.). Daneben finden auch die vielfältigen Beratungsangebote, wie die unentgeltlichen Rechtsberatungsangebote, sowie verschiedenste Bildungsangebote (der Allgemeinheit zugängliche Volksbildungseinrichtungen, Bibliotheken, Vorträge, Museumsbesuche, Studienreisen und Mitarbeit verschiedenster Art) Erwähnung. Zusätzlich nennt sie die enormen Fortschritte in Psychiatrie, Medizin und in allgemein in der Wissenschaft. (Arlt 2010b: 14)
Im Folgenden, eine Auflistung Ilse Arlts, die die massenhaften Neuerungen und Fortschritte in der Vorsorge bzw. der Versorgung von Hilfebedürftigen demonstrativ veranschaulicht:
[…] freies Wochenende, Siebenstundentag […] Psychologische Eignungsprüfungen und wirtschaftliche Beratung stehen den Schulabgängern zur Verfügung […] infolge Alters oder Invalidität aus der gewohnten Arbeit Ausscheidenenden bemühen sich immer mehr Rehabilitationseinrichtungen, in denen Ärzte und Lehrer bewundernswerte Leistungen an Umschulungen und Anpassungen erreichen […] Erwachsenenbildung […] Eheberatung und Scheidungsberatung, Erziehungsberatung und Beratung für durchgefallene Schüler; Beratung für Selbstmörder; Beratung für den täglichen Speisezettel […] Berufsberatung, Beratungsstellen für Rauschgiftsüchtige und ihre Familien sowie Rechtsberatungsstellen. Der Zahl nach führend sind Mütterberatungsstellen geworden. […] Ambulatorien, TBC-Fürsorgestellen, Untersuchungsstellen bei Krebsverdacht […] usw. […] Blutbanken, Milchbanken, sogar Augenbanken, Blutspendervermittlung dienen allen, reich und arm, die in spezifischen Nöten sind, ebenso wie die Feuerwehren, die Wasserwehren, die Bergretter, die Rettungsschwimmer, […]. (Arlt 2010b: 14f.).
Trotz dessen, „daß der europäisch-amerikanische Kulturkreis mit Stolz auf das Erreichte blicken kann“, warnt sie davor diese Erfolge zu überhöhen: „Denn jeder Fortschritt löst neue Ideen aus, bringt neue Einsichten und Erfahrungen und beweist den Schaffensfreudigen wie sehr wir erst am Anfang stehen“ (Arlt 2010b: 17). Im Folgenden veranschaulicht sie durch eine Auflistung gesetzmäßiger Unzulänglichkeiten der Fürsorge, was sie mit dieser Aussage meint:
Die Gesetzmäßigkeiten des Helfens:
1. „Jede, auch die beste Einrichtung bewirkt zwangsläufig unerwünschte Nebenwirkungen.“
Dieser Satz beinhaltet die Forderung den Blick auf die Nebenwirkungen, das Unerwünschte, und Misslingende einer jeden Hilfe zu richten (Pantucek und Maiss 2008). Diese zu erkennen und vorauszusehen kann nur wahrhaft wissenschaftlicher Armutsforschung und Fürsorge-Analyse gelingen (Arlt 2010b).
2. „Meist ist die Zahl derer bekannt, denen geholfen wurde, nicht die der Übrigbleibenden.“
Mit dieser an die Fürsorge gerichteten Kritik ruft Ilse Arlt dazu auf, die Perspektive auch auf diejenigen zu richten, die von jeweiligen Hilfsangeboten nicht erreicht werden. Positive Leistungsbilanzierungen entsprechender Einrichtungen würden dadurch kritisch auf ihre Funktion für die Gesamtheit potenzieller Klient*innen geprüft und aussagekräftiger.
Ein Beispiel für die praktische Umsetzung eines solchen Vorhabens bietet die FH St. Pölten:
„Bei einer Evaluationsstudie über Suchtberatungsstellen hat ein Team der FH St. Pölten den Erfolgsberichten der Stellen die Frage gegenübergestellt, wie viele potenzielle KlientInnen es im Zuständigkeitsbereich der Beratungseinrichtungen gibt, und das Verhältnis der erreichten zu den nicht erreichten Personen zur Beurteilung der Wirksamkeit der Einrichtungen herangezogen. Das rief nicht nur Jubel hervor und führte durchaus zu anderen Ergebnissen. Die Frage, ob Programme bzw. Einrichtungen ihr Zielpublikum in nennenswertem Ausmaß erreichen, welche Bedürftigen sie wie ausschließen, ist stets relevant“ (Pantucek und Maiss 2008).
3. „Die Durchführung an sich guter Einrichtungen ist oft fehlerhaft oder mangelhaft. Immer fehlt die Leistungsbilanz, immer die Gesamtschau für jedes Individuum.“
Als Beispiele hierfür führt Ilse Arlt Beispiele der Missachtung des Lebenszusammenhangs der Klient*innen auf. Die Hilfe müsse sich am Leben des/der Einzelnen bemessen (Pantucek und Maiss 2008).
„Wann wird der Mensch, der in seinen Notwendigkeiten und individuellen Möglichkeiten genau erkannte einzelne Mensch, im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, und nicht das Gefüge der Fürsorge?“ (Arlt 1958:17)
Ein eindrückliches Beispiel, sowohl für die Schwierigkeit als auch für die Notwendigkeit diese Forderung in die Praxis umzusetzen, bietet das Ilse-Arlt-Institut in St. Pölten (Österreich):
„Die Lebensgeschichten der KlientInnen sind nicht so leicht zugänglich wie die Daten der Einrichtungen, sie sind schwierig auszuwerten und der Erfolg der Hilfe ist nicht immer eindeutig feststellbar. Am Arlt-Institut haben wir begonnen, eine Datenbank mit Fallgeschichten anzulegen, eine Sammlung, die späterer Auswertung harrt. Systematische Fallstudien zu betreiben ist aufwändig und will finanziert werden. Von der Notwendigkeit, solche Studien zu betreiben, sind wir überzeugt“ (Pantucek und Maiss 2008).
4. „Mangels eines anerkannten geistigen Forums können sich Fehlmeinungen jahrzehntelang breitmachen, ohne widerlegt zu werden, oder Gesetze werden erlassen, deren Überprüfung nicht erst durch die Wirklichkeit hätte erfolgen müssen, sondern durch planmäßiges Studium.“
Noch immer entbehrt die Soziale Arbeit ein „anerkanntes geistiges Forum“. Laut Maiss und Pantucek (Pantucek und Maiss 2008) ergibt sich dies aus dem Umstand das Soziale Arbeit eine institutionsgebundene Profession sei. Noch deutlicher wird ihre Kritik in den folgenden Aussagen:
„Ihr fehlt eine Organisationsform, die Standards formulieren und durchsetzen könnte. Der Grad der Standardisierung ist beschämend gering. Zentrale Arbeitsformen der Sozialarbeit werden von verschiedenen AutorInnen verschieden benannt. Diagnostische Leistungen können nicht auf Basis anerkannter Standards erbracht werden, weil es die Standards nicht gibt, das Forum zur Festlegung der Standards ist noch ungegründet. Der internationale Vergleich ist aufgrund nicht nur unterschiedlicher Rechtssysteme, sondern auch aufgrund unterschiedlicher Begrifflichkeiten schwierig“(Pantucek und Maiss 2008).
Zusätzlich nennt sie noch weitere Mängel und Unzulänglichkeiten:
5. „Zum Unterschied von allen anderen Betätigungen fehlt das Urteil des Befürsorgten und muß meist fehlen. Die Funktion, die sonst von der Nachfrage geübt wird, unterbleibt."
6. „Mangels einer vom Gedeihen her orientierten und daher zielsicheren Beobachtung bleiben zahlreiche Notstände überhaupt oder dem Umfang nach unbemerkt. Selbst die täglichen Zeitungsmeldungen bleiben unausgewertet, vergehen mit dem Tag, statt zu Gruppen vereinigt, gesammelt zu werden.“
7. „Die meisten Schöpfungen der Fürsorge sind als Reaktion auf einen krassen oder plötzlich erkannten Notstand entstanden und behalten oft zu lange den Charakter der Improvisation bei.“
8. „Von der Menge der offensichtlichen Fürsorgevorkehrungen lässt sich nicht auf den Erfüllungsgrad der Hilfeverpflichtungen schließen.“
9. „Manche guten Ideen gehen verloren und tauchen später plötzlich wieder neu auf.“
Fazit
„Wenn kürzlich das Wort ´Museumsstück´ in bezug auf das literarische Werk Ilse Arlts fiel, so ist dies dahingehend zu interpretieren, dass man nicht Dinge in die Vitrine schließt und ins Museum stellt, weil sie alt und unbrauchbar geworden sind, sondern im Gegenteil, weil man sie bewahren will, weil sie uns noch immer viel zu sagen haben und wertvoll genug erscheinen, um für uns und die Nachwelt erhalten zu werden.“ (Lenz 1972:1)
Ilse von Arlt beweist sich als scharfsinnige Kritikerin der zu ihrer Zeit praktizierten Fürsorge. Ihre Forderungen zeugen von einer Weitsicht, die nach wie vor Probleme und Unzulänglichkeiten an heutige Soziale Arbeit adressieren. Ebenso überzeugt sie in ihren Überlegungen und Annahmen als herausragende Theoretikerin, indem sie Schritt für Schritt die Grundlagen der Fürsorge (Arlt 1921) und ihren geforderten Weg zu einer Fürsorgewissenschaft (Arlt 2010a) skizziert.
Die von ihr initiierte erste Fürsorgerinnenschule, die „Vereinigten Fachkurse für Volkspflege“, bestand insgesamt zwei Jahrzehnte und setzte neue Maßstäbe für die Ausbildung von Fürsorgetätigen.
Ilse Arlts reichhaltige Fürsorgetheorie mit ihren vielfältigen Anliegen und Forderungen bietet nach wie vor eine große „Schatzkiste“ an theoretischen und praktischen Anregungen und Verweisen, die mit Blick auf heutige interne Problematiken Sozialer Arbeit von herausragender Bedeutung sind. Dabei seien die Fragen in Bezug auf den aktuell geführten Professionsdiskurs genannt, in der der Disziplin Sozialer Arbeit der Vorwurf gemacht wird nicht eigenständig genug im Sinne von „Ermangelung an Selbstorganisation, an Definitionsmacht, an professionell kodifizierter Ethik, an gesicherten Methoden, an professioneller Expertise und an akademischem Wissen“ (Dewe und Stüwe 2016: 12). Damit verbunden ist auch die Problematik der Überprüfung der Wirksamkeit von sozialarbeiterischen Angeboten und Interventionen. Die Lektüre der Schriften und des Werks von Ilse Arlt könnten für die Lösung dieser genannten Problemstellungen fruchtbar und befruchtend genutzt werden. Ganz nach dem von ihr formulierten Satz: „Manche guten Ideen gehen verloren und tauchen später plötzlich wieder neu auf.“
Mit ihrer Forderung die Perspektive auf den Menschen in seiner Gesamtheit, einschließlich seiner Lebensumwelt, zu richten bzw. das Individuum in einem überindividuellen, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu erkennen und darüber hinaus die Relevanz sozialpolitischer Maßnahmen für das menschliche Gedeihen zu erfassen, greift sie heutigen Theorien Sozialer Arbeit weit vor. (Thiersch, Böhnisch)
Ihre Theorien werden auch für die heutige Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit herangezogen und produktiv verarbeitet. Beispielsweise eine Zusammenführung der Arbeiten Ilse Arlts und dem Befähigungsansatz (Capability Approach) von Martha Nussbaum und Amartya Sen (Hunhold 2010).
Anzumerken ist, dass die von ihr aufgestellten Grundbedürfnisse heute, auch aufgrund von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, um einige neue, zusätzliche Grundbedürfnisse erweitert werden könnten. Dies hat sie selbst auch schon erwähnt: „Die Zahl der Bedürfnisse sei hiermit zur Diskussion gestellt, jedoch keinesfalls im Sinne einer Verminderung; denn sie sind naturgegeben“ (Arlt 2010b: 63). Die von Ilse Arlt aufgestellten Grundbedürfnisse sind sehr stark auf die physische Dimension von menschlichem Gedeihens bezogen. Ergänzend könnten heute emotionale Bedürfnisse wie z.B. nach menschlicher Nähe, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zugehörigkeit und Partizipation sein.
Schließen möchte ich mit einem eindrücklichen Zitat das gleichzeitig als eine Forderung - wie Ilse Arlt selbst so viele formuliert hat - verstanden werden kann:
„Ilse Arlt gehört auf die Tagesordnung der Sozialen Arbeit“ (Hunold 2009: 244).
Literaturverzeichnis
Arlt, Ilse (1921): Die Grundlagen der Fürsorge. Wien: Schulbücherverlag.
Arlt, Ilse (2010a): Die Grundlagen der Fürsorge. Werkausgabe Ilse Arlt, Band 1. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Maria Maiss. Wien: LIT (Soziale Arbeit - Social Issues, 10).
Arlt, Ilse (Hg.) (2010b): Werkausgabe. Wien: LIT-Verl. (Soziale Arbeit, 4).
Engelke, Ernst; Borrmann, Stefan; Spatscheck, Christian (2009): Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 5., überarb. und erw. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Erlt, Ursula: Ilse Arlt - Studien zur Biografie der wenig bekannten Wissenschaftlerin und Begründerin der Fürsorgeausbildung in Österreich. Würzburg-Schweinfurt 1995
Frey, Cornelia (2005): "Respekt vor der Kreativität der Menschen" - Ilse Arlt: Werk und Wirkung. Opladen: Verlag Barbara Budrich (Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, 1). Online verfügbar unter http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-938094-54-9.
Hunold, Martin (2009): Wege zu einer Fürsorgewissenschaft: zum Werk von Ilse Arlt. In: Soz Passagen 1 (2), S. 241–249. DOI: 10.1007/s12592-009-0024-0.
Lambers, Helmut (2016): Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich. 3., überarbeitete Auflage. Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich (utb, 3775).
Pantucek, Peter; Maiss, Maria (2008): Theorie mit Leidenschaft. Ilse Arlt und aktuelle Fragen der Sozialen Arbeit. In: Soziale Arbeit - Zeitschrift für Soziale und sozialverwandte Gebiete (6), S. 202–211. Online verfügbar unter: http://www.pantucek.com/texte/200807arlt_sozialearbeit/arlt.html
Pantucek, Peter; Maiss, Maria (2009): Die Aktualität des Denkens von Ilse Arlt. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (VS research).
Staub-Bernasconi, Silvia: Ilse Arlt: Lebensfreude dank einer wissenschaftsbasierten Bedürfniskunde Aktualität und Brisanz einer fast vergessenen Theoretikerin. In: Die Geschichte der sozialen Arbeit in Europa - 1900 - 1960, Bd.2002, S. 25–33.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel und Abschnitte der Arbeit auf, darunter eine Einführung, einen biografischen Hintergrund zu Ilse von Arlt, eine Erläuterung ihrer Fürsorgetheorie (inklusive Fürsorge als angewandte Armutsforschung, Bedürfnisse als Ausgangspunkt, Ziele der Fürsorge und Kritik der Fürsorge), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Wer war Ilse von Arlt?
Ilse von Arlt (1876-1960) wird als eine der frühen Pionierinnen wissenschaftsgeleiteter Sozialer Arbeit betrachtet. Sie beschäftigte sich mit Armut und deren Behebung, mit dem Ziel die Fürsorge zu professionalisieren, basierend auf einer Wissenschaft der Armutsbedingungen.
Was war Ilse von Arlts Ansatz zur Armutsforschung?
Ilse von Arlt verfolgte einen Ansatz, über die menschlichen Bedürfnisse auf die notwendigen Bedingungen zur Behebung der Armut zu schließen. Sie entwickelte ein theoretisches Gerüst für die Armutsforschung basierend auf Feldforschungen und einer wissenschaftlichen, systematischen Vorgehensweise.
Welche Bedeutung haben Bedürfnisse in Ilse von Arlts Fürsorgetheorie?
Bedürfnisse bilden den Ausgangspunkt aller Fürsorge. Arlt argumentierte, dass die Fürsorge dort einsetzen muss, wo die Bedürfnisbefriedigung unter das menschliche Gedeihen notwendigen zurückbleibt. Die genaue Kenntnis dieser Bedürfnisse und ihrer Bedingungen ist die Basis für professionelles Handeln.
Welche Ziele verfolgte Ilse von Arlt mit der Fürsorgeausbildung?
Die Ausbildung sollte die Schülerinnen zur Erkennung von Ausnahmesituationen und zur Erforschung der Hilfe befähigen, indem sie die Faktoren kennenlernen, welche das menschliche Gedeihen fördern und hemmen. Ziel war es, die Schülerinnen zu befähigen die Hilfe stets unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Grundbedürfnisse volkswirtschaftlich richtig aufzubauen und bei der Durchführung Volksart und Volkssitte berücksichtigen.
Wie kritisierte Ilse von Arlt die Fürsorge?
Arlt kritisierte, dass jede Einrichtung unerwünschte Nebenwirkungen bewirkt, dass die Zahl der geholfenen Personen bekannt ist, nicht aber die der Übrigbleibenden. Sie kritisierte ausserdem, dass oftmals keine Leistungsbilanz erstellt wird und dass eine Gesamtschau für jedes Individuum fehlt. Es fehlte auch ein geistiges Forum, wodurch sich Fehlmeinungen ausbreiten können.
Welche Grundbedürfnisse werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt folgende Bedürfnisklassen: Ernährung, Wohnung, Körperpflege, Bekleidung, Erholung, Luft, Erziehung, Geistespflege, Rechtsschutz, Familienleben, Ärztliche Hilfe und Krankenpflege, Unfallverhütung und erste Hilfe, Ausbildung zur wirtschaftlichen Tüchtigkeit.
Was bedeutet "Grenznot" nach Ilse von Arlt?
„Grenznot“ verweist über den Einzelfall hinaus und kann mit dem Begriff der „relativen Armut“ gleichgesetzt werden: „Der Entwicklungsstand eines Volkes wird nicht nur durch seine Höchstleistungen bestimmt, sondern auch durch seine Grenznot. Das ist die tiefste geduldete Entbehrung“.
Was bedeutet der Begriff „Volkspflege“ im Kontext von Ilse von Arlts Arbeit?
„Volkspflege ist die Hilfsweise, die nach genauer Erfassung der Not die Hilfe stets unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller Grundbedürfnisse volkswirtschaftlich richtig aufbaut und bei der Durchführung Volksart und Volkssitte berücksichtigt.“ Es soll eine Hilfstätigkeit ausbilden, nicht wie sie war, sondern wie sie werden sollte.
- Quote paper
- Frederik Bogenrieder (Author), 2022, Auf dem Weg zur Professionalisierung nach Ilse von Arlt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215270