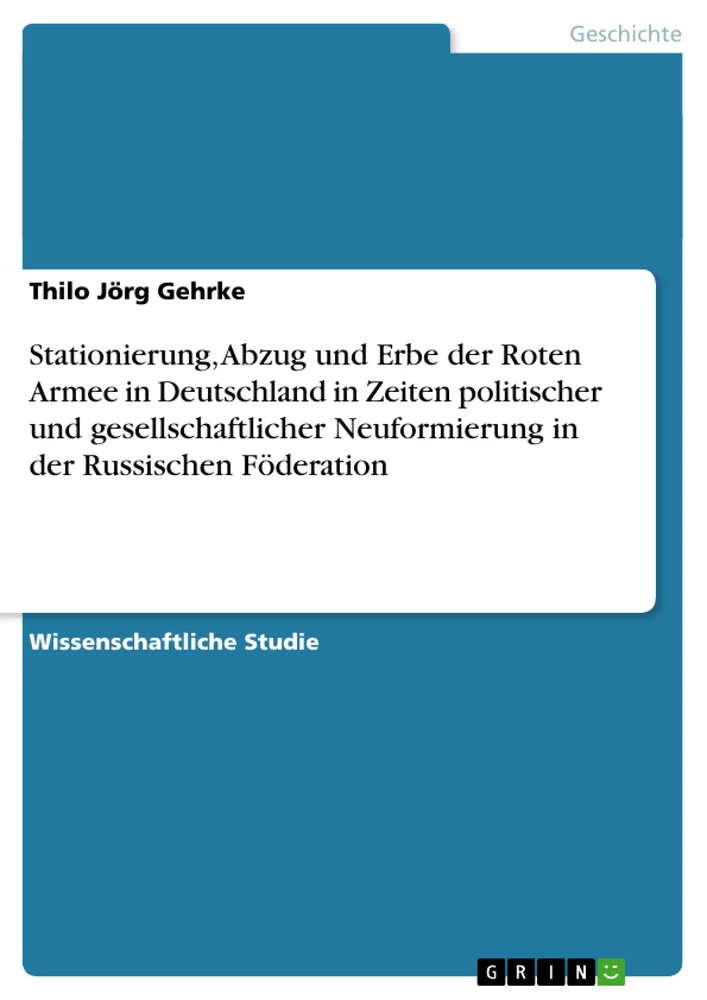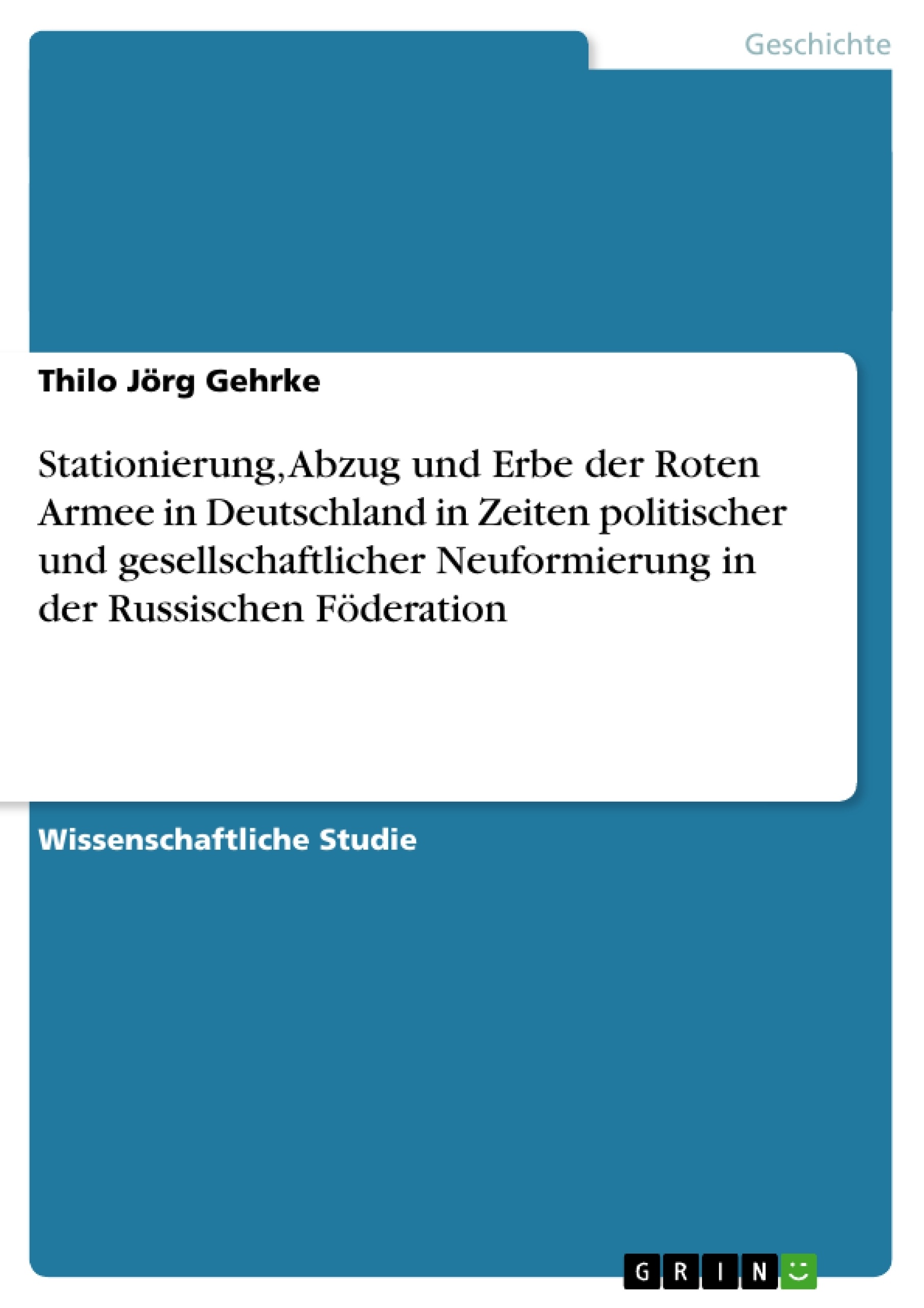Der in den Jahren 1991-1994 von der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland im 2+4-Vertrag zur Deutschen Einheit geforderte Abzug der Westgruppe der russischen Streitkräfte (WGT) aus Deutschland stellte mit über 500.000 Angehörigen und rund 3 Mio. Tonnen militärischem Material als größte Truppenverschiebung in Friedenszeiten in jeder Hinsicht eine logistische, soziale und ökologische Herausforderung dar, die bis heute in den Neuen Bundesländern nachwirkt. Die nachfolgenden Textauszüge mit ausgewählter Bilddokumentation dienen als Einführung in diese Thematik und basieren auf den persönlichen Erlebnissen des Autors während seiner nunmehr 20 Jährigen photographischen Recherche um einen gigantischen und historisch bislang einmaligen Konversionsprozess, dessen Interpretation von Deutscher und Russischer Seite sehr konträr war.1 Einblicke in den inneren Zustand der Armee im Kontext zu den ideologischen Vorgaben des Sowjetsysthems beziehen ihre Quellen aus der interdisziplinären Forschungsarbeit der Bild und Textdokumentation „Das Erbe der Sowjetarmee in Deutschland“ von Thilo Gehrke mit 146 Seiten Text und 150 Bildern, erschienen im November 2008 im Verlag Dr. Köster Berlin als Band 29, Beiträge für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
Inhaltsverzeichnis
- Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland
- Was bleibt - Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland
- Der innere Zustand der Armee
- Der Alltag der verordneten Freundschaft
- Das Rad der Geschichte
- Verlassene Kasernenstädte als Filmkulisse und Naturreservat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Abzug der Westgruppe der russischen Streitkräfte (WGT) aus Deutschland zwischen 1991 und 1994. Sie beleuchtet die logistischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen dieses Prozesses und die konträren Interpretationen der Ereignisse von deutscher und russischer Seite. Die Arbeit stützt sich auf die persönlichen Erfahrungen des Autors und die Forschungsarbeit von Thilo Gehrke.
- Logistische und ökologische Herausforderungen des Truppenabzugs
- Soziale Auswirkungen auf die betroffenen Soldaten und die deutsche Bevölkerung
- Konträre Interpretationen des Abzugs durch Deutschland und Russland
- Der innere Zustand der Roten Armee und die "Dedowschtschina"
- Der Alltag der sowjetischen Besatzungsmacht in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland als größte Truppenverlagerung in Friedenszeiten. Es hebt die logistischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen hervor und deutet auf die unterschiedlichen Perspektiven der deutschen und russischen Seite hin, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft werden.
Was bleibt - Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland: Dieses Kapitel schildert anhand persönlicher Anekdoten des Autors die Situation in und um sowjetische Kasernen in der ehemaligen DDR kurz nach der Wiedervereinigung. Es zeigt die teils schwierigen Begegnungen zwischen deutschen Zivilisten und sowjetischen Soldaten und gibt einen ersten Eindruck von dem Zustand der verlassenen militärischen Anlagen. Die Verhaftung des Autors und seines Freundes auf einem Panzerübungsplatz illustriert die anhaltende militärische Präsenz und die Spannungen zwischen beiden Seiten. Die Beschreibung der Begegnung mit den Soldaten offenbart ihren Alltag und die strenge Hierarchie innerhalb der Armee.
Der innere Zustand der Armee: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensbedingungen der sowjetischen Soldaten, gekennzeichnet durch psychische und physische Gewalt, "Dedowschtschina" (Schikanen durch ältere Soldaten), ethnische Konflikte und strenge Disziplin. Die Beispiele von isolierten Soldaten während Manövers und die drastischen Strafen für Desertion unterstreichen die Härte des Militäralltags und die geringe Wertschätzung des menschlichen Lebens innerhalb des Systems. Die mangelnde Kenntnis der russischen Sprache bei vielen Soldaten verdeutlicht die kulturelle Vielfalt und die Herausforderungen der Integration innerhalb der Armee.
Der Alltag der verordneten Freundschaft: Dieses Kapitel analysiert die offiziellen Bemühungen um eine Deutsch-Sowjetische Freundschaft während der DDR-Zeit, die sich jedoch im realen Leben als stark limitiert und ideologisch geprägt erweist. Der beschränkte und kontrollierte Kontakt zwischen russischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung, organisiert durch die DSF, wird dargestellt. Die Ghettoisierung und Selbst-Isolation der russischen Besatzungsmacht und deren Familien werden als Faktoren für die fehlende Integration hervorgehoben.
Das Rad der Geschichte: Dieses Kapitel beschreibt den Truppenabzug als Bestandteil des Einigungsvertrages und die damit verbundenen finanziellen Zahlungen Deutschlands an Russland. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Wohnungsbauprojekte in den ehemaligen Sowjetrepubliken aufgrund des Zerfalls der UdSSR werden thematisiert. Der Kapitel beschreibt die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung durch die Bundesregierung trotz der politischen Instabilität in Russland und den erfolgreichen, friedlichen Abschluss des Truppenabzugs im Gegensatz zu früheren Aufständen gegen das Sowjetsystem.
Verlassene Kasernenstädte als Filmkulisse und Naturreservat: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen des Abzugs für die heimkehrenden Soldaten, die oft in schlechten Bedingungen in der Heimat ankamen, und dem Zustand der verlassenen Kasernen. Die teilweise plötzliche und unvollständige Räumung der Kasernen wird als Zeichen des chaotischen und schnellen Abzugs interpretiert.
Schlüsselwörter
Rote Armee, Truppenabzug, Deutschland, Sowjetunion, DDR, Wiedervereinigung, Dedowschtschina, logistische Herausforderungen, soziale Auswirkungen, ökologische Folgen, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Konversionsprozess.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Abzug der Westgruppe der russischen Streitkräfte (WGT) aus Deutschland zwischen 1991 und 1994. Sie beleuchtet die logistischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen dieses Prozesses und die konträren Interpretationen der Ereignisse von deutscher und russischer Seite. Die Arbeit stützt sich auf persönliche Erfahrungen des Autors und die Forschungsarbeit von Thilo Gehrke.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die logistischen und ökologischen Herausforderungen des Truppenabzugs, die sozialen Auswirkungen auf betroffene Soldaten und die deutsche Bevölkerung, konträre Interpretationen des Abzugs durch Deutschland und Russland, den inneren Zustand der Roten Armee inklusive der "Dedowschtschina", sowie den Alltag der sowjetischen Besatzungsmacht in der DDR.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: der Stationierung, dem Abzug und dem Erbe der Roten Armee in Deutschland (einschließlich logistischer, sozialer und ökologischer Herausforderungen und unterschiedlicher Perspektiven); persönlichen Erfahrungen des Autors in und um sowjetische Kasernen nach der Wiedervereinigung; dem inneren Zustand der Roten Armee (Dedowschtschina, ethnische Konflikte, etc.); dem Alltag der "verordneten Freundschaft" zwischen deutschen Zivilisten und sowjetischen Soldaten; dem Truppenabzug im Kontext des Einigungsvertrags und der finanziellen Absprachen; und schließlich den verlassenen Kasernenstädten als Filmkulisse und Naturreservaten.
Welche Herausforderungen werden beim Truppenabzug besonders hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die logistischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen des Truppenabzugs hervor. Logistisch waren die schiere Größe der Truppenverlagerung und die damit verbundenen Transportprobleme bedeutend. Sozial betrafen die Herausforderungen die Soldaten selbst (Dedowschtschina, schlechte Lebensbedingungen) und die Beziehungen zwischen deutschen und russischen Zivilbevölkerung. Ökologisch ging es um die Folgen der militärischen Nutzung für die Umwelt.
Wie wird der innere Zustand der Roten Armee beschrieben?
Der innere Zustand der Roten Armee wird als von psychischer und physischer Gewalt ("Dedowschtschina"), ethnischen Konflikten und strenger Disziplin geprägt beschrieben. Die Beispiele von isolierten Soldaten und drastischen Strafen für Desertion illustrieren die Härte des Militäralltags und die geringe Wertschätzung des menschlichen Lebens.
Welche Rolle spielte die "Dedowschtschina"?
Die "Dedowschtschina", also die Schikanen älterer Soldaten gegenüber jüngeren Rekruten, wird als ein zentrales Merkmal des harten Alltags in der Roten Armee hervorgehoben und als ein wichtiger Faktor für die schwierigen Lebensbedingungen der Soldaten dargestellt.
Wie wird der Alltag der "verordneten Freundschaft" zwischen Deutschen und Sowjets dargestellt?
Der Alltag der "verordneten Freundschaft" wird als stark limitiert und ideologisch geprägt beschrieben. Der Kontakt zwischen russischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung war beschränkt und kontrolliert, was zur Ghettoisierung und Selbst-Isolation der russischen Besatzungsmacht beitrug.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeichnet ein Bild des Truppenabzugs als eines komplexen Prozesses mit vielfältigen logistischen, sozialen und ökologischen Folgen. Sie betont die unterschiedlichen Perspektiven deutscher und russischer Seite und die Herausforderungen des friedlichen Übergangs nach dem Ende des Kalten Krieges. Der erfolgreiche und friedliche Abschluss des Abzugs trotz der inneren Herausforderungen der Roten Armee und der politischen Instabilität in Russland wird als bemerkenswert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rote Armee, Truppenabzug, Deutschland, Sowjetunion, DDR, Wiedervereinigung, Dedowschtschina, logistische Herausforderungen, soziale Auswirkungen, ökologische Folgen, Deutsch-Sowjetische Freundschaft, Konversionsprozess.
- Quote paper
- Thilo Jörg Gehrke (Author), 2009, Stationierung, Abzug und Erbe der Roten Armee in Deutschland in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Neuformierung in der Russischen Föderation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121520