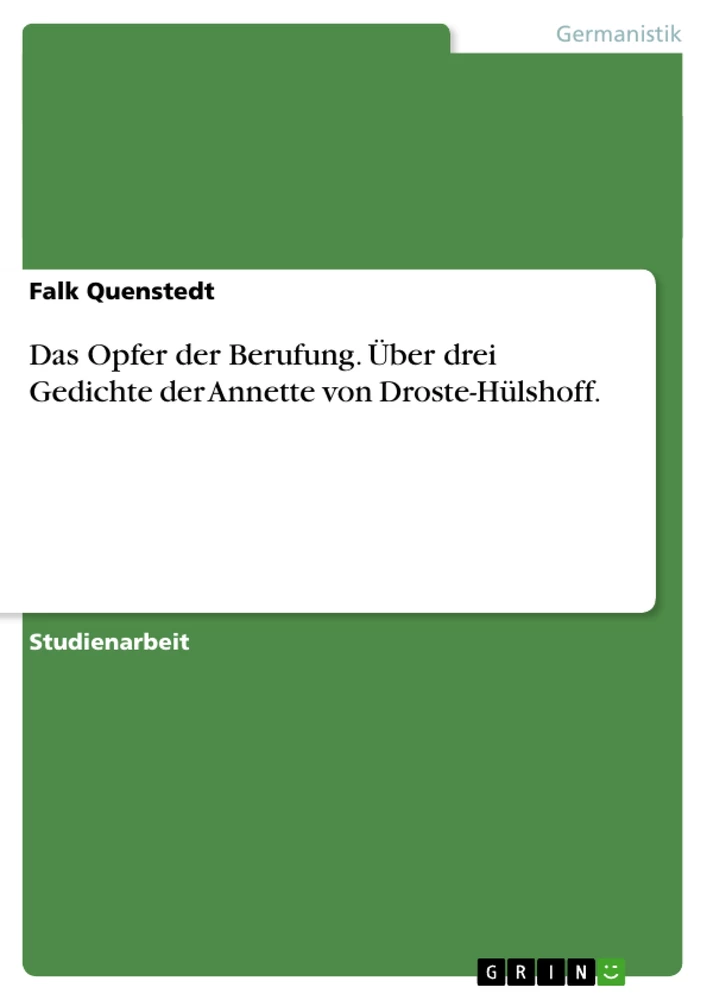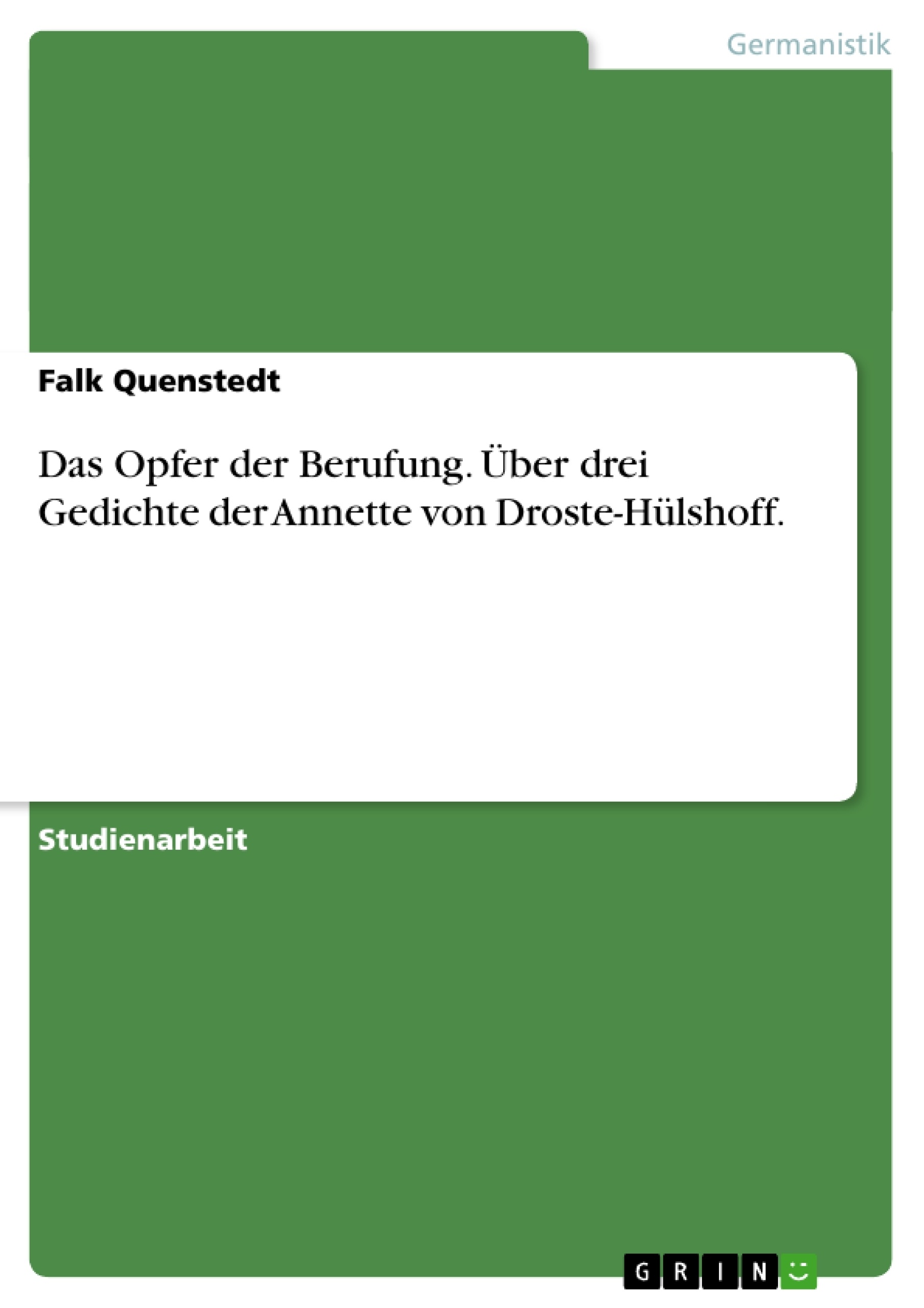Diese Arbeit soll den Versuch machen bisher weitestgehend unabhängig voneinander behandelte Gedichte der Droste parallel zu lesen. Damit wird jenen eine innere Zusammengehörigkeit unterstellt, die schließlich auch aufgefunden werden konnte, doch entzieht sich die Argumentation dem Vorwurf des Zirkelschlusses nicht gänzlich. Hauptsächliches Ziel war es der „Geheimnisebene“1 Raum zu schaffen. Wie Peter von Matt sagt „[...]fordert [diese Dichtung] alle Lesekunst und –erfahrung, gerade weil sie so konventionell daher kommt.“2 Um diese Anforderung, zumindest im Kleinen, zu erfüllen, wurden manche Spitzfindigkeiten nicht nur geduldet sondern sogar gesucht. Mit der Hoffnung einer allen untersuchten Gedichten zugrunde liegenden Intention gerecht werden zu können. Der untersuchte Corpus ist daher absichtlich klein gehalten worden, damit das je Besondere in den Focus gerückt werden konnte. Oft verbirgt sich nämlich gerade hier, im Detail, das Allgemeine.
Zuerst werden das so genannte Dichtergedicht „Mein Beruf“3 und das Gedicht „Das Spiegelbild“4 gelesen. Deren Interpretation entscheidende Aspekte zum Verständnis des zweiten Teils von „Der Dichter – Dichters Glück“5 (oft auch als eigenständiges Fragment „Locke nicht du Strahl aus der Höh“ betrachtet) beitragen kann. Hier wird deutlich, dass die göttliche Berufung zur Dichtung leidvolle Auswirkungen auf die Dichterin selbst hat. Sie wird zum Opfer. Zum einen gibt sie sich dabei selbst her. Sie opfert sich. Zum anderen wird sie geopfert, indem Gott sie beruft. Die Dichterexistenz, wie sie die Droste versteht, ist daher, im vollen Sinne des Wortes, tragisch zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MACHT UND AUFGABE DER DICHTUNG
- DAS GESPALTENE ICH
- DIE FOLGEN DER BERUFUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- PRIMÄRLITERATUR
- SEKUNDÄRLITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht drei Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff: „Mein Beruf“, „Das Spiegelbild“ und „Der Dichter Dichters Glück“. Die Analyse zielt darauf ab, eine innere Zusammengehörigkeit dieser Gedichte aufzuzeigen und die Auswirkungen der dichterischen Berufung auf die Dichterin selbst zu beleuchten.
- Die Rolle der Dichtung als Beruf und Aufgabe
- Die Ambivalenz der dichterischen Berufung und ihre Folgen für das Ich
- Das Opfer der Dichterin für die Kunst
- Die Legitimation des dichterischen Sprechens
- Die Verbindung zwischen göttlicher Inspiration und menschlicher Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die These der Arbeit vor, die drei Gedichte der Droste als zusammengehörig zu betrachten, und beschreibt die Motivation und das Ziel der Analyse. Die Arbeit soll dem „Geheimnisebene“ der Gedichte Raum schaffen.
- Macht und Aufgabe der Dichtung: Dieses Kapitel untersucht das Gedicht „Mein Beruf“ und beleuchtet die programmatische Bedeutung, die Droste ihm zuschrieb. Die Autorin verteidigt hier das Recht zur Dichtung und argumentiert, dass es ihr von Gott verliehen wurde. Die Legitimation des dichterischen Sprechens steht im Vordergrund dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Annette von Droste-Hülshoff, Dichtung, Berufung, Opfer, Dichtergedicht, Legitimation, göttliche Inspiration, Tragik, „Mein Beruf“, „Das Spiegelbild“, „Der Dichter Dichters Glück“
- Quote paper
- Falk Quenstedt (Author), 2002, Das Opfer der Berufung. Über drei Gedichte der Annette von Droste-Hülshoff., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12146