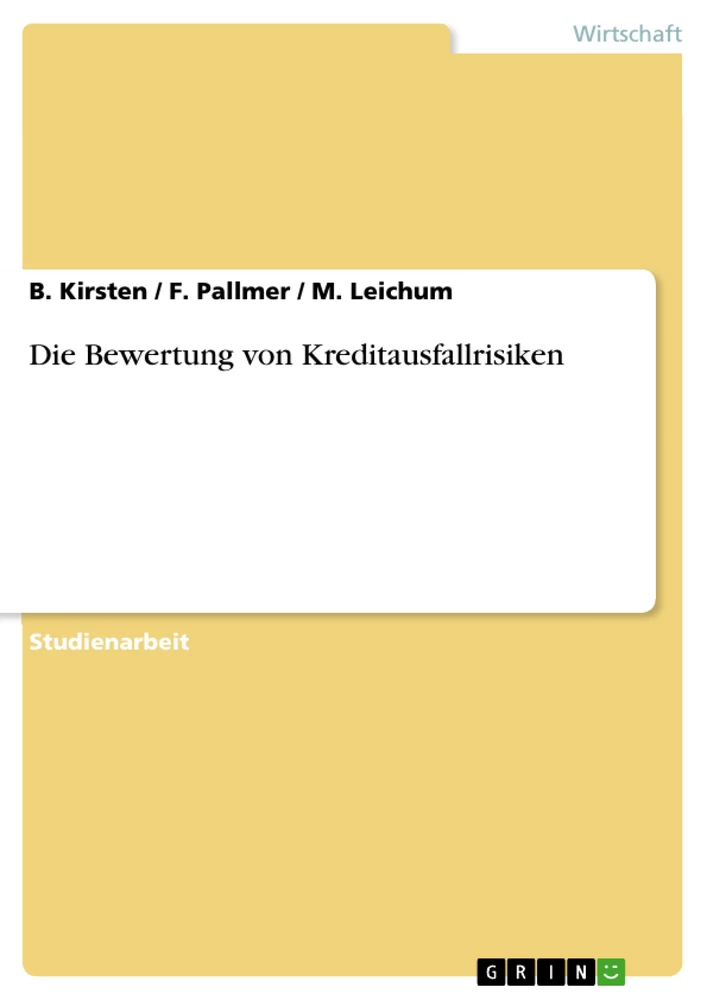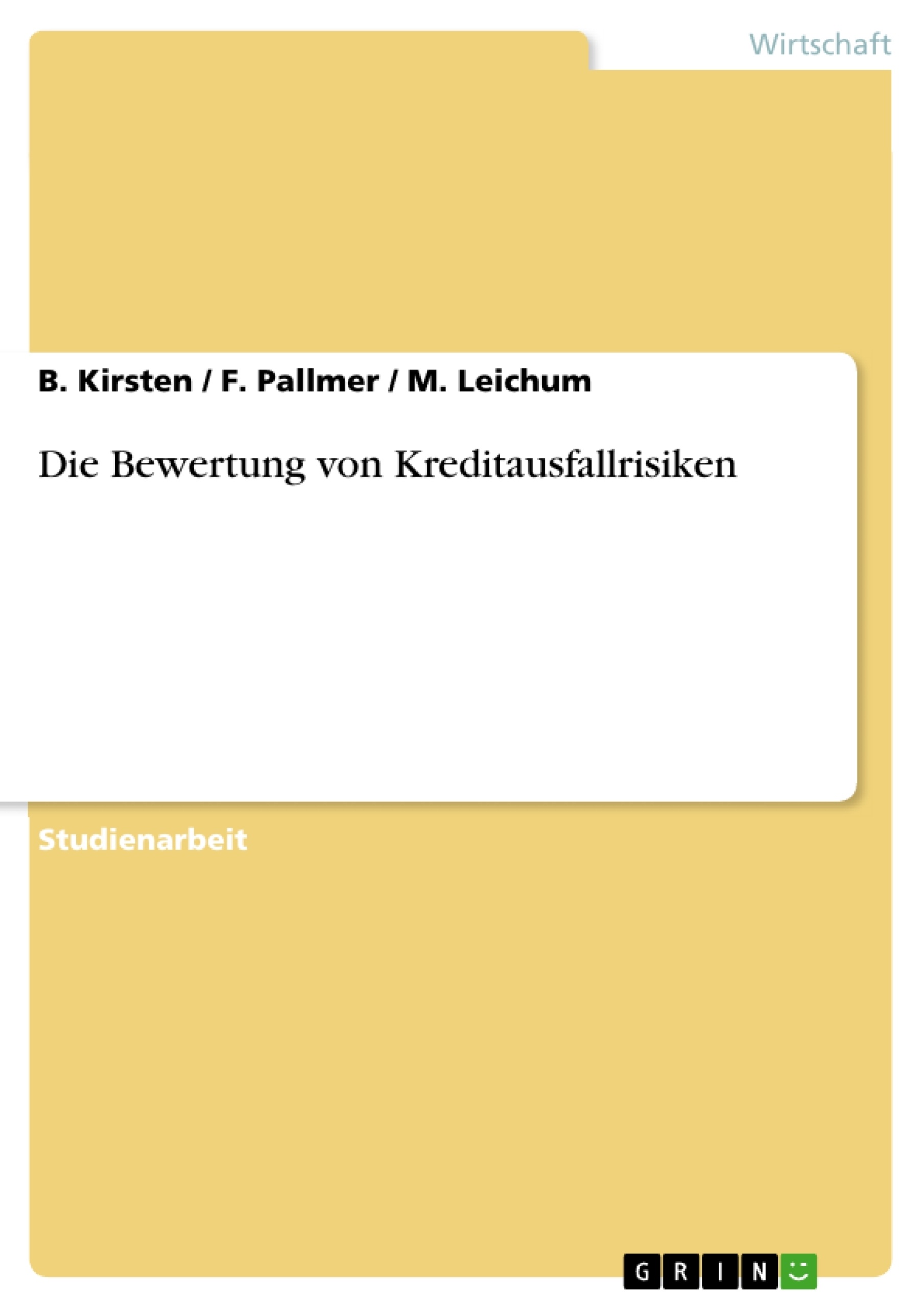So wie die Bankenkrise in Japan Auswirkungen auf aufsichtsrechtliche Fragen hatte, wird wohl auch die aktuell in der Tagespresse genannte „Subprime-Krise“ (Hypothekenkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika) das Streben nach einem effizienteren Risikomanagement begünstigen. Vor allem die mit den modernen Geschäften von Kreditrisikoderivaten entstandenen und entstehenden Unwägbarkeiten haben den Ruf nach einem effizienten Kreditrisikomanagement lauter werden lassen. Kreditderivate werden häufig zur Absicherung von Kreditrisiken eingesetzt und besitzen Auszahlungsprofile, die die potentiellen Ausfallereignisse bestehender Forderungen beschreiben. Deshalb ist für diese Arbeit die Bewertung von Kreditderivaten genauso grundlegend wie die Bewertung von Kreditrisiken selbst.
In der vorliegenden Arbeit werden, nachdem in Kapitel 2 die zugehörigen Rahmenbedingungen betrachtet wurden, zwei Basismodelle beschrieben, wobei lediglich auf wichtige Erweiterungen dieser eingegangen wird. So wird zunächst in Kapitel 3 das ältere, aber immer noch aktuelle Merton-Modell beschrieben, ebenso wie wichtige Erweiterungen dieses Verfahrens. Diese Verfahren sind notwendig, um Schwächen des Basismodells zu reduzieren, bzw. das Merton-Modell auf praxisnahe Probleme anwenden zu können. Anschließend wird in Kapitel 4 das zweite Basismodell vorgestellt und es werden ebenfalls entscheidende Erweiterungen beschrieben. Ein anschließender Vergleich in Kapitel 5 betrachtet die Vor- und Nachteile der Modelle hinsichtlich ihrer theoretischen Ausgangslage und bewertet die Verfahren aufgrund empirischer Untersuchungen. Die Schlussbetrachtung (Kapitel 6) wagt abschließend einen Zukunftsblick.
Inhaltsverzeichnis
- Aktueller Kontext
- Rahmenbedingungen der Kreditbewertung
- Strukturelle Modelle
- Black-Scholes-Merton-Modell
- Credit Spread
- Modellerweiterungen
- Spezielle Optionsformen
- Berücksichtigung des Zinsniveaus
- Kommerzielle Modelle
- Reduktionsmodelle - Intensitätsmodelle
- Grundlagen zu Reduktionsmodellen
- Einführendes Beispiel
- Theoretische Modellierung der Reduktionsmodelle
- Modelle im Überblick
- Modellierung der Wiedergewinnungsquote
- Kommerzielle Modelle
- Vergleich beider Modelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch behandelt die Bewertung von Kreditausfallrisiken und stellt zwei gängige Modellierungsansätze vor: Strukturelle Modelle und Reduktionsmodelle. Es befasst sich mit den theoretischen Grundlagen beider Ansätze und erläutert deren Anwendungen in der Praxis. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Bewertung von Kreditausfallrisiken zu vermitteln und die wichtigsten Aspekte beider Modellierungsansätze aufzuzeigen.
- Bewertung von Kreditausfallrisiken
- Strukturelle Modelle (Black-Scholes-Merton-Modell, Credit Spread)
- Reduktionsmodelle (Intensitätsmodelle)
- Vergleich beider Ansätze
- Praktische Anwendung in der Finanzindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Aktueller Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Kontext der Kreditbewertung und die Bedeutung der Risikobewertung in der heutigen Finanzwelt. Es werden die wichtigsten Treiber von Kreditausfallrisiken und die Herausforderungen der Bewertung in einem komplexen und dynamischen Umfeld erläutert.
- Kapitel 2: Rahmenbedingungen der Kreditbewertung: Kapitel 2 legt den Grundstein für die Kreditbewertung. Es definiert die wichtigsten Begriffe und Konzepte, die im weiteren Verlauf des Buches verwendet werden. Darüber hinaus werden die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Kreditbewertung vorgestellt.
- Kapitel 3: Strukturelle Modelle: Dieses Kapitel widmet sich den strukturellen Modellen der Kreditbewertung. Es stellt das Black-Scholes-Merton-Modell als ein grundlegendes Modell vor und erklärt den Begriff des Credit Spreads. Zudem werden Erweiterungen des Grundmodells, wie z. B. spezielle Optionsformen und die Berücksichtigung des Zinsniveaus, behandelt.
- Kapitel 4: Reduktionsmodelle - Intensitätsmodelle: Kapitel 4 fokussiert auf die Reduktionsmodelle, auch bekannt als Intensitätsmodelle. Es erläutert die Grundlagen dieser Modelle, zeigt ein einführendes Beispiel auf und führt in die theoretische Modellierung ein. Darüber hinaus werden verschiedene Modelle im Überblick dargestellt und die Modellierung der Wiedergewinnungsquote behandelt.
Schlüsselwörter
Kreditausfallrisiken, Strukturelle Modelle, Reduktionsmodelle, Black-Scholes-Merton-Modell, Credit Spread, Intensitätsmodelle, Wiedergewinnungsquote, Finanzindustrie, Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was sind strukturelle Modelle zur Bewertung von Kreditrisiken?
Strukturelle Modelle, wie das Merton-Modell, nutzen den Unternehmenswert und die Verschuldungsstruktur, um die Ausfallwahrscheinlichkeit als Option zu modellieren.
Was versteht man unter Reduktionsmodellen (Intensitätsmodellen)?
Diese Modelle betrachten den Ausfallzeitpunkt als ein exogenes, stochastisches Ereignis (Sprungprozess), ohne den Unternehmenswert direkt zu modellieren.
Welche Rolle spielt der "Credit Spread"?
Der Credit Spread ist der Risikoaufschlag auf den risikolosen Zins und spiegelt die Markterwartung hinsichtlich des Kreditausfallrisikos wider.
Warum ist das Merton-Modell heute noch relevant?
Obwohl es alt ist, bildet es die theoretische Basis für viele kommerzielle Modelle und wird durch Erweiterungen (z.B. Zinsberücksichtigung) praxistauglich gemacht.
Was ist die Wiedergewinnungsquote (Recovery Rate)?
Sie gibt an, welcher Prozentsatz der Forderung im Falle eines tatsächlichen Ausfalls voraussichtlich noch zurückgezahlt werden kann.
- Quote paper
- B. Kirsten (Author), F. Pallmer (Author), M. Leichum (Author), 2008, Die Bewertung von Kreditausfallrisiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121450