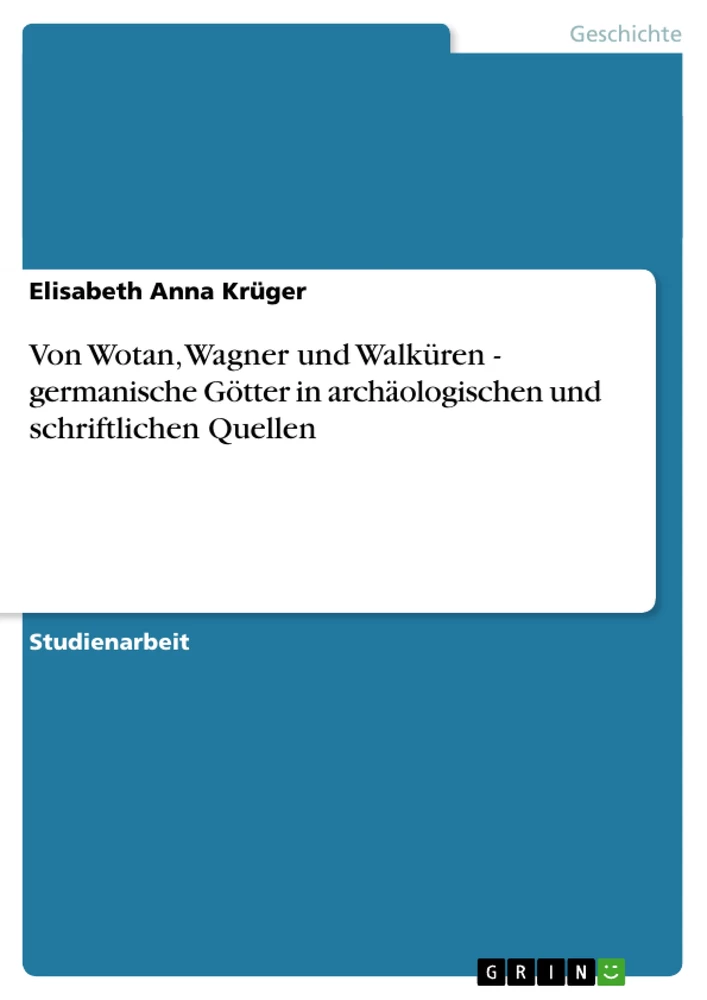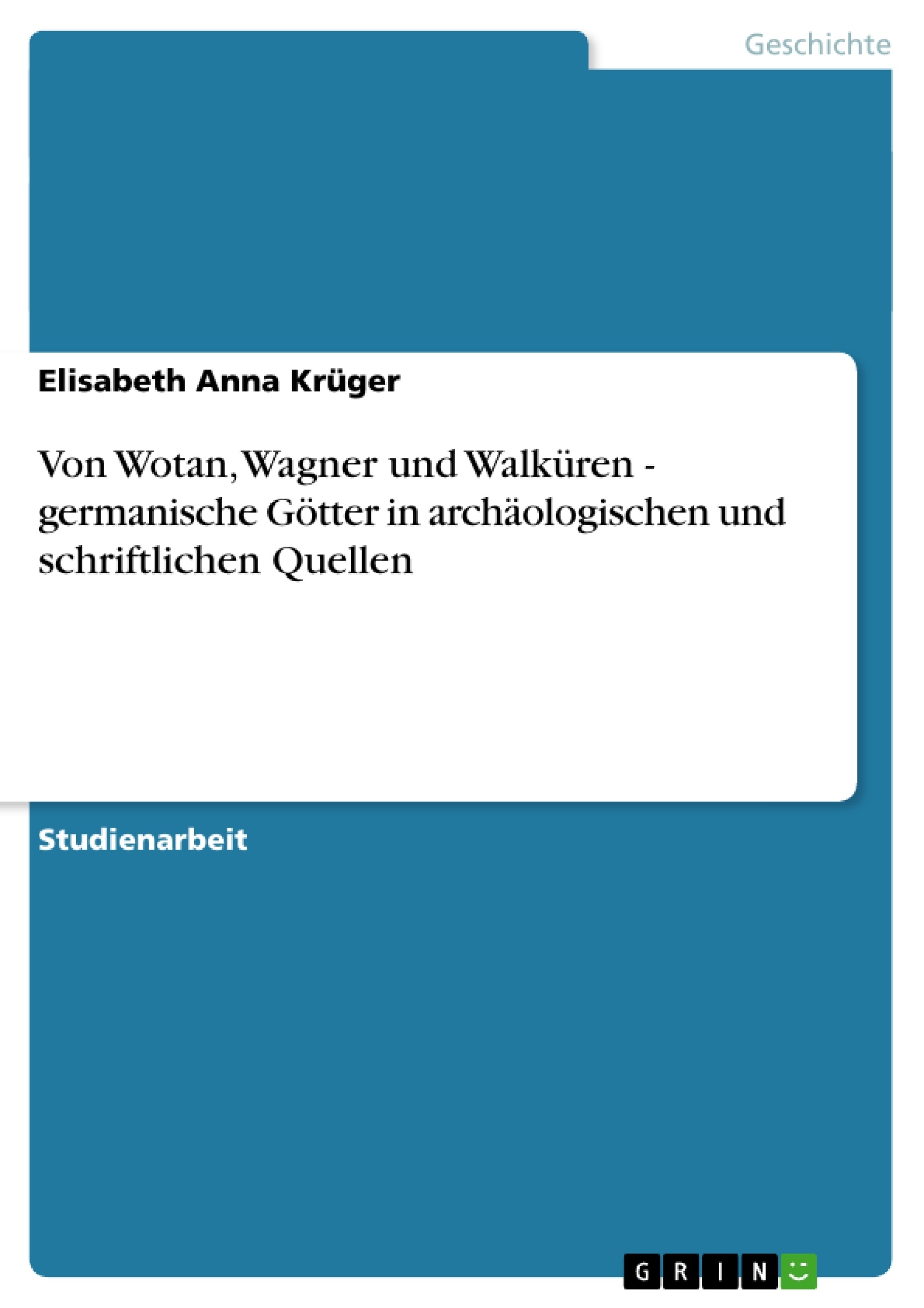Dank Richard Wagner und seinem Nibelungen – Zyklus weiß heute jeder, wie man sich eine Walküre oder den nordischen Gott Odin vorzustellen hat. Hünenhafte Gestalten mit überdimensionalen Flügelhelmen geistern noch immer durch die Köpfe des Lesers, wenn er sich den Abenteuern des Recken Siegfried widmet oder den Donnergott Thor auf seinen Reisen zu den Riesen begleitet. Diese Vorstellungen sind jedoch mehr auf die romantischen Visionen des 19. Jahrhunderts zurück zu führen , deren Mittelpunkt sicherlich die Werke Wagners darstellen, wie auch der begleitende Bilderzyklus des Briten Arthur Rackham1 (Abb.1); als auf die wirkliche religiöse Welt der germanischen Stämme. Viele Götter und Göttinnen kennen wir nur noch vom Namen her, andere wiederum sind vollkommen in Vergessenheit geraten und nur wenige haben bis in heutige Zeit „überlebt“, was vor allem den Sagas und Eddadichtungen des Mittelalters zu verdanken ist, die sich jedoch vor allem auf die wikingischen Mythen beziehen.
Die Vielzahl, ab der Zeitwende als germanisch bezeichneten Stämme hing polytheistischen Kulten an, welche sich jedoch von Stamm zu Stamm und von Jahrhundert zu Jahrhundert nicht unwesentlich voneinander unterschieden. Ein weiterer Faktor, der verdeutlicht, dass weder die Germanen noch die germanischen Götter als geschlossene Einheit zu sehen sind. Spricht man jedoch vom germanischen Glauben, so darf neben der paganen Religion nicht das Christentum vergessen, denn bereits im beginnenden 4. Jahrhundert traten beispielsweise die Goten zum Arianismus über, gefolgt von den Vandalen und Langobarden in späterer Zeit und der Christianisierung der nordgermanischen Wikingern im Mittelalter.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll jedoch weder das arianische Christentum, noch der Synkretismus der Wikingerzeit sein, sondern der germanische Polytheismus, der als nicht- kodifizierte Religion nur durch archäologische Funde und wenigstens bis zur Karolingerzeit nur durch externe schriftliche Zeugnisse zu belegen ist; deshalb und aufgrund der räumlichen, wie auch zeitlichen Ausdehnung sind die nicht unbeträchtlichen Abweichungen in den verschiedenen Quellen verständlich, die sich vor allen aus dem archäologischen, schriftlichen, sprachlichen, volkskundlichen und ikonographischen Material zusammensetzen und hier teilweise näher untersucht werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Archäologische Quellen
- 1.1. Matronenverehrung
- 1.2. Heilige Orte, Hallen und Haine
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den germanischen Polytheismus vor der Christianisierung. Sie konzentriert sich auf die Rekonstruktion des Glaubens anhand archäologischer Funde und schriftlicher Quellen, wobei die Herausforderungen durch die räumliche und zeitliche Ausdehnung des germanischen Kulturraums berücksichtigt werden. Die Arbeit analysiert die Vielfältigkeit des Glaubens und die Unterschiede zwischen den Stämmen.
- Archäologische Funde als Quelle für religiöse Praktiken
- Die Rolle von Gräbern und Grabbeigaben im Verständnis des germanischen Jenseits
- Analyse der Matronenverehrung und ihrer Bedeutung
- Heilige Orte und ihre Funktion im germanischen Glauben
- Der Vergleich von archäologischen und schriftlichen Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Archäologische Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Rolle archäologischer Funde, insbesondere Gräber, bei der Rekonstruktion des germanischen Glaubens. Schiffsgräber der Vendelzeit deuten auf Vorstellungen vom Jenseits und die Bedeutung von sozialen Status hin, reich ausgestattete Gräber zeigen die Überzeugung eines Weiterlebens nach dem Tod. Hallenbauten, Opfermoore (wie Thorsberg und Oberdorla) und Weihesteine der Matronenverehrung liefern weitere Hinweise auf religiöse Praktiken. Die Interpretation der Funde wird durch die Berücksichtigung der räumlichen und zeitlichen Unterschiede innerhalb des germanischen Kulturraums erschwert, aber ermöglicht dennoch eine Annäherung an die religiösen Vorstellungen der Germanen.
1.1. Matronenverehrung: Die Matronenverehrung, belegt durch steinerne Denkmäler vor allem am Neckar und Niederrhein, bietet Einblicke in die Verehrung weiblicher Gottheiten. Die Weihesteine nennen die Namen der Göttinnen, der Stifter und geben oft den Grund der Anrufung an. Die meist dreifache Darstellung der Göttinnen, häufig mit Fruchtbarkeitssymbolen, deutet auf ihre Rolle im familiären Kontext hin. Die Matronenverehrung zeigt eine Verschmelzung germanischer, römischer und keltischer Elemente und stellt eine einzigartige Quelle für die vorchristliche Religionsgeschichte dar. Die Göttinnennamen, oft verbunden mit Gewässern, lassen auf ihren Ursprung als Quellgottheiten schließen. Parallelen zu den römischen Parcae und den germanischen Nornen werden gezogen.
1.2. Heilige Orte, Hallen und Haine: Dieses Kapitel behandelt heilige Orte der Germanen, die sich im Gegensatz zu römischen Tempeln oft in der Natur befanden. Tacitus erwähnt die Verehrung der Götter im Freien. Neben den Matronensteinen gibt es nur wenige Hinweise auf Tempelbauten. Hallenbauten, wie in Köln, dienten sowohl religiösen als auch politischen Zwecken. Gamla Uppsala in Schweden wird als bedeutendes politisches und religiöses Zentrum der Ynglinger-Dynastie beschrieben, wobei die Berichte von Adam von Bremen kritisch betrachtet werden. Die Funde deuten auf einen Hallenbau anstelle eines Tempels hin. Die Verbindung von Gamla Uppsala mit dem vanischen Gott Freyr und der Ynglinger-Dynastie wird untersucht.
Schlüsselwörter
Germanischer Polytheismus, Archäologie, Religion, Matronenverehrung, Heilige Orte, Gräber, Grabbeigaben, Schiffsgräber, heidnische Kulte, schriftliche Quellen, Tacitus, Gamla Uppsala, Ynglinger-Dynastie.
FAQ: Germanischer Polytheismus vor der Christianisierung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den germanischen Polytheismus vor der Christianisierung. Sie rekonstruiert den Glauben anhand archäologischer Funde und schriftlicher Quellen, wobei die Herausforderungen durch die räumliche und zeitliche Ausdehnung des germanischen Kulturraums berücksichtigt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Vielfältigkeit des Glaubens und der Unterschiede zwischen den Stämmen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf archäologische Funde (Gräber, Grabbeigaben, Schiffsgräber, Hallenbauten, Opfermoore, Weihesteine) und schriftliche Quellen (z.B. Tacitus, Adam von Bremen). Der Vergleich beider Quellenarten spielt eine wichtige Rolle.
Welche Rolle spielen archäologische Funde?
Archäologische Funde, insbesondere Gräber und Grabbeigaben, liefern zentrale Informationen über religiöse Praktiken und Vorstellungen vom Jenseits. Die Ausgestaltung der Gräber spiegelt den sozialen Status wider und gibt Aufschluss über die Überzeugung eines Weiterlebens nach dem Tod. Hallenbauten und Opfermoore bieten weitere Hinweise auf kultische Handlungen.
Was ist über die Matronenverehrung bekannt?
Die Matronenverehrung, belegt durch steinerne Denkmäler, vor allem am Neckar und Niederrhein, zeigt die Verehrung weiblicher Gottheiten. Die Weihesteine nennen die Göttinnennamen und geben oft den Grund der Anrufung an. Die meist dreifache Darstellung der Göttinnen, häufig mit Fruchtbarkeitssymbolen, deutet auf ihre Rolle im familiären Kontext hin. Die Verehrung zeigt eine Verschmelzung germanischer, römischer und keltischer Elemente.
Welche Bedeutung haben heilige Orte?
Heilige Orte der Germanen befanden sich oft in der Natur, im Gegensatz zu römischen Tempeln. Neben den Matronensteinen gibt es nur wenige Hinweise auf Tempelbauten. Hallenbauten dienten sowohl religiösen als auch politischen Zwecken. Gamla Uppsala wird als bedeutendes politisches und religiöses Zentrum beschrieben, wobei die Berichte von Adam von Bremen kritisch betrachtet werden.
Wie wird Gamla Uppsala in der Arbeit behandelt?
Gamla Uppsala wird als bedeutendes politisches und religiöses Zentrum der Ynglinger-Dynastie beschrieben. Die Arbeit untersucht die Verbindung von Gamla Uppsala mit dem vanischen Gott Freyr und der Ynglinger-Dynastie, wobei die Berichte von Adam von Bremen kritisch hinterfragt werden. Die Funde deuten auf einen Hallenbau anstelle eines Tempels hin.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel "Archäologische Quellen", "Matronenverehrung" und "Heilige Orte, Hallen und Haine".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Germanischer Polytheismus, Archäologie, Religion, Matronenverehrung, Heilige Orte, Gräber, Grabbeigaben, Schiffsgräber, heidnische Kulte, schriftliche Quellen, Tacitus, Gamla Uppsala, Ynglinger-Dynastie.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit adressiert?
Die Arbeit adressiert die Herausforderungen, die sich aus der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung des germanischen Kulturraums ergeben, bei der Rekonstruktion des germanischen Glaubens.
- Quote paper
- Elisabeth Anna Krüger (Author), 2007, Von Wotan, Wagner und Walküren - germanische Götter in archäologischen und schriftlichen Quellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121356