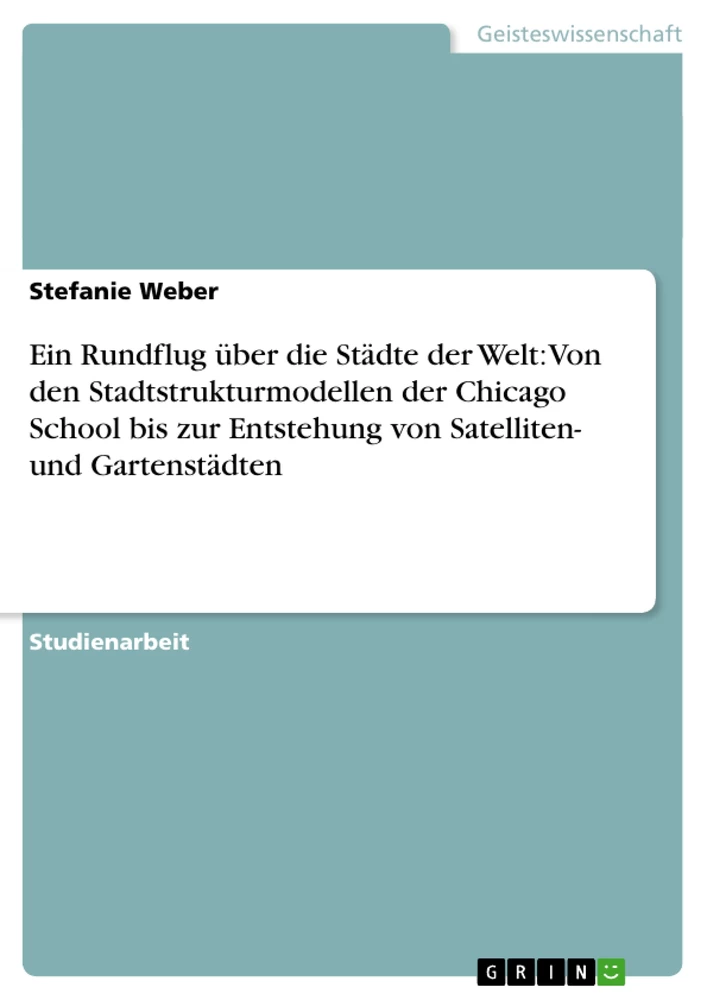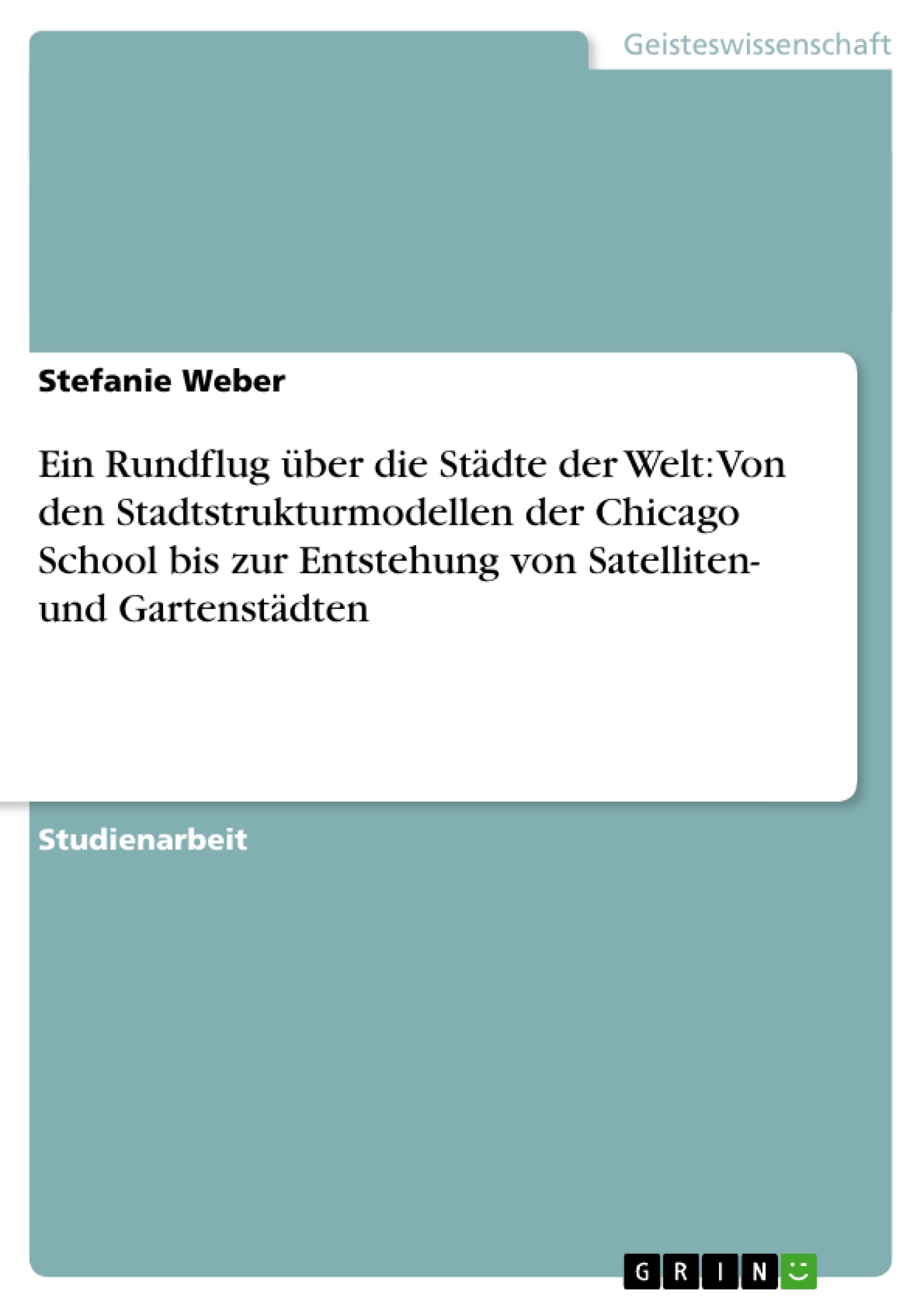Was sehen wir, wenn wir durch eine Stadt spazieren? Straßen, Einkaufszentren,
vielleicht ein Waldstück. All das sehen wir, wenn wir daran vorbeilaufen. Eine etwas
andere Perspektive können wir beispielsweise von einem Hochhaus einnehmen. Der
Augsburger Hotelturm lässt einen schon etwas weiter blicken. Noch immer sehen wir
dort Straßen – doch eine Struktur können wir aus dieser Perspektive nur schwer
erkennen. Dazu müssten wir in einen Hubschrauber steigen und von oben auf die
Stadt blicken. Nur dann ist es uns vielleicht möglich, eine Stadtstruktur zu erkennen.
Doch was bringt uns ein einziges Modell? Dann wollen wir schon vergleichen wie die
Strukturen anderer Städte aussehen. Genau das – nur ohne den Einsatz eines
Hubschraubers – möchte ich nun in meiner Arbeit versuchen. Ich werde verschiedene
Stadtstrukturmodelle beschreiben und mit anderen Modellen vergleichen.
Bevor ich nun einige Modelle genauer ansehe, möchte ich zunächst auf die drei
wichtigsten Modellfamilien hinweisen: Es gibt sozialgeographische Modelle,
kulturökologische Modelle und sozialökologische Modelle1.
Die sozialgeographischen Modelle bauen auf der These, dass Städte räumliche
Ausschnitte der Gesamtgesellschaft darstellen und sich dabei an der jeweiligen
politischen Struktur orientieren. Ändert sich dann die Konzeption der Stadt an sich oder
der Gesellschaft, ändert sich somit auch das gesellschaftlich-politische System. Zu den
sozialgeographischen Modellen zählen Perioden- und Stufenmodelle,
Landnutzungsmodelle, Städtebau- und Transformationsmodelle und bipolare Modelle.
Die kulturökologischen Modelle bauen ihre Erkenntnisse auf die kulturökologische
Stadtforschung. Darunter fällt die Erkundung von Kulturerdteilen und kulturhistorischen
Perspektiven.
Und was fällt einem beim Begriff „Sozialökologie ein? – Die soziologischen Theorien
der Chicago School. Hierbei wird die klassische Sozialökologie in zwei Etappen
ausgebaut: Den ersten Schritt machte die Sozialraumanalyse von Shevky und Bell.
Die analytische Geographie, die Faktorialökologie, wurde von Berry initiiert, von
Mackensen und Friedrichs dann weitergeführt. Im Weiteren werde ich mich nun zunächst auf die Stadtstrukturmodelle der Chicago School fokussieren. Im weiteren
Verlauf, werden dann Satelliten- und Gartenstädte ausführlich besprochen.
Inhaltsverzeichnis
- A.) Städte aus verschiedenen Perspektiven
- B.) Die Stadtstrukturmodelle der Chicago School
- 1.1. Das Zonenmodell von Burgess
- 1.2. Vergleich zu anderen Theorien und Modellen
- 1.3. Kritik am Modell von Burgess
- 2.1. Das Sektorenmodell von Hoyt
- 2.2. Vergleich zu anderen Theorien und Modellen
- 2.3. Kritik am Modell von Hoyt
- 3.1. Das Mehrkernmodell von Harris und Ullmann
- 3.2. Vergleich zu anderen Theorien und Modellen
- 3.3. Kritik am Modell von Harris und Ullmann
- 4.1. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse
- 4.2. Anwendbarkeit der Modelle
- C.) Die Entstehung neuer Städte
- 1.1. Das Gartenstadt-Modell
- 1.2. Vergleich zu anderen Theorien und Modellen
- 1.3. Kritik am Gartenstadt-Modell
- 2.1. Das Satelliten-Modell
- 2.2. Vergleich zu anderen Theorien und Modellen
- 2.3. Kritik am Satelliten-Modell
- 3.1. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse
- 3.2. Anwendbarkeit der Modelle
- D.) Städte und Strukturen – Resümee eines virtuellen Rundflugs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Stadtstrukturmodelle, beginnend mit den Modellen der Chicago School und anschließend mit der Entstehung von Garten- und Satellitenstädten. Ziel ist es, diese Modelle zu beschreiben, zu vergleichen und ihre Anwendbarkeit auf reale Städte zu analysieren.
- Stadtstrukturmodelle der Chicago School (Zonen-, Sektoren-, Mehrkernmodell)
- Vergleich der Modelle der Chicago School untereinander und mit anderen Ansätzen
- Konzept der Gartenstadt und seine Kritik
- Konzept der Satellitenstadt und seine Kritik
- Anwendbarkeit der Modelle auf reale Stadtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
A.) Städte aus verschiedenen Perspektiven: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es verschiedene Betrachtungsweisen von Stadtstrukturen vorstellt und die drei zentralen Modellfamilien – sozialgeographische, kulturökologische und sozialökologische Modelle – einführt. Es betont die Notwendigkeit des Vergleichs verschiedener Stadtstrukturen und kündigt die anschließende detaillierte Betrachtung der Modelle der Chicago School und neuer Stadtkonzepte an. Die Einleitung veranschaulicht den Übergang von einer subjektiven Wahrnehmung der Stadtlandschaft zu einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise durch den Einsatz von Stadtstrukturmodellen.
B.) Die Stadtstrukturmodelle der Chicago School: Dieses Kapitel beschreibt die drei Hauptmodelle der Chicago School – das Zonenmodell von Burgess, das Sektorenmodell von Hoyt und das Mehrkernmodell von Harris und Ullmann – im Kontext der soziologischen Theorien dieser Schule, insbesondere der Humanökologie, Stadtökologie und Urban Ecology. Es beleuchtet die zugrundeliegenden Annahmen, wie z.B. Sozialdarwinismus und ökonomische Konkurrenz, analysiert die jeweiligen Modelle detailliert und vergleicht sie kritisch miteinander, indem es sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede herausarbeitet. Die kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der Modelle bildet einen essentiellen Bestandteil des Kapitels.
C.) Die Entstehung neuer Städte: Das Kapitel widmet sich der Entstehung neuer Stadtkonzepte als Reaktion auf die Probleme der expandierenden Großstädte. Es konzentriert sich auf zwei zentrale Ansätze: das Gartenstadtmodell von Ebenezer Howard und das Satellitenstadtmodell. Für jedes Modell werden die zentralen Ideen, die historische Entwicklung und die kritischen Aspekte ausführlich dargestellt. Der Vergleich der beiden Modelle sowie deren Vergleich mit anderen relevanten Theorien und Entwicklungen runden das Kapitel ab und betonen die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung urbaner Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Chicago School, Stadtstrukturmodelle, Zonenmodell, Sektorenmodell, Mehrkernmodell, Gartenstadt, Satellitenstadt, Urbanisierung, Stadtentwicklung, Sozialökologie, Kulturökologie, Vergleich, Kritik, Anwendbarkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Städte aus verschiedenen Perspektiven"
Was ist der Inhalt des Dokuments "Städte aus verschiedenen Perspektiven"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Stadtstrukturmodelle. Es beginnt mit den Modellen der Chicago School (Burgess' Zonenmodell, Hoyts Sektorenmodell und Harris & Ullmanns Mehrkernmodell), vergleicht diese und analysiert deren Kritikpunkte. Anschließend werden die Konzepte der Gartenstadt und der Satellitenstadt vorgestellt, verglichen und kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung, dem Vergleich und der Anwendbarkeit der Modelle auf reale Städte.
Welche Stadtstrukturmodelle der Chicago School werden behandelt?
Das Dokument behandelt detailliert das Zonenmodell von Burgess, das Sektorenmodell von Hoyt und das Mehrkernmodell von Harris und Ullmann. Für jedes Modell werden die zugrundeliegenden Annahmen, die Struktur und die Kritikpunkte erläutert. Ein direkter Vergleich der drei Modelle untereinander ist ebenfalls Bestandteil der Analyse.
Wie werden die Modelle der Chicago School verglichen?
Die Modelle der Chicago School werden anhand ihrer Annahmen, ihrer Struktur und ihrer Stärken und Schwächen verglichen. Der Vergleich hebt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede hervor und ermöglicht eine umfassende Bewertung der jeweiligen Ansätze.
Welche Kritikpunkte an den Modellen der Chicago School werden angesprochen?
Das Dokument identifiziert und diskutiert kritische Aspekte aller drei Modelle der Chicago School. Diese Kritikpunkte beziehen sich unter anderem auf die zugrundeliegenden Annahmen, die Vereinfachungen der Realität und die eingeschränkte Anwendbarkeit auf moderne Stadtstrukturen.
Welche alternativen Stadtkonzepte werden behandelt?
Neben den Modellen der Chicago School werden das Gartenstadtmodell und das Satellitenstadtmodell als alternative Konzepte zur Stadtentwicklung vorgestellt und analysiert. Diese Modelle werden ebenfalls kritisch betrachtet und mit den Modellen der Chicago School verglichen.
Wie werden das Gartenstadt- und das Satellitenstadtmodell verglichen?
Der Vergleich zwischen dem Gartenstadt- und dem Satellitenstadtmodell konzentriert sich auf die zentralen Ideen, die historische Entwicklung und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung urbaner Herausforderungen werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Chicago School, Stadtstrukturmodelle, Zonenmodell, Sektorenmodell, Mehrkernmodell, Gartenstadt, Satellitenstadt, Urbanisierung, Stadtentwicklung, Sozialökologie, Kulturökologie, Vergleich, Kritik, Anwendbarkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, verschiedene Stadtstrukturmodelle zu beschreiben, zu vergleichen und deren Anwendbarkeit auf reale Städte zu analysieren. Es soll ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Ansätze zur Erklärung und Gestaltung von Stadtstrukturen vermitteln.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts prägnant zusammenfasst.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für alle gedacht, die sich akademisch mit Stadtstrukturmodellen und Stadtentwicklung auseinandersetzen, insbesondere für Studenten der Geographie, Soziologie und Stadtplanung.
- Quote paper
- Stefanie Weber (Author), 2005, Ein Rundflug über die Städte der Welt: Von den Stadtstrukturmodellen der Chicago School bis zur Entstehung von Satelliten- und Gartenstädten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121272