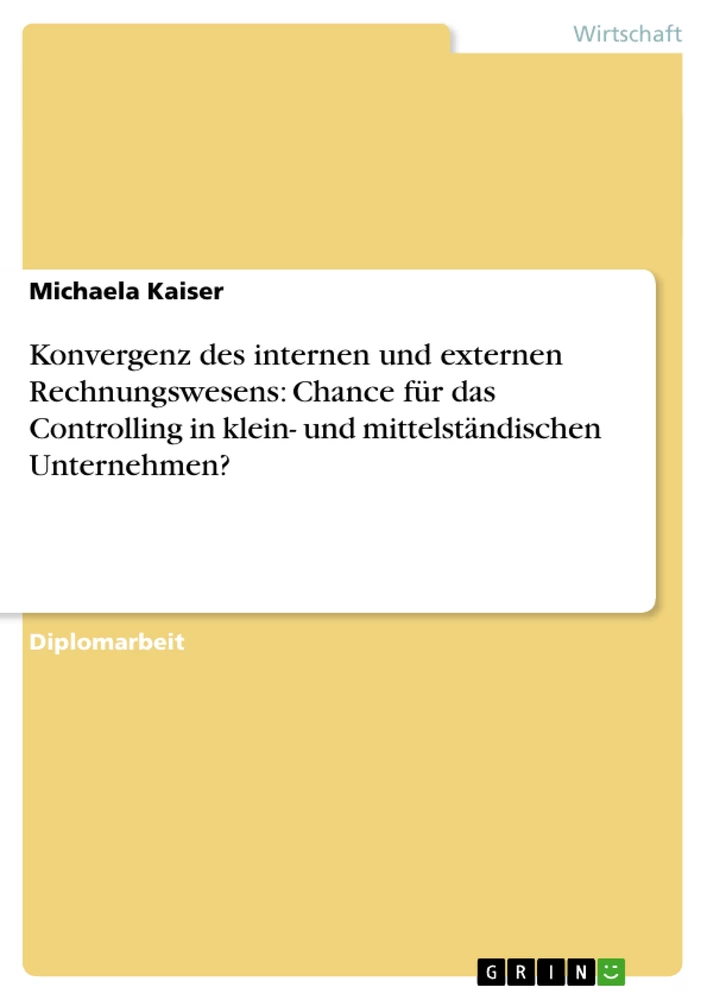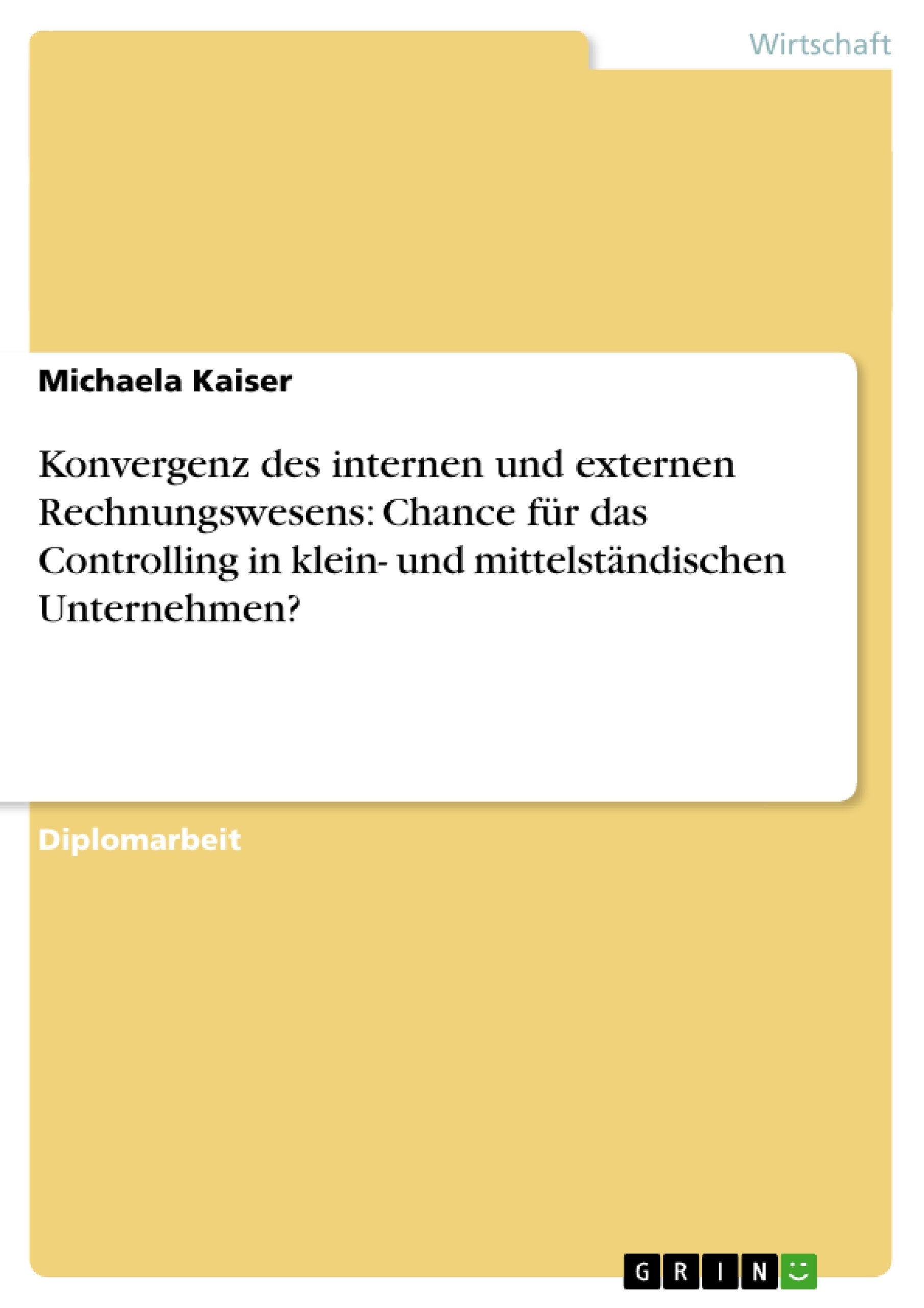Im Jahre 1992 unternahm die Siemens AG einen für Deutschland revolutionären Schritt: sie vereinheitlichte ihre interne und externe Ergebnisrechnung. Damit stieß sie eine Diskussion an, welche die vor allem in Deutschland vorherrschende Teilung der betrieblichen Buchhaltung in ein internes und ein externes Rechnungswesen zunehmend in Frage stellte.
Die Globalisierung der Märkte führt aktuell zu Veränderungen der Rechnungslegung. Der Informationsgehalt des externen Rechnungswesens gleicht sich dem des internen zunehmend an. Es erscheint möglich, dass das externe Rechnungswesen Funktionen des internen übernimmt und damit als Datengrundlage einer rationalen Unternehmensführung und damit des Controllings in Frage kommt.
Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) als „Säule der Marktwirtschaft“ wird von der Forschung seit Jahren Defizite in der rationalen Unternehmensführung bescheinigt, bedingt durch ein unterentwickeltes Controlling. Allerdings sind Controllinginstrumente häufig für Großunternehmen konzipiert und vernachlässigen die Erfordernisse und Besonderheiten in kleinen und mittleren Unternehmen.
Doch könnten KMU im Zuge der aktuellen Veränderungen der Rechnungslegung von einer möglichen Controllingeignung profitieren und ihr Controlling ausbauen.
Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie untersucht aus aktuellem Anlass die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die Controllingeignung der generierten Daten.
Darauf folgt der konkrete Entwurf eines Ausbaus des Controllingsystems in kleinen Unternehmen, ergänzt um Beispielrechnungen. Eine kritische Diskussion, wie weit bestehende Hindernisse gegen ein Controlling in KMU durch den Systementwurf ausgeräumt werden und welche Parameter die Controllingeinführung zusätzlich beeinflussen, rundet die Arbeit ab.
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Im Jahre 1992 unternahm die Siemens AG einen für Deutschland revolutionären Schritt: sie vereinheitlichte ihre interne und externe Ergebnisrechnung[1]. Damit stieß sie eine Diskussion an, welche die vor allem in Deutschland vorherrschende Teilung der betrieblichen Buchhaltung in ein internes und ein externes Rechnungswesen[2] zunehmend in Frage stellte.
Die Globalisierung der Märkte führt aktuell zu Veränderungen der Rechnungslegung. Der Informationsgehalt des externen Rechnungswesens gleicht sich dem des internen zunehmend an[3]. Es erscheint möglich, dass das externe Rechnungswesen Funktionen des internen übernimmt und damit als Datengrundlage einer rationalen Unternehmensführung und damit des Controllings in Frage kommt.
Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) als „Säule [der] (d. V.) Marktwirtschaft“[4] wird von der Forschung seit Jahren Defizite in der rationalen Unternehmensführung bescheinigt, bedingt durch ein unterentwickeltes Controlling. Allerdings sind Controllinginstrumente häufig für Großunternehmen konzipiert und vernachlässigen die Erfordernisse und Besonderheiten in kleinen und mittleren Unternehmen[5]. „A small business is not a little big business.“[6]
Doch könnten KMU im Zuge der aktuellen Veränderungen der Rechnungslegung von einer möglichen Controllingeignung profitieren und ihr Controlling ausbauen.
1.2 Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, wie sich ein Controllingausbau auf Grundlage eines konvergenten Rechnungswesens in KMU vollziehen könnte und ob bestehende Hürden dadurch abgebaut werden.
Zum Verständnis der Arbeit erfolgt zu Beginn eine Erläuterung des Begriffs „Controlling“ und eine Einführung in seine wichtigste Datengrundlage, das interne Rechnungswesen. Der zweite Rechnungskreis, die externe Rechnungslegung wird im Anschluss dargelegt. In den theoretischen Grundlagen werden auch bestehende Divergenzen der Rechnungslegungskreise sowie aktuelle Tendenzen, die eine Harmonisierung der Datenbasen fördern, aufgezeigt.
Daran schließt sich die Vorstellung der in dieser Arbeit zentralen Untersuchungsobjekte, der klein- und mittelständischen Unternehmen an. Durch Auswertung empirischer Untersuchungen der vergangenen Jahre wird die gegenwärtige Nutzung von Controllinginstrumenten in Häufigkeit und Ausprägung und die einer vertiefenden Anwendung entgegenstehenden Gründe in KMU herausgearbeitet.
Um die Auswirkungen einer Konvergenz auf die Controllingeignung der Datenbasis darzustellen, analysiert Kapitel vier den Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hinsichtlich des Aussagegehalts der Bilanzdaten in Bezug auf ihre interne Steuerungseignung. Die vorangegangenen Ausarbeitungen werden in Kapitel fünf zusammengeführt, in dem auf Grundlage einer konvergenten externen Rechnungslegung Instrumente zur Erfolgs- und Liquiditätssteuerung dargestellt werden. Gleichzeitig wird untersucht, ob dieser Systementwurf die in KMU bestehenden Vorbehalte gegen ein Controlling ausräumen kann und ob der Implementierungsprozess durch die Änderungen im Rahmen einer Umstellung der externen Rechnungslegung initiiert werden könnte.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse ab.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Rechnungswesen
Das Rechnungswesen ist ein zahlenbasiertes Informationssystem. Es „hat die Funktion der mengen- und wertmäßigen Erfassung von ökonomisch relevanten Tatbeständen und Vorgängen im Betrieb über zurückliegende, bestehende und zukünftige wirtschaftliche Beziehungen des Unternehmens zu seiner Umwelt.“[7]
Grundlage des Rechnungswesens ist die Finanzbuchhaltung, eine pagatorische Rechnung, d.h. sie erfasst bereits erfolgte bzw. antizipierte Zahlungen[8].
In Deutschland erfolgt traditionell eine Unterteilung in ein externes und ein internes Rechnungswesen. Je nach Ausrichtung des Rechnungswesens sind die Teilgebiete externe Bilanzrechnung oder interne Kosten- und Leistungsrechnung von Bedeutung[9].
[...]
[1] Vgl. Jonen, Andreas/Lingnau, Volker: „Konvergenz von internem und externem Rechnungswesen – Betriebswirtschaftliche Überlegungen und Umsetzung in der Praxis“, in: „Beiträge zur Controlling-Forschung“, hrsg. von Lingnau, Volker, 2. Auflage, August 2006, S. 19, http://www.econbiz.de/archiv/ks/tuks/controlling/konvergenz_internesexternes_rechnungswesen.pdf,
Aufruf und Ausdruck am 07. August 2008.
[2] Vgl. Günther, Thomas/Zurwehme, Annikka: „Harmonisierung des Rechnungswesens – Stellschrauben, Informationswirkung und Nutzenbewertung“, in: BFuP 60, Heft 2, März/April 2008, S.102.
[3] Vgl. Stute, Andreas: „Konvergenz von IFRS und interner Unternehmensrechnung. Eignung der IFRS-Rechnungslegung zur Erfüllung von Funktionen und zur Substitution von Instrumenten der internen Unternehmensrechnung“, Berlin 2007, S. 2 f.
[4] Hamer, Eberhard: „Volkswirtschaftliche Bedeutung von Klein- und Mittelbetrieben“, in: „Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe – Größenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung“, hrsg. von Pfohl, Hans-Christian, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 2006, S. 49
[5] Vgl. Legenhausen, Claas: „Controllinginstrumente für den Mittelstand“, Wiesbaden 1998, S. 155.
[6] Pfohl, Hans-Christian: „Abgrenzung der Klein- und Mittelbetriebe von Großbetrieben“, in: „Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe – Größenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung“, hrsg. von Pfohl, Hans-Christian, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 2006, S. 2 mit Verweis auf Welsh, J. A./White, J. F.
[7] Barth, Thomas/Barth, Daniela: „Controlling“, 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, München 2008, S. 134. Vgl. auch Stute [Konvergenz], S. 16 f.
[8] Vgl. Küpper, Hans-Ulrich: „Controlling – Konzeptionen, Aufgaben und Instrumente“, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, S. 115 ff. Auf Leistungen und Kosten wird in Kapitel 2.1.1.1 Kosten- und Leistungsrechnung näher eingegangen.
[9] Vgl. Küpper [Controlling], S. 111.
- Quote paper
- Michaela Kaiser (Author), 2008, Konvergenz des internen und externen Rechnungswesens: Chance für das Controlling in klein- und mittelständischen Unternehmen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120978