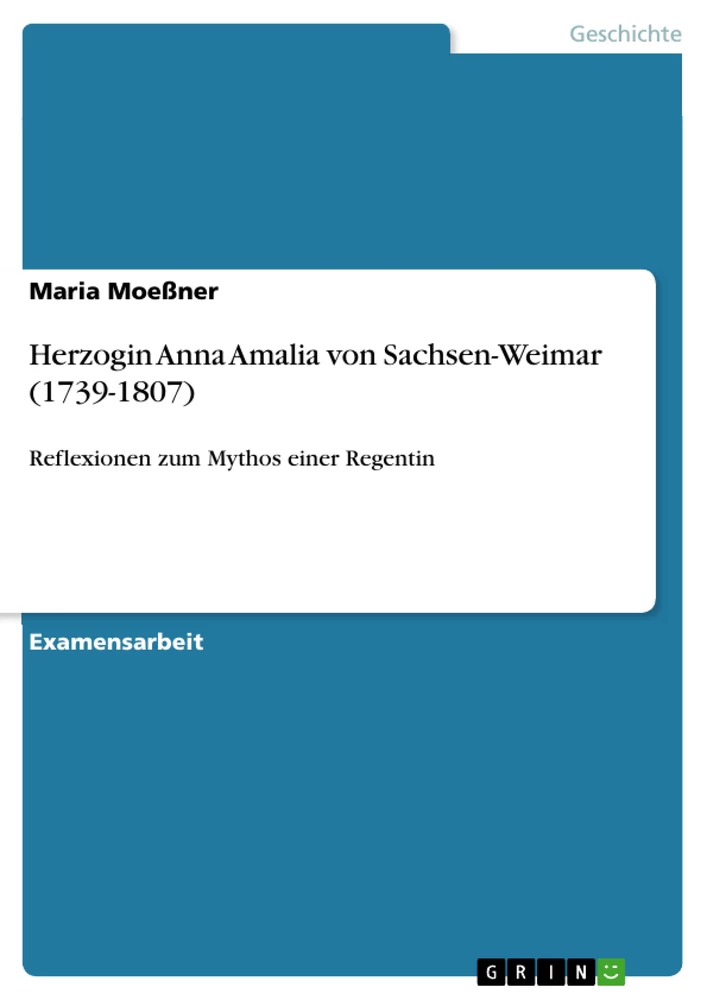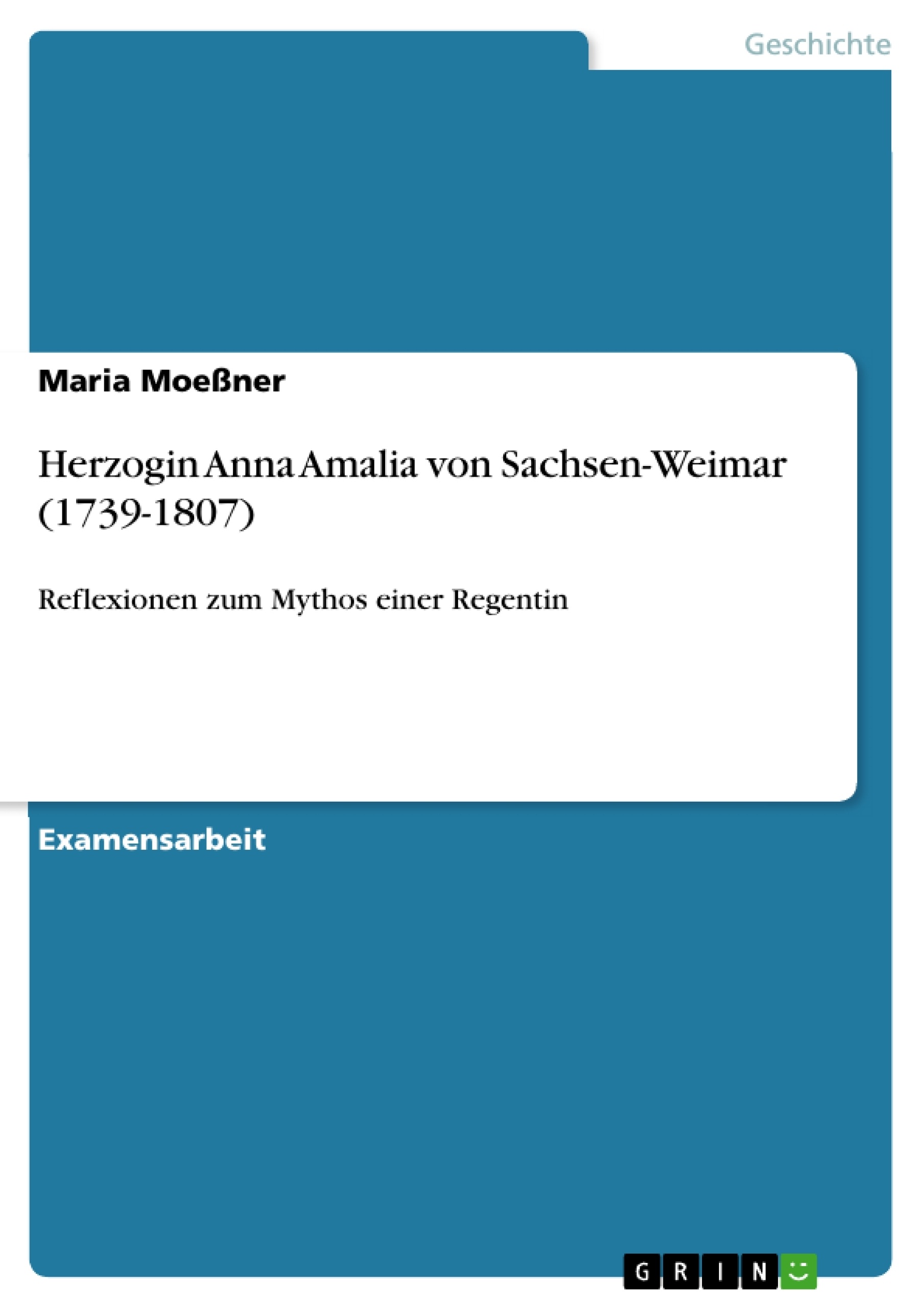Joachim BERGER beschreibt Anna Amalia in seinem Epilog als eine von vielen Herzoginnen im Alten Reich des 18. Jahrhunderts, ihre Leistungen seien nicht „bedeutsamer“ als die einer anderen Herzogin – das dynastische Denken der Herzogin bleibt uns fremd . Er bezeichnet sie als eine in allen ihren Facetten faszinierende Standesperson aus der Spätphase des Ancien Régime . BERGER ist in diesem Punkt uneingeschränkt zuzustimmen, denn der Braunschweiger Herzogin gelang es, sich durch ihre Hochzeit mit Ernst August II. Constantin im Jahr 1756, aber auch durch ihre eigene vormundschaftliche Regentschaft im Herzogtum Sachsen-Weimar zu etablieren und zu repräsentieren.
Anna Amalia erhielt in ihrer Jugend eine fundierte Ausbildung zu einer Fürstentochter und wurde auf ihre zukünftigen Aufgaben am Hof vorbereitet: „Meine Erziehung zielte auf nichts weniger, als mich zu eine(r) Regentin zu bilden. Sie war, wie alle Fürstenkinder erzogen werden. [...]“ .
Als ihr Ehemann Ernst August II. Constantin bereits zwei Jahre nach der Hochzeit starb, musste Anna Amalia nun die vormundschaftliche Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn Carl August übernehmen und die Regierungsgeschäfte führen. Bereits nach ihrer Hochzeit hatte Anna Amalia den Titel „regierende Herzogin“ erhalten, aber bis zum Tod des Herzogs keinen politischen Einfluss gehabt. Nun wurde von der Regentin die „Bildung eines ideell und administrativ einheitlichen Staatswesens“ erwartet. Das Testament Ernst August II. Constantins legte fest, dass die Herzogin bezüglich des Weimarer Staates zu bewahren und zu konsolidieren hatte . Doch Anna Amalia fühlte sich zunächst überfordert mit der alleinigen Regentschaft: „Die schnellen Veränderungen, welche Schlag auf Schlag kamen, machten einen solchen Tumult in meiner Seele, dass ich nicht zu mir selber komen konnte. [...] Ich fühlte meine Untüchtigkeit, und dennoch musste ich alles in mir selber finden. Wenn man die Gefahr vor Augen sieht oder der Mensch viele leiden hat, so nimmt er seine Zuflucht zum Gebeht. [...] In denen Jahren, wo sonst alles blühtet, war bei mir nur Nebel und Finsternis.“ . Die Regentin erhielt daraufhin durch den braunschweigischen Vizekanzler Georg Septimus von Praun indirekte Unterstützung von ihrem Vater Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Person Anna Amalia von Sachsen-Weimar
- 2.1 Herkunft - Das Haus Braunschweig-Wolfenbüttel
- 2.2 Hochzeit mit Ernst August II. Constantin zu Sachsen-Weimar-Eisenach im Jahr 1756
- 2.2.1 Das Haus Sachsen-Weimar
- 2.3 Erwartungen an Anna Amalia als neue „Landesmutter“
- 3. Die Regierungszeit Anna Amalias (1759-1775)
- 3.1 Selbstregentin und Mitregentschaft
- 3.1.1 Geheimes Consilium und Landesstände
- 3.1.2 Unterstützung des Braunschweiger Hofes
- 3.2 Außenpolitische Maßnahmen und Erfolge
- 3.3 Landespolitik und Administration
- 3.4 Das Ende der Regentschaft Anna Amalias
- 3.1 Selbstregentin und Mitregentschaft
- 4. „Erhabenes verehrend, Schönes genießend, Gutes wirkend" - Die Bedeutung Anna Amalias für das klassische Weimar
- 4.1 Die Weimarer Bibliothek
- 4.1.1 Die Wolfenbütteler Bibliothek als Vorbild
- 4.1.2 Die Schriften Anna Amalias
- 4.2 Die Bedeutung der Italienreise für Anna Amalia und Weimar
- 4.3 Anna Amalia und Johann Wolfgang von Goethe
- 4.1 Die Weimarer Bibliothek
- 5. Der Mythos Anna Amalias
- 5.1 Die Bedeutung für die thüringische Residenz
- 5.1.1 Anna Amalia als ewige Legende
- 5.2 Weimar als „ästhetische“ Marke
- 5.1 Die Bedeutung für die thüringische Residenz
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das Leben und Wirken Anna Amalias von Sachsen-Weimar, insbesondere ihre Rolle als Regentin. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Herzogin zu zeichnen und die gängige, oft idealisierte Darstellung zu hinterfragen. Die Arbeit analysiert ihre Regentschaft im Hinblick auf innen- und außenpolitische Erfolge und Misserfolge.
- Anna Amalias Leben und Erziehung im Kontext ihres Herkunftshauses.
- Ihre Regentschaft und deren Auswirkungen auf den Weimarer Staat.
- Ihre Rolle in der Entwicklung des klassischen Weimar.
- Die Entstehung und Perpetuierung des Mythos Anna Amalia.
- Bewertung der Quellenlage und der bisherigen Forschung zu Anna Amalia.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung Anna Amalias als Regentin in den Vordergrund. Sie skizziert die bisherige Forschung und deren einseitige Darstellung der Herzogin und benennt die methodischen Ansätze der Arbeit.
2. Die Person Anna Amalia von Sachsen-Weimar: Dieses Kapitel beleuchtet die Herkunft Anna Amalias aus dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel und ihre Erziehung. Es analysiert die Erwartungen an sie als „Landesmutter“ nach ihrer Hochzeit mit Ernst August II. Constantin und beleuchtet die Herausforderungen ihrer Position.
3. Die Regierungszeit Anna Amalias (1759-1775): Hier wird Anna Amalias Regierungszeit detailliert untersucht. Es werden ihre außenpolitischen Maßnahmen, insbesondere im Kontext des Siebenjährigen Krieges, und ihre innenpolitische Administration analysiert. Die Rolle des Geheimen Consiliums und der Landesstände wird ebenso beleuchtet wie die Unterstützung durch den Braunschweiger Hof. Das Kapitel endet mit einer Darstellung des freiwilligen Rücktritts Anna Amalias.
4. „Erhabenes verehrend, Schönes genießend, Gutes wirkend" - Die Bedeutung Anna Amalias für das klassische Weimar: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Anna Amalias Beitrag zur kulturellen Entwicklung Weimars. Der Aufbau der Weimarer Bibliothek, inspiriert vom Vorbild Wolfenbüttel, und die Förderung von Gelehrten werden ausführlich behandelt. Der Einfluss ihrer Italienreise und ihre Beziehung zu Goethe werden ebenfalls analysiert.
5. Der Mythos Anna Amalias: Das Kapitel untersucht die Frage, inwieweit Anna Amalia als mythische Figur betrachtet werden kann. Es analysiert ihre Bedeutung für die thüringische Residenz und die Entwicklung Weimars als „ästhetische“ Marke. Die Arbeit hinterfragt kritisch die idealisierte Darstellung der Herzogin und analysiert die historische Entwicklung ihrer Legendenbildung.
Schlüsselwörter
Anna Amalia von Sachsen-Weimar, Regentschaft, Weimarer Klassik, Aufklärung, Außenpolitik, Innenpolitik, Mythos, Quellenkritik, Braunschweig-Wolfenbüttel, Geheimes Consilium, Landesstände.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anna Amalia von Sachsen-Weimar
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht Leben und Wirken Anna Amalias von Sachsen-Weimar, insbesondere ihre Rolle als Regentin. Sie zielt darauf ab, ein differenziertes Bild der Herzogin zu zeichnen und gängige, idealisierte Darstellungen zu hinterfragen, indem sie ihre Regentschaft im Hinblick auf innen- und außenpolitische Erfolge und Misserfolge analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Anna Amalias Leben und Erziehung im Kontext ihres Herkunftshauses (Braunschweig-Wolfenbüttel), ihre Regentschaft und deren Auswirkungen auf den Weimarer Staat, ihre Rolle in der Entwicklung des klassischen Weimar, die Entstehung und Perpetuierung des Mythos Anna Amalia und eine kritische Bewertung der Quellenlage und bisherigen Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet Anna Amalias Herkunft und die Erwartungen an sie als Regentin. Kapitel 3 analysiert detailliert ihre Regierungszeit (1759-1775), einschließlich Außen- und Innenpolitik. Kapitel 4 konzentriert sich auf ihren Beitrag zur kulturellen Entwicklung Weimars (z.B. Weimarer Bibliothek, Italienreise, Goethe). Kapitel 5 untersucht den Mythos Anna Amalia und seine Entstehung. Kapitel 6 bietet eine Zusammenfassung.
Welche Quellen werden verwendet und wie wird die Quellenlage bewertet?
Die Arbeit geht explizit auf die Quellenlage und deren Bewertung ein. Die genaue Auflistung und Bewertung der verwendeten Quellen findet sich im Haupttext der Arbeit selbst. Ein expliziter Punkt der Arbeit ist die kritische Hinterfragung der oft einseitig idealisierten Darstellungen Anna Amalias, was auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen hindeutet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt auf ein differenziertes Bild Anna Amalias ab, das die gängige, idealisierte Darstellung hinterfragt. Die konkreten Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Analyse der verschiedenen Aspekte ihres Lebens und Wirkens, ihrer Regierungszeit und der Entwicklung des Mythos um ihre Person. Die genauen Schlussfolgerungen sind im letzten Kapitel der Arbeit nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Anna Amalia von Sachsen-Weimar, Regentschaft, Weimarer Klassik, Aufklärung, Außenpolitik, Innenpolitik, Mythos, Quellenkritik, Braunschweig-Wolfenbüttel, Geheimes Consilium, Landesstände.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit und richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit Anna Amalia von Sachsen-Weimar, der Weimarer Klassik und der Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigen. Sie eignet sich für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die eine fundierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema suchen.
- Quote paper
- Maria Moeßner (Author), 2008, Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (1739-1807), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120975