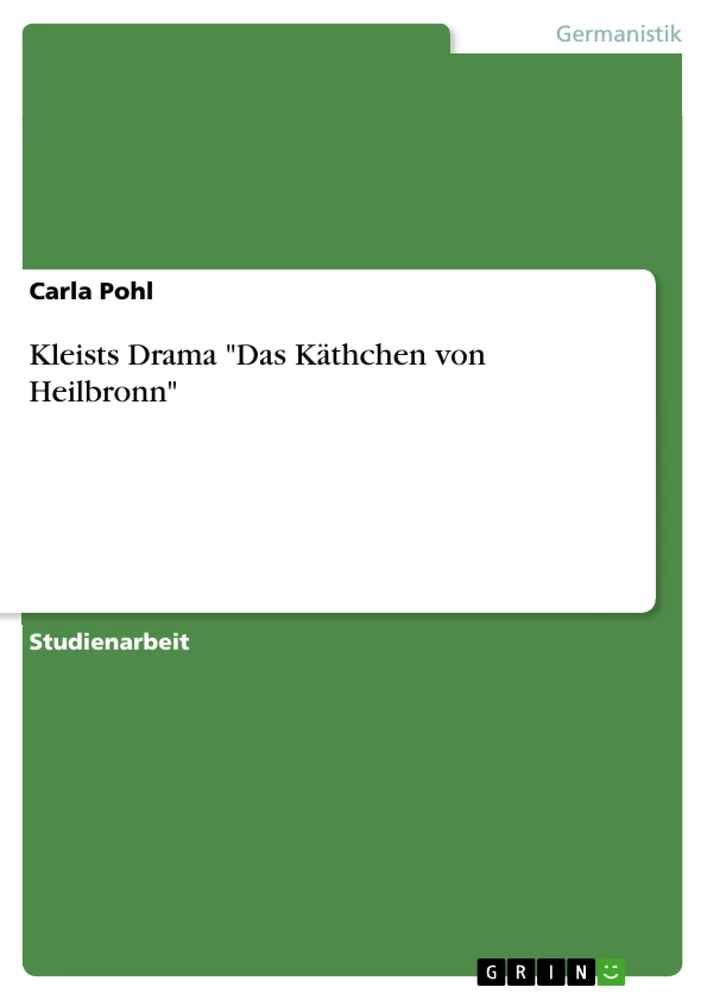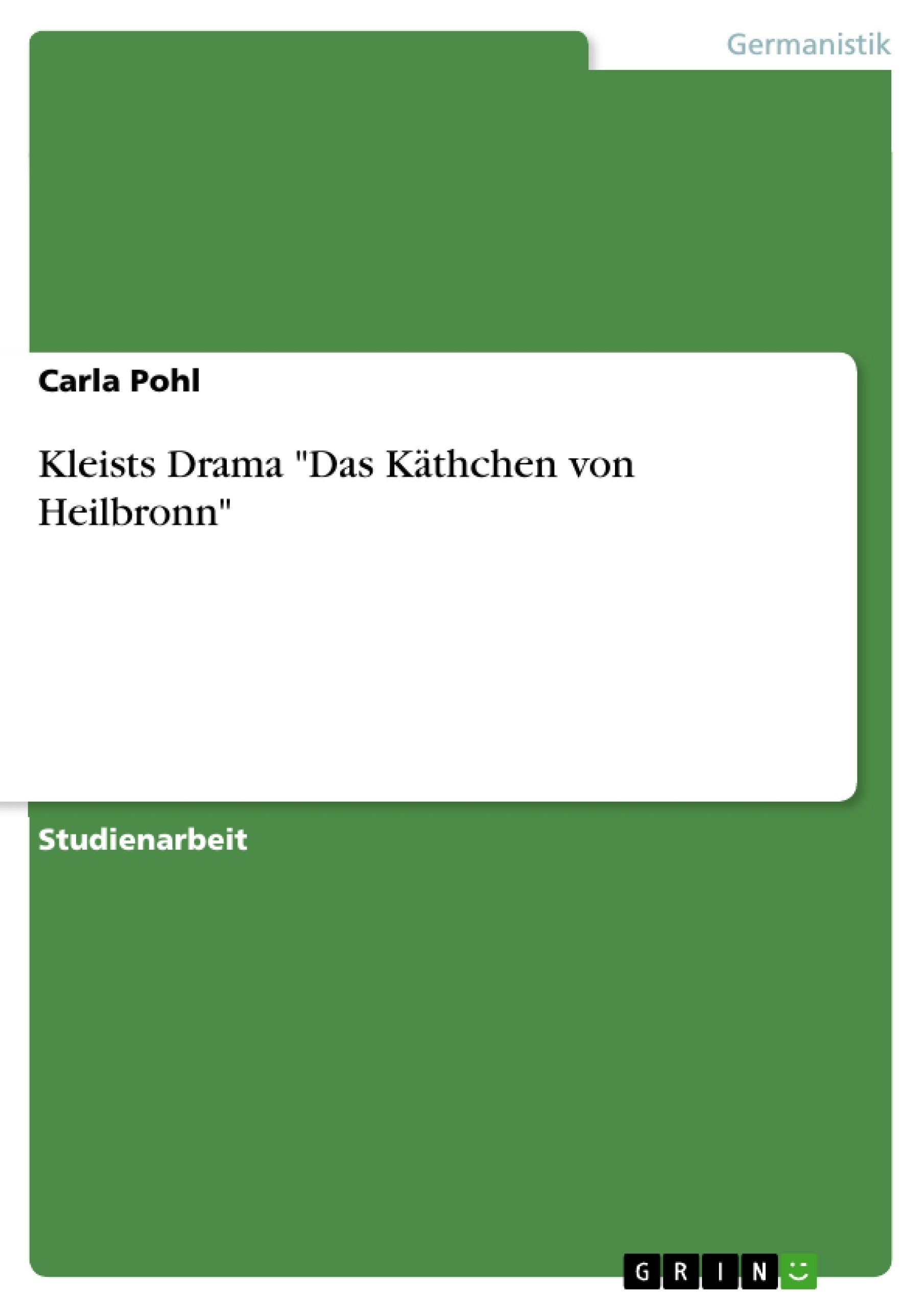Diese Arbeit befasst sich mit dem Kleistschen Drama „Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe Ein großes Historisches Ritterschauspiel“ von 1810 als erste Buchausgabe. Erstdrucke sind als Teilabdruck im Phöbus 1808 erschienen. Die Uraufführung fand statt 1810 im Theater Wien.
Das Schauspiel beinhaltet zwei Frauenfiguren, die gegensätzliche Bilder abgeben. Käthchen, als eine, durch ihre Gefühle und ihr Unterbewusstsein geprägte Frau, steht im Gegensatz zu Kunigunde, deren Hauptcharakteristikum die Rationalität und das Bewusstsein ist.
Beide Kontrahentinnen wirken auf den männlichen Hauptprotagonisten ein. Friedrich Wetter vom Strahl ist anfangs ebenso wie Kunigunde durch Rationalität geprägt, erfährt aber im Laufe des Dramas eine Entwicklung hin zur Emotionalität. Ein Paradoxon der inneren zur äußeren Welt ist in der Figur des Grafen Wetter vom Strahl impliziert. Welche Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit Kleist in seinem Schauspiel darstellt, soll eine Frage dieser Arbeit sein.
Zudem kommt eine Welt zutage, die sowohl mythische als auch religiöse Inhalte vereint. Welche Wirkung diese Inhalte auf die Geschlechterkonstruktion haben, wird ein weiterer Bestandteil dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.
- 2.1 Käthchen
- 2.2 Graf Wetter vom Strahl
- 2.3 Kunigunde
- 3. Das Rätsel um Käthchen
- 3.1 Der Sylvesternachtstraum
- 3.2 Der Schlossbrand und die Entdeckung der Hässlichkeit Kunigundes
- 3.3 Die Legalisation der Ehe und der Sturz Kunigundes
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Drama „Das Käthchen von Heilbronn“ im Hinblick auf die Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit sowie die Integration mythischer und religiöser Elemente. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen Käthchen und Kunigunde als zwei gegensätzliche Frauenfiguren und deren Einfluss auf den männlichen Protagonisten, Graf Wetter vom Strahl. Die Untersuchung beleuchtet die Entwicklung des Grafen von Rationalität zu Emotionalität und erforscht das Paradoxon zwischen innerer und äußerer Welt.
- Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit in Kleists Drama
- Kontrast zwischen Käthchen und Kunigunde als Repräsentantinnen unterschiedlicher Werte
- Die Entwicklung des Grafen Wetter vom Strahl
- Integration mythischer und religiöser Elemente im Drama
- Das Rätsel um Käthchens Hingabe und ihr Verhältnis zum Grafen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Drama „Das Käthchen von Heilbronn“ ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Das zweite Kapitel analysiert die drei Hauptfiguren: Käthchen, charakterisiert durch ihre emotionale Hingabe und ihr teilweise traumähnliches Verhalten; Graf Wetter vom Strahl, dessen anfängliche Rationalität im Laufe des Dramas durch emotionale Entwicklungen verändert wird; und Kunigunde, die im Gegensatz zu Käthchen durch Rationalität und Bewusstsein geprägt ist. Der Abschnitt über Käthchen beleuchtet ihre Darstellung durch die männlichen Protagonisten und die Anklage Theodors vor dem Fehmgericht, die Käthchens außergewöhnliche Natur hervorhebt. Der Abschnitt über den Grafen Wetter vom Strahl deutet auf die noch nicht bewusste Verbindung zu Käthchen hin. Der Abschnitt über Kunigunde beschreibt sie als Gegenspielerin zu Käthchen, deren Rationalität und Machtstreben im Kontrast zu Käthchens Emotionalität steht. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem "Rätsel um Käthchen" ohne dessen Auflösung zu enthüllen.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Das Käthchen von Heilbronn, Weiblichkeit, Männlichkeit, Rationalität, Emotionalität, Mythische Elemente, Religiöse Elemente, Käthchen, Graf Wetter vom Strahl, Kunigunde, Fehmgericht, Paradoxon, Traumthematik.
- Quote paper
- Carla Pohl (Author), 2007, Kleists Drama "Das Käthchen von Heilbronn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120880