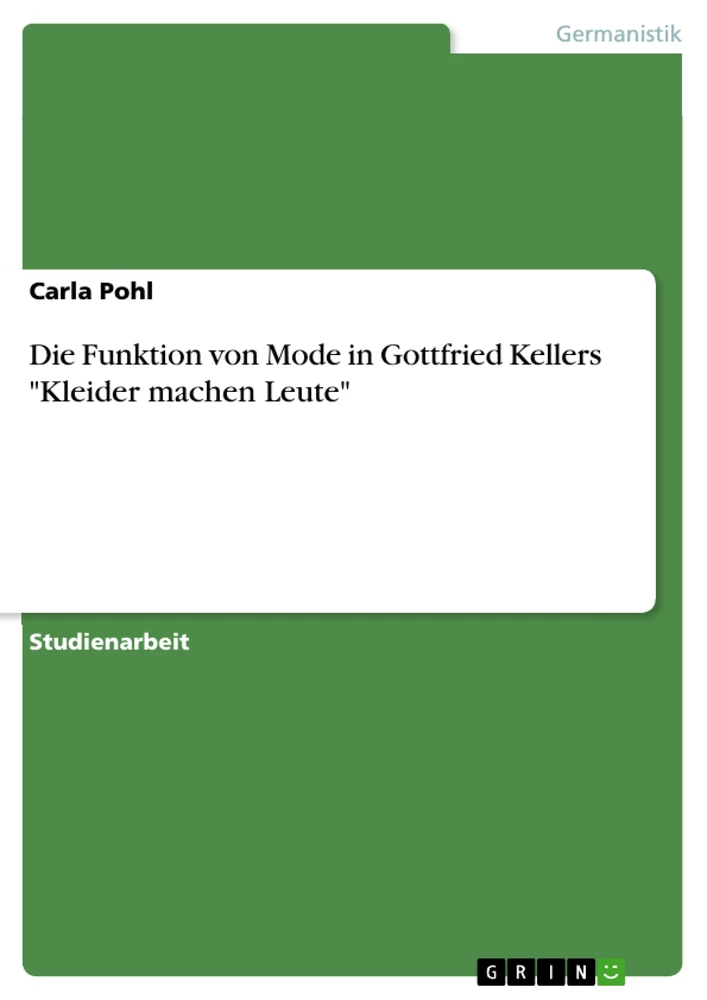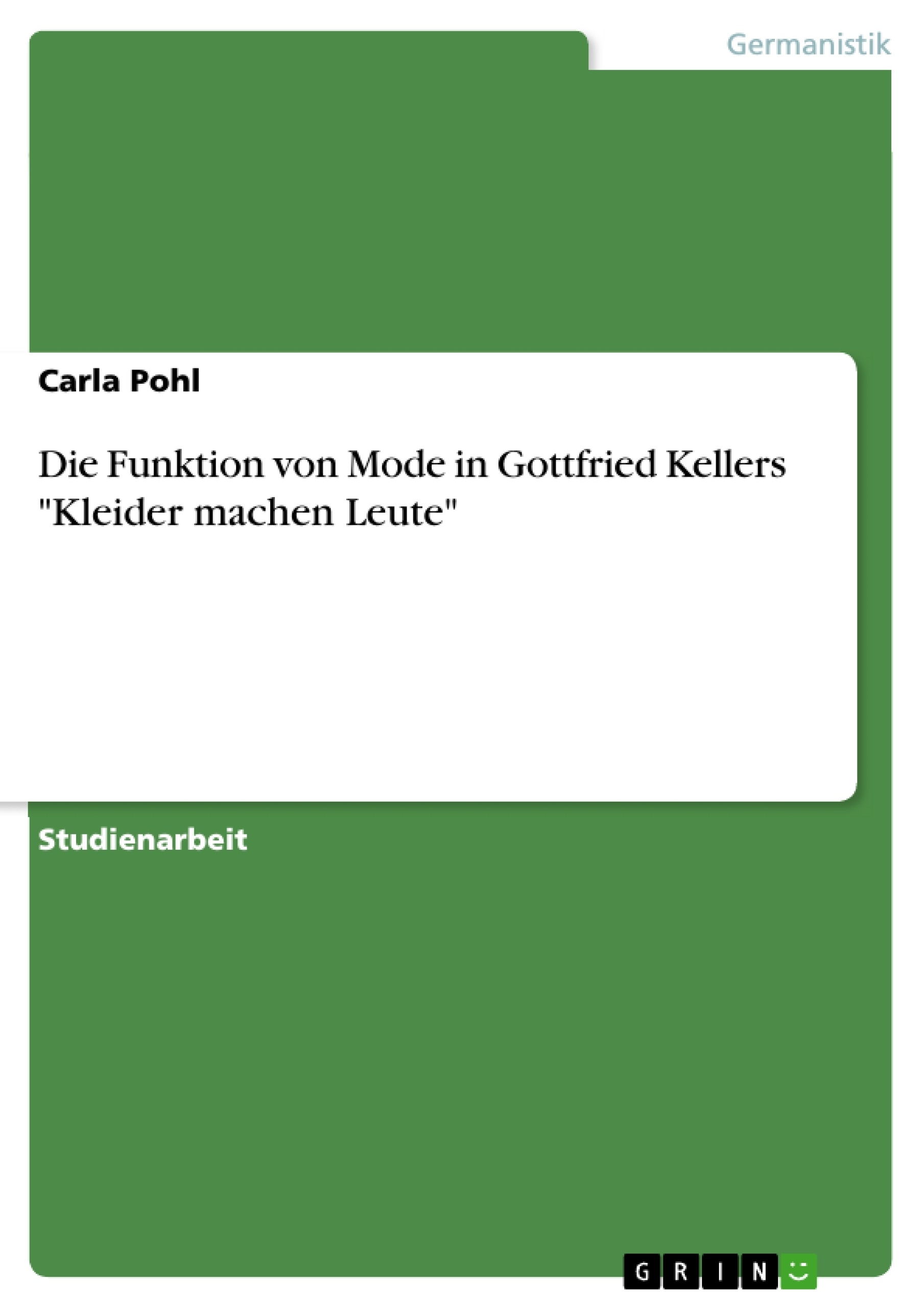Diese Arbeit befasst sich mit der gesellschaftlichen Funktion von Mode in Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“ von 1870.
Mode im weitesten Sinne nennt man eine zeitweise gültige und während dieser Zeit allgemein akzeptierte Anschauung von den [!] äußeren Kulturformen. Die Mode bestimmt zumeist ein Bild des Ideals von Schönheit in der jeweiligen Gesellschaft. Jede Epoche entwickelt eigene Maßstäbe von einem ästhetischen Ideal des menschlichen Körpers.
Kleidung betont oder unterdrückt bestimmte Partien des Körpers, um die Silhouette dem gültigen Ideal anzunähern: Sie korrigiert und stilisiert. Mode gibt die Möglichkeit nach außen jemand anderes zu sein als seine Herkunft es vorgibt.
Kleidungsstil und Mode haben die Eigenschaft einen raschen Wechsel zu vollziehen. Das heißt es besteht ständige Veränderung in Kleidungs- und Lebensstilen. Kleidung hat ebenfalls die Eigenschaft, den sozialen Stand einer Person zu signalisieren. Sie reflektiert soziale Hierarchien. Vor allem das Mittelalter kannte [..] Kleiderordnungen, die sich in komplizierten Regelungen über Farbe und Qualität der Stoffe verästelten. Im Mittelalter ist die Menge des Stoffes, seine Art (Seide, Baumwolle u.a.), die Länge der Schleppe eine Richtlinie für die gesellschaftliche Einordnung. Somit gibt die Kleidung verlässliche Auskunft über die Herkunft einer Person.
Schon der Titel der Novelle, als Sprichwort, beinhaltet dieses Thema, welches sich mit gesellschaftlichen Ständen und deren Kleiderordnung beschäftigt. Kann jemand aus seiner Herkunft heraustreten, wenn er sich mit der Kleidung eines anderen Standes bedeckt oder gehört mehr zu einem sozialen Aufstieg?
Der Held der Novelle, ein Schneider Namens Wenzel Strapinski, tritt aus dem sozialen, durch Stände statisch festgelegten, System heraus. Die Frage aber ist, ob dies nur durch die Tatsache geschieht, dass er sich „vornehm“ kleidet? Welche Funktion hat dabei die Kleidung Strapinskis und welche Rolle spielt sein Beruf als Schneider? In wiefern sind die Bewohner der Stadt Goldach an seiner Situation beteiligt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Das erste Auftreten Wenzel Strapinskis
- 2.2 Die Wirkung Wenzels auf seine Umwelt und die daraus resultierenden Folgen
- 2.3 Die Demaskierung des Grafen als Schneider
- 3. Die gesellschaftliche Funktion der Kleidung
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftliche Funktion von Mode in Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“. Der Fokus liegt auf der Rolle der Kleidung als Mittel des sozialen Aufstiegs und der Täuschung, sowie auf den daraus resultierenden Konsequenzen für die Hauptfigur Wenzel Strapinski.
- Die Bedeutung von Kleidung als Statussymbol im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss von Mode auf soziale Wahrnehmung und Interaktion
- Die Ambivalenz von Schein und Sein in Kellers Novelle
- Soziale Aufstiegsmöglichkeiten und ihre Grenzen
- Die Rolle des Zufalls und der gesellschaftlichen Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der gesellschaftlichen Funktion von Mode im 19. Jahrhundert ein und stellt die zentrale Frage nach dem Einfluss der Kleidung auf den sozialen Aufstieg der Hauptfigur. Kapitel 2.1 beschreibt die Ankunft des armen Schneiders Wenzel Strapinski in Goldach. Kapitel 2.2 analysiert die Reaktion der Goldacher Bevölkerung auf Strapinskis aufgewertetes Äußeres und die daraus resultierenden Missverständnisse. Kapitel 2.3 skizziert die schrittweise Enthüllung Strapinskis wahrer Identität während des Fastnachtsfestes.
Kapitel 3 beleuchtet die vielschichtige Funktion der Kleidung in der Novelle: als Kommunikationsmittel, Statussymbol und Instrument der Täuschung. Es wird die Rolle der Kleidung im sozialen Aufstieg und der Interaktion zwischen den Figuren untersucht.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Kleider machen Leute, Mode, soziale Mobilität, Schein und Sein, Identität, Kommunikation, Gesellschaft, 19. Jahrhundert, Kleidung als Statussymbol, soziale Wahrnehmung.
- Quote paper
- Carla Pohl (Author), 2005, Die Funktion von Mode in Gottfried Kellers "Kleider machen Leute", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120878