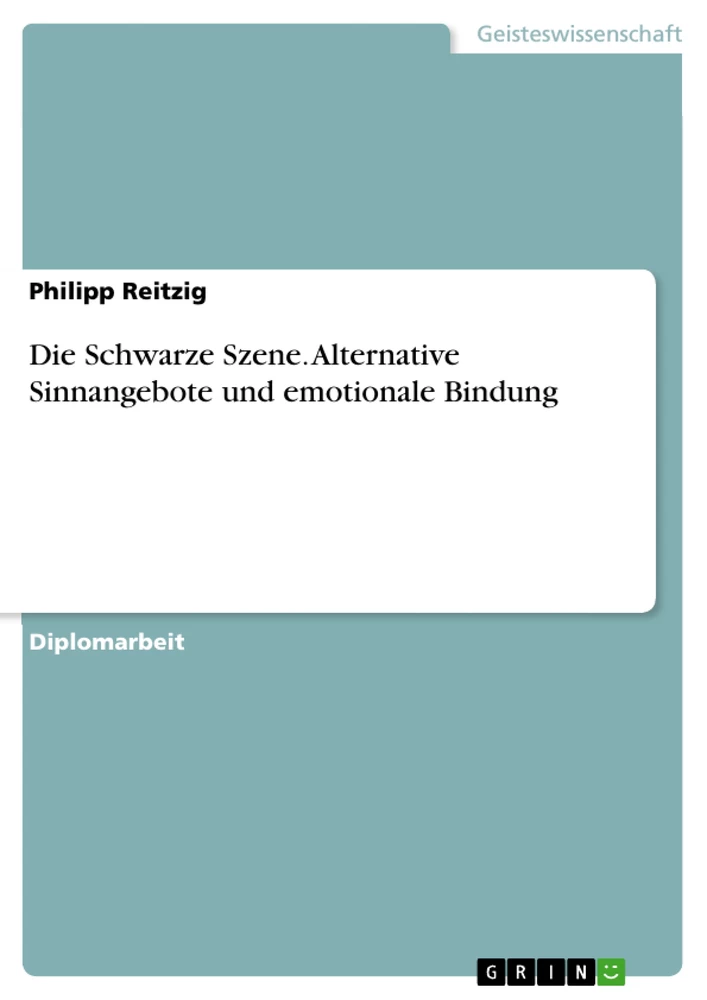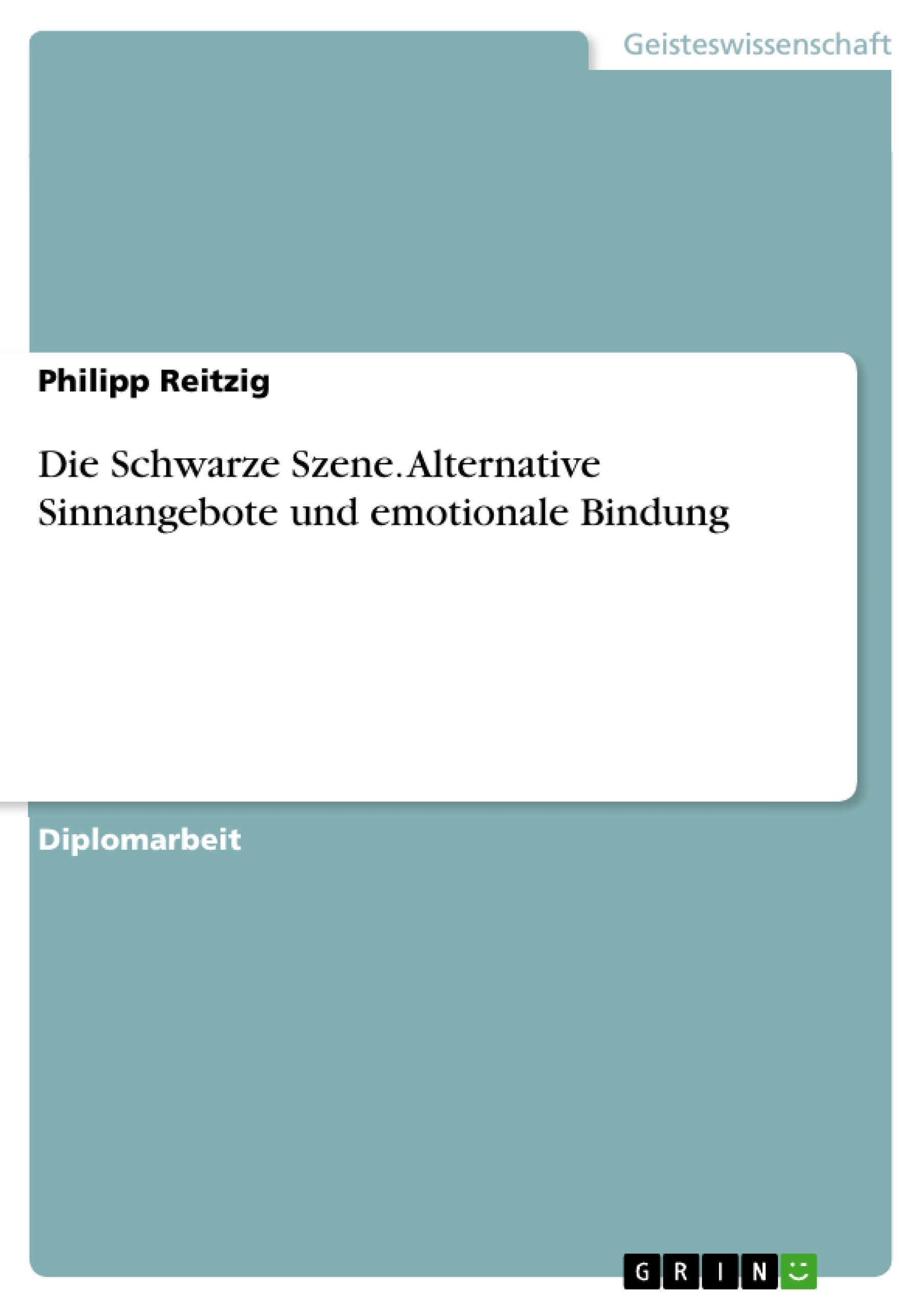Obwohl bereits einige Literatur zur Gothic-Szene, vor allem in den letzten 10 Jahren, erschienen ist, möchte ich an dieser Stelle kurz darlegen, warum mir eine neuerliche Behandlung des Themas notwendig ist. Nach Durchsicht einschlägiger Literatur zum Thema ist auffällig, dass über die Bedeutung und den Sinnzusammenhang der „Schwarzen“ Szene nur unzureichende Erkenntnisse vorliegen.
In der Literatur dominieren Szene-Beschreibungen, die aus einer rein soziologischen Betrachtungsweise heraus formuliert wurden. Dies scheint mir im Falle der Gothic-Szene vollkommen unzureichend. Es handelt sich hier nicht um eine Jugendszene wie jede andere. Vielmehr weist sie einige in der Literatur stark vernachlässigte oder häufig unterschlagene Merkmale auf. Diese sich oberflächlicher Betrachtungsweise entziehenden szenetypischen Besonderheiten, werde ich in dieser Arbeit in den Fokus rücken.
Im Mittelpunkt aller Betrachtungen steht die Frage nach den Beweggründen sich der „Schwarzen Szene“ zuzuwenden. Im Vorfeld der zu dieser Arbeit nötigen Vorbereitungen, drängten sich einige wichtige Fragen auf, deren Beantwortung sich anhand der „Basisliteratur“ nicht vollziehen ließ. Es scheint, dass diese Literatur, wenn sie von einem uninformierten Personenkreis gelesen wird, nicht dazu geeignet ist, die Schwarze Szene hinreichend zu präsentieren. Die Erklärungsmuster muten teils geradezu „naiv“ an, wenn ganz offensichtlich ist, dass diese Studien nicht aus der Szene heraus entwickelt wurden, sondern von „außen“. Bedauerlich ist, dass solche Literatur in Szenekreisen eher „lächelndes“ Missverständnis auslöst. Nun muss ich jedoch anmerken, dass die hier zitierte Literatur selbstredend nicht nur unzureichend ist. Die soziologischen Erklärungsansätze sind nachvollziehbar und entsprechen sicherlich häufig auch der Realität. Allerdings sollte daraus keine allgemeingültige Lehrmeinung abgeleitet werden.
Die Studien von Farin (1999) und Helsper (1992) sind indes ein gutes Beispiel dafür, dass sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise und individualpsychologische Sicht keine Gegensätze darstellen müssen, gleichwohl sie diesen interessanten Erkenntnissen nicht weiter folgen.
In dieser Studie werde ich dies nachholen. Dabei soll die Szene, vor allem im 6. Kapitel, aus einer stark „inneren“ und emotionalen Perspektive betrachtet werden. Zentral stelle ich hier der Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sich jemand der Schwarzen Szene anschließt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gliederung
- Die Gothic-Szene
- Definitionen und Grundbegriffe
- Die Farbe Schwarz
- Der Begriff „Gothic“
- Jugendszene
- Subkultur
- Die Schwarze Szene
- Sozialstatistik
- Szenegröße
- Geschlechterverhältnis
- Altersstruktur
- Soziale Herkunft, Bildung und Beruf
- Kleidungsstil und Ästhetik
- Politische Einstellungen
- Religion
- Freizeit
- Zentrale Werte und Gefühle
- Sozialstatistik
- Definitionen und Grundbegriffe
- Schwarze Musik
- Definition
- Die Wirkung von Musik im Allgemeinen
- Musik als Therapie
- Der Tanz
- Entwicklung der Schwarzen Musik
- Schwarze Musikstile
- Gothic-Punk / Batcave
- Gothic-Rock
- Darkwave
- Gothic-Metal
- Mittelalter
- Elektro
- EBM
- Industrial
- Industrial-Noise
- Darkelektro
- Synthie-Pop/Future-Pop
- Methodik
- Die Psychoanalyse als Methode
- Die Psychoanalyse Sigmund Freuds
- Intention und Problematik der Psychoanalyse
- Zur Methode der Biografieforschung
- Qualitatives Interview
- Der Interviewleitfaden
- Die Interviews
- Durchführung
- Zur Gesamtstrategie
- Zugang zum Forschungsfeld
- Zur Motivation des Autors
- Das Forschungsziel
- Die Hypothesen
- Die Psychoanalyse als Methode
- Die Analyse
- Zur Diagnostik und Klassifikation
- Auswertung der Hypothesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Schwarze Szene, deren Sinnzusammenhänge und emotionalen Bindungen. Ziel ist es, die psychologischen und sozialen Aspekte der Szeneteilnahme zu beleuchten und verschiedene Hypothesen zu deren Motivationen und Charakteristika zu überprüfen.
- Soziologische Charakteristika der Schwarzen Szene (demografische Daten, soziale Herkunft, etc.)
- Psychologische Aspekte der Szenezugehörigkeit (Emotionen, Motive, Identifikation)
- Die Rolle von Musik in der Schwarzen Szene (Wirkung, therapeutische Aspekte)
- Analyse von Hypothesen zur Szeneteilnahme und deren Hintergründe
- Methodische Herangehensweise und Auswertung der qualitativen Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schwarzen Szene ein und skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung und stellt die zentralen Forschungsfragen vor, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben und die zentralen Forschungsziele werden formuliert.
Die Gothic-Szene: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Gothic-Szene und die Schwarze Szene. Es werden Definitionen und Grundbegriffe erläutert, die Szene als Subkultur eingeordnet und verschiedene Aspekte wie Kleidungsstil, politische Einstellungen, Religion und Freizeitaktivitäten untersucht. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung der Szene zu anderen Jugendkulturen und der Beschreibung ihrer spezifischen Merkmale. Soziale Statistiken, wie Altersstruktur und Geschlechterverhältnis, werden analysiert, um ein umfassendes Bild der Szeneteilnehmer zu zeichnen.
Schwarze Musik: Dieses Kapitel widmet sich der Musik der Schwarzen Szene. Nach einer Definition Schwarzer Musik wird die allgemeine Wirkung von Musik, besonders im therapeutischen Kontext, beleuchtet. Die Entwicklung verschiedener Musikstile, angefangen von Gothic Rock über Darkwave bis hin zu elektronischen Stilrichtungen wie EBM und Industrial, wird nachvollzogen und in ihren jeweiligen Besonderheiten erläutert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Musik für die Identität und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Szene. Der Tanz als integraler Bestandteil der Schwarzen Musikkultur wird ebenso thematisiert.
Methodik: Das Kapitel beschreibt detailliert die angewandte Methodik der Arbeit. Es werden die psychoanalytische Perspektive, die Biografieforschung und die qualitative Interviewführung als methodische Ansätze vorgestellt und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert. Der Interviewleitfaden wird kurz erläutert, die Durchführung der Interviews beschrieben und die Gesamtstrategie der Datenauswertung dargelegt. Die Zugangswege zum Forschungsfeld und die Motivation des Autors werden transparent gemacht. Das Kapitel schliesst mit der Formulierung der Forschungsziele und der dazugehörigen Hypothesen ab.
Schlüsselwörter
Schwarze Szene, Gothic, Subkultur, Jugendszene, Sozialstatistik, Musik, Psychoanalyse, Qualitative Forschung, Interview, Identität, Emotionen, Therapie, Depressivität, Neurose, Dissozialität, Lebensereignisse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Die Schwarze Szene"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Schwarze Szene, ihre Sinnzusammenhänge und emotionalen Bindungen. Der Fokus liegt auf den psychologischen und sozialen Aspekten der Szeneteilnahme und der Überprüfung von Hypothesen zu deren Motivationen und Charakteristika.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt soziologische Charakteristika der Schwarzen Szene (demografische Daten, soziale Herkunft etc.), psychologische Aspekte der Szenezugehörigkeit (Emotionen, Motive, Identifikation), die Rolle von Musik in der Schwarzen Szene (Wirkung, therapeutische Aspekte), die Analyse von Hypothesen zur Szeneteilnahme und deren Hintergründe sowie die methodische Herangehensweise und Auswertung der qualitativen Daten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Kapitel "Die Gothic-Szene", "Schwarze Musik", "Methodik" und "Die Analyse". Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise. "Die Gothic-Szene" bietet eine umfassende Einführung in die Szene, inklusive Definitionen, sozialer Statistiken und verschiedener Aspekte wie Kleidungsstil und politische Einstellungen. "Schwarze Musik" widmet sich der Musik der Szene, ihrer Wirkung und Entwicklung verschiedener Musikstile. "Methodik" beschreibt detailliert die angewandte Methodik (Psychoanalyse, Biografieforschung, qualitative Interviews). "Die Analyse" präsentiert die Auswertung der Daten und die Überprüfung der Hypothesen.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Psychoanalyse, Biografieforschung und qualitativen Interviews basiert. Der Interviewleitfaden wird verwendet, um Daten zu sammeln und auszuwerten. Die Gesamtstrategie der Datenauswertung wird ebenfalls im Methodenkapitel erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine Analyse der soziologischen und psychologischen Aspekte der Schwarzen Szene. Die Ergebnisse der Auswertung der Hypothesen werden im Kapitel "Die Analyse" vorgestellt. Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die Motive, Emotionen und Identifikationen der Szeneteilnehmer.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schwarze Szene, Gothic, Subkultur, Jugendszene, Sozialstatistik, Musik, Psychoanalyse, Qualitative Forschung, Interview, Identität, Emotionen, Therapie, Depressivität, Neurose, Dissozialität, Lebensereignisse.
Welche Arten von Musik werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Musikstile der Schwarzen Szene, darunter Gothic-Punk/Batcave, Gothic-Rock, Darkwave, Gothic-Metal, Mittelalter-Musik und elektronische Musik wie EBM, Industrial, Industrial-Noise, Darkelektro und Synthie-Pop/Future-Pop.
Welche Aspekte der Gothic-Szene werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Definitionen und Grundbegriffe der Gothic-Szene, die Szene als Subkultur, den Kleidungsstil, die politischen Einstellungen, die Religion, Freizeitaktivitäten, soziale Statistiken (Altersstruktur, Geschlechterverhältnis, soziale Herkunft etc.) und die Abgrenzung zu anderen Jugendkulturen.
- Quote paper
- Dipl.Sozialapäd. Philipp Reitzig (Author), 2008, Die Schwarze Szene. Alternative Sinnangebote und emotionale Bindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120838