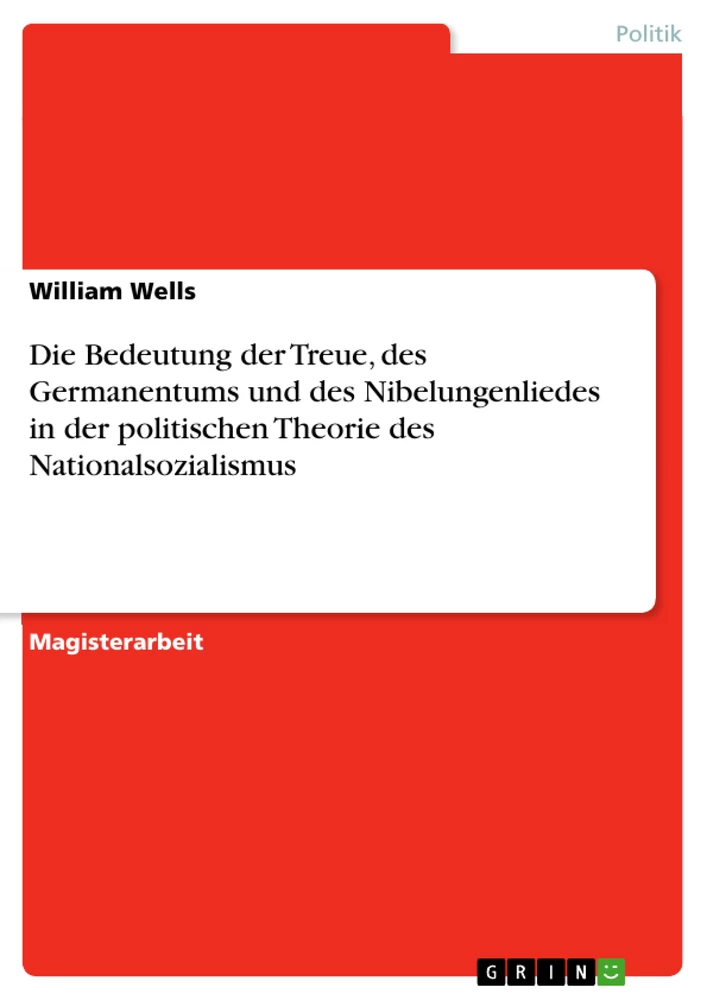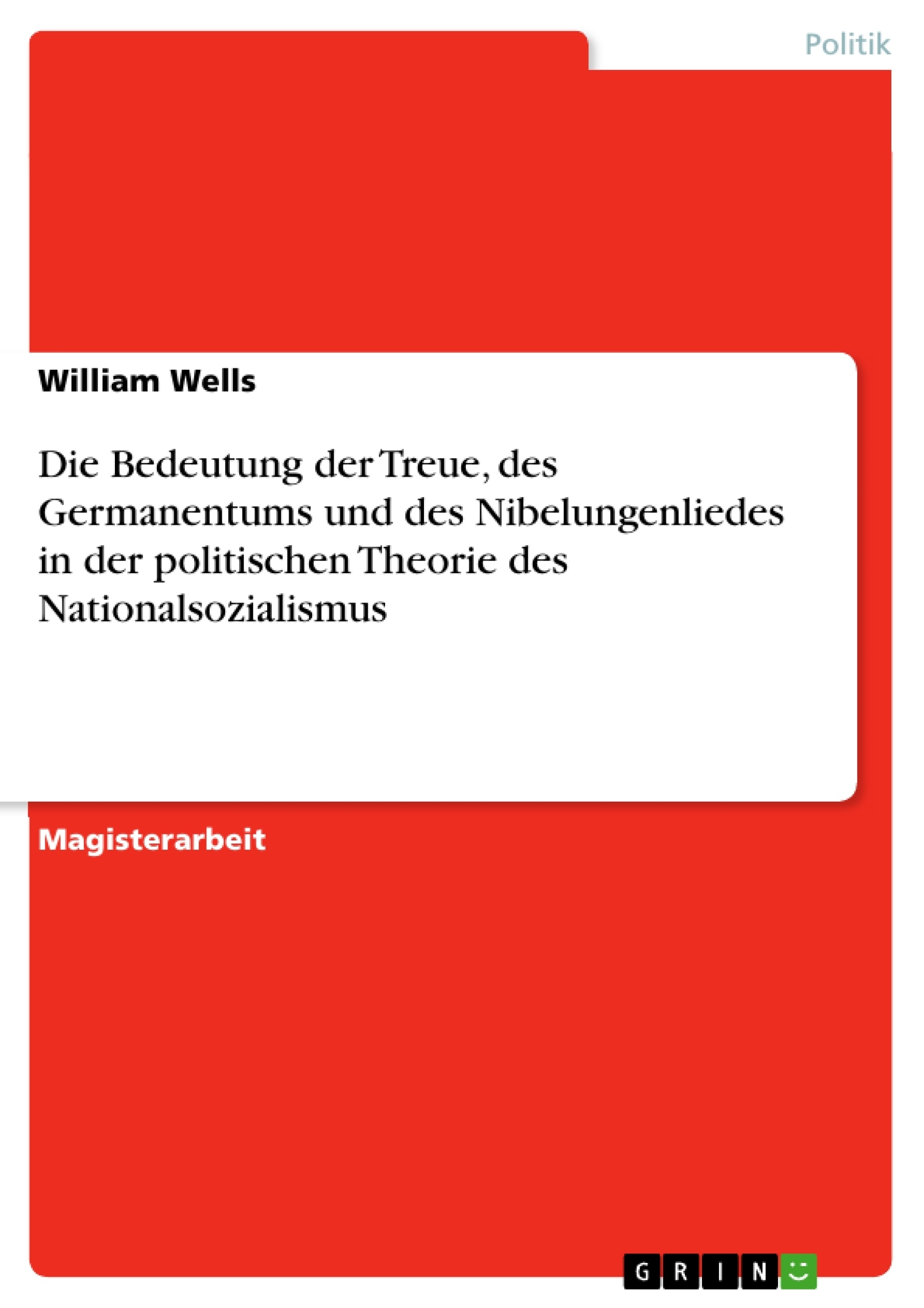Seit der „Wiederentdeckung“ des Nibelungenliedes im Jahre 1755 durch Jakob Hermann Obereit wurde es in der deutschen Geschichte oft und zu verschiedenen Zwecken herangezogen. Während zu Beginn der Erforschung und der Suche nach den verschollenen Texten das Interesse hauptsächlich daran bestand, eine neue Sichtweise des Mittelalters und seiner Gesellschaftsstruktur durch die Analyse von Originaltexten der Dichtung zu erreichen, legten spätere Verwendungen des Epos’ Wert auf die Aspekte der Herleitung einer gemeinsamen deutschen Herkunft und der Bildung eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls. In diesem Zusammenhang wurden in der Vergangenheit besonders die Tugenden, welche den „deutschen Volkscharakter“ ausmachen, gepriesen. Dies wird in folgenden Zeilen deutlich:
„Gastlichkeit, Biederkeit, Redlichkeit, Treue und Freundschaft bis in den Tod, Menschlichkeit, Milde und Großmuth in des Kampfes Noth, unerschütterlicher Standmuth, übermenschliche Tapferkeit, Kühnheit und willige Opferung für Ehre, Pflicht und Recht; Tugenden, die in der Verschlingung mit den wilden Eigenschaften und düstern Gewalten der Rache, des Zornes, des Grimmes, der Wuth und der grausen Todeslust nur noch glänzender und mannichfaltiger erscheinen, und uns, zwar trauernd und klagend, doch auch getröstet und gestärkt zurücklassen, uns mit Ergebung in das Unabwendliche, doch zugleich mit Muth zu Wort und That, mit Stolz und Vertrauen auf Vaterland und Volk, mit Hoffnung auf dereinstige Wiederkehr Deutscher Glorie und Weltherrlichkeit.“
Auf diese Weise wurde das Nibelungenlied zu Beginn des 19. Jahrhunderts verwendet, um eine vorerst „geistige Souveränität“ gegenüber den Franzosen zu wahren. Aus diesem nationalen Gedanken heraus, der von Johann Gottlieb Fichte und anderen großen deutschen Denkern ins Bewusstsein des Volkes gerufen wurde, erwuchs im Laufe des 19. Jahrhunderts die innere Kraft des deutschen Volkes, sich seine Freiheit zurück-zuerobern. Allerdings wurden bereits zu diesem Zeitpunkt die Weichen gestellt, die es über 100 Jahre später den Nationalsozialisten ermöglichen sollte, das Nibelungenlied als Medium für ihre Propaganda zu nutzen und damit die deutschen Tugenden und die glorreiche Geschichte des deutschen Volkes auf schändlichste Art zu missbrauchen.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Gedanken über die verwendeten Quellen
- III Betrachtung der Geschichte des Nibelungenliedes und seiner Wirkungsweise auf die deutsche Gesellschaft
- 3.1 Die Entstehung des Nibelungenliedes
- 3.1.1 Die Treue als Grundpfeiler der mittelalterlichen Gesellschaft
- 3.1.2 Die Bedeutung der Treue im Nibelungenlied
- 3.2 Die Zeit der „Wiederentdeckung“ (1755 – 1800)
- 3.3 Die Interpretation des Nibelungenliedes und der Treue in der Zeit von 1800 bis 1870
- 3.4 Die Bedeutung der Treue und des Nibelungenliedes während der Wilhelminischen Zeit
- 3.5 Die Zeit von 1918 – 1945
- 3.5.1 Das Nibelungenlied und die Auslegung der Treue in der Weimarer Republik
- 3.5.2 Das Nibelungenlied und die Treue in der Zeit des Nationalsozialismus
- 3.6 Erkenntnisse der Bedeutung der Treue und ihrer Vermittlung durch das Nibelungenlied
- 3.1 Die Entstehung des Nibelungenliedes
- IV Die Idee des „germanischen Staatsgedankens“ und der Begriff der Treue im Gedankengebäude des Nationalsozialismus
- 4.1 Einführende Gedanken zum germanischen Staatswesen im Nationalsozialismus
- 4.2 Grundbegriffe des germanischen Staatsgedankens
- 4.2.1 Führung und Herrschaft
- 4.2.2 Das Rechtssystem
- 4.2.3 Die Rolle des Gefolgschaftsprinzips und der Treue
- 4.2.4 Die Idee und die Weltanschauung
- 4.3 Die Bedeutung der Inhalte des germanischen Staatsgedankens im Gedankengebäude des Nationalsozialismus
- 4.3.1 Die organische Staatsphilosophie
- 4.3.1.1 Die organische Staatsrechtslehre und das Rechtssystem bei Otto von Gierke
- 4.3.1.2 Die Bedeutung des germanisch-organischen Rechtssystems im Dritten Reich
- 4.3.1.3 Der organische Gedanke im völkischen und politischen Kontext
- 4.3.2 Der germanische Begriff der Herrschaft im Nationalsozialismus
- 4.3.3 Die Weltanschauung im Nationalsozialismus
- 4.3.4 Treue und Gefolgschaft im nationalsozialistischen System
- 4.3.4.1 Die Treue
- 4.3.4.2 Die Gefolgschaft
- 4.3.1 Die organische Staatsphilosophie
- 4.4 Zusammenfassende Gedanken zu den Inhalten des germanischen Staatsgedankens im Gedankengebäude der NSDAP
- V Die Bedeutung des Nibelungenliedes und des Mythos für den Nationalsozialismus
- 5.1 Einführende Gedanken zu den Methoden der Verbreitung
- 5.2 Die Bedeutung des Nibelungenliedes
- 5.3 Die Bedeutung des Mythos
- 5.4 Abschließende Gedanken zum Nibelungenlied und zum Mythos
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Nibelungenliedes und des Begriffs der Treue in der politischen Theorie des Nationalsozialismus. Sie analysiert, wie das Epos instrumentalisiert wurde, um nationalistische und völkische Ideologien zu stützen.
- Die Entwicklung des Verständnisses des Nibelungenliedes im Laufe der deutschen Geschichte.
- Die Rolle der Treue als zentrales Motiv im Nibelungenlied und ihre Interpretation im Kontext verschiedener Epochen.
- Die Adaption des "germanischen Staatsgedankens" durch die Nationalsozialisten und seine Verbindung zum Nibelungenlied.
- Die Propagandistische Nutzung des Nibelungenliedes durch das NS-Regime.
- Die Verbindung zwischen Mythos, Treue und nationalsozialistischer Ideologie.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung skizziert die vielschichtige Geschichte der Rezeption des Nibelungenliedes in Deutschland, von seiner „Wiederentdeckung“ bis zu seiner instrumentalisierten Verwendung im Nationalsozialismus. Sie hebt die Bedeutung der Treue als zentrales Thema hervor und deutet den späteren Missbrauch dieses Motivs durch das NS-Regime an. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des Nibelungenliedes in der nationalsozialistischen Propaganda und deren ideologischen Kontext.
III Betrachtung der Geschichte des Nibelungenliedes und seiner Wirkungsweise auf die deutsche Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Interpretation des Nibelungenliedes von seiner Entstehung bis in die Zeit des Nationalsozialismus. Es untersucht, wie der Begriff der Treue in verschiedenen Epochen verstanden und gedeutet wurde und wie dies die spätere Instrumentalisierung des Epos beeinflusste. Besonders wird die Entwicklung vom Interesse an der mittelalterlichen Gesellschaftsstruktur hin zur Konstruktion eines nationalen Selbstverständnisses mittels der „deutschen Tugenden“ beleuchtet. Der Wandel von einer eher wissenschaftlich-historischen Betrachtung hin zur nationalistischen Aneignung des Epos bildet den roten Faden dieses Kapitels.
IV Die Idee des „germanischen Staatsgedankens“ und der Begriff der Treue im Gedankengebäude des Nationalsozialismus: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des "germanischen Staatsgedankens" im Nationalsozialismus und seiner Verbindung zur Idee der Treue. Es untersucht die Konzepte von Führung, Herrschaft, Rechtssystem und Gefolgschaft im nationalsozialistischen Kontext und analysiert, wie diese Konzepte mit der Vorstellung einer organischen Staatsordnung verbunden waren. Die Kapitel beleuchtet die Rolle von Denkern wie Otto von Gierke und ihre Einflüsse auf die nationalsozialistische Ideologie, insbesondere im Hinblick auf die Rechtfertigung von Herrschaft und Unterordnung mittels der Idee der „organischen Gemeinschaft“. Die Interpretation der Treue als unbedingte Gefolgschaft und Loyalität gegenüber dem Führer bildet den Kern dieses Kapitels.
V Die Bedeutung des Nibelungenliedes und des Mythos für den Nationalsozialismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Nutzung des Nibelungenliedes als Propagandainstrument im Nationalsozialismus. Es analysiert die Methoden der Verbreitung nationalistischer Ideale mithilfe des Epos und beleuchtet die Bedeutung des Nibelungenliedes im Kontext der nationalsozialistischen Mythenbildung. Der Fokus liegt auf der gezielten Instrumentalisierung des Epos und seiner zentralen Motive, um die gewünschten politischen und ideologischen Ziele zu erreichen. Die Verbindung von Geschichte, Mythos und Propaganda wird eingehend untersucht, um den Wirkungsmechanismus dieser Strategie zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Treue, Germanentum, Nationalsozialismus, Propaganda, Mythos, Staatsgedanke, organische Staatsphilosophie, Gefolgschaft, ideologische Instrumentalisierung, deutsche Geschichte, Volkscharakter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nibelungenlied und dem Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Nibelungenliedes und des Begriffs der Treue in der politischen Theorie des Nationalsozialismus. Sie analysiert, wie das Epos instrumentalisiert wurde, um nationalistische und völkische Ideologien zu stützen und beleuchtet die Entwicklung des Verständnisses des Nibelungenliedes im Laufe der deutschen Geschichte, die Rolle der Treue als zentrales Motiv und ihre Interpretation in verschiedenen Epochen, die Adaption des "germanischen Staatsgedankens" durch die Nationalsozialisten und seine Verbindung zum Nibelungenlied, die propagandistische Nutzung des Nibelungenliedes durch das NS-Regime sowie die Verbindung zwischen Mythos, Treue und nationalsozialistischer Ideologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I (Einleitung) skizziert die Rezeption des Nibelungenliedes und seine Instrumentalisierung im Nationalsozialismus. Kapitel III analysiert die Entwicklung der Interpretation des Nibelungenliedes von seiner Entstehung bis zum Nationalsozialismus, insbesondere die Rolle des Treue-Begriffes in verschiedenen Epochen. Kapitel IV widmet sich dem "germanischen Staatsgedanken" im Nationalsozialismus und seiner Verbindung zur Treue, untersucht Konzepte von Führung, Herrschaft und Gefolgschaft und beleuchtet die Rolle von Denkern wie Otto von Gierke. Kapitel V befasst sich mit der konkreten Nutzung des Nibelungenliedes als Propagandainstrument im Nationalsozialismus und seiner Rolle in der nationalsozialistischen Mythenbildung.
Welche Rolle spielte der Begriff der "Treue" in der Arbeit?
Der Begriff der "Treue" ist ein zentrales Thema der Arbeit. Sie untersucht, wie das Motiv der Treue im Nibelungenlied interpretiert wurde und wie diese Interpretationen im Laufe der deutschen Geschichte, besonders im Kontext des Nationalsozialismus, instrumentalisiert wurden, um nationalistische und völkische Ideologien zu stützen. Die Arbeit zeigt auf, wie die "Treue" im nationalsozialistischen Kontext zur unbedingten Gefolgschaft und Loyalität gegenüber dem Führer umgedeutet wurde.
Wie wurde das Nibelungenlied im Nationalsozialismus verwendet?
Das Nibelungenlied wurde im Nationalsozialismus als Propagandainstrument verwendet, um nationalistische und völkische Ideologien zu stützen. Die Arbeit analysiert die Methoden der Verbreitung dieser Ideale mithilfe des Epos und beleuchtet die Bedeutung des Nibelungenliedes im Kontext der nationalsozialistischen Mythenbildung. Es wird gezeigt, wie das Epos und seine zentralen Motive gezielt instrumentalisiert wurden, um die politischen und ideologischen Ziele des NS-Regimes zu erreichen.
Welche Bedeutung hatte der "germanische Staatsgedanke" im Nationalsozialismus?
Der "germanische Staatsgedanke" spielte eine wichtige Rolle in der nationalsozialistischen Ideologie. Die Arbeit analysiert seine Verbindung zur Idee der Treue und untersucht Konzepte von Führung, Herrschaft, Rechtssystem und Gefolgschaft im nationalsozialistischen Kontext. Es wird gezeigt, wie diese Konzepte mit der Vorstellung einer organischen Staatsordnung verbunden waren und wie sie zur Rechtfertigung von Herrschaft und Unterordnung dienten. Die Einflüsse von Denkern wie Otto von Gierke auf die nationalsozialistische Ideologie werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit charakterisieren, sind: Nibelungenlied, Treue, Germanentum, Nationalsozialismus, Propaganda, Mythos, Staatsgedanke, organische Staatsphilosophie, Gefolgschaft, ideologische Instrumentalisierung, deutsche Geschichte, Volkscharakter.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Rolle des Nibelungenliedes in der nationalsozialistischen Propaganda und dessen ideologischen Kontext. Die Arbeit untersucht, wie das Epos instrumentalisiert wurde und wie seine Interpretationen im Laufe der deutschen Geschichte die spätere nationalsozialistische Aneignung beeinflussten.
- Quote paper
- William Wells (Author), 2004, Die Bedeutung der Treue, des Germanentums und des Nibelungenliedes in der politischen Theorie des Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120765