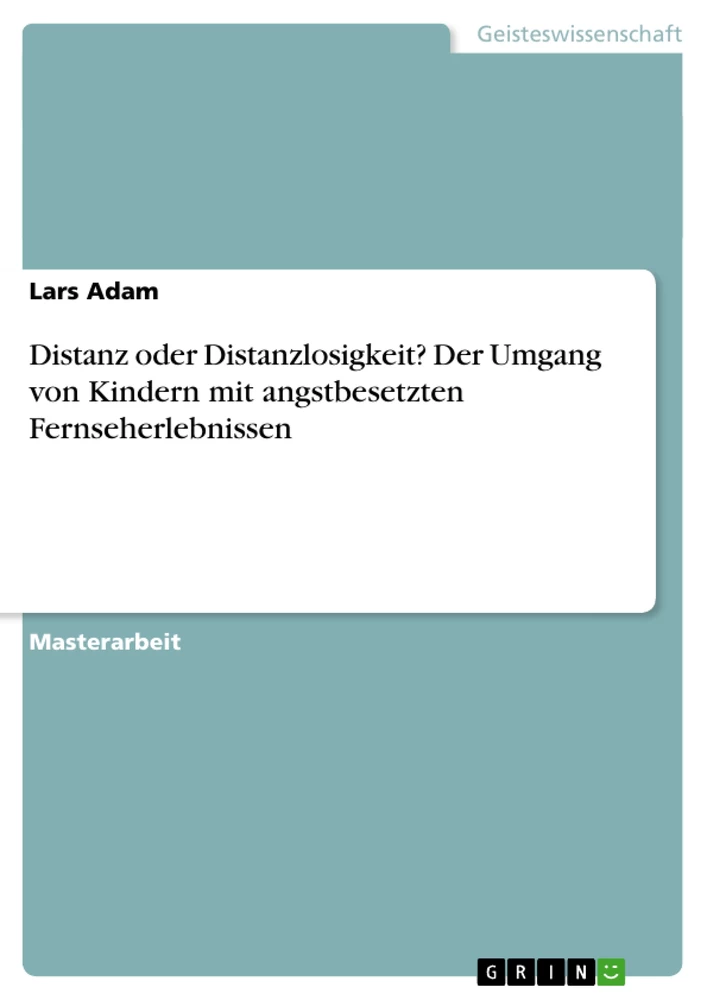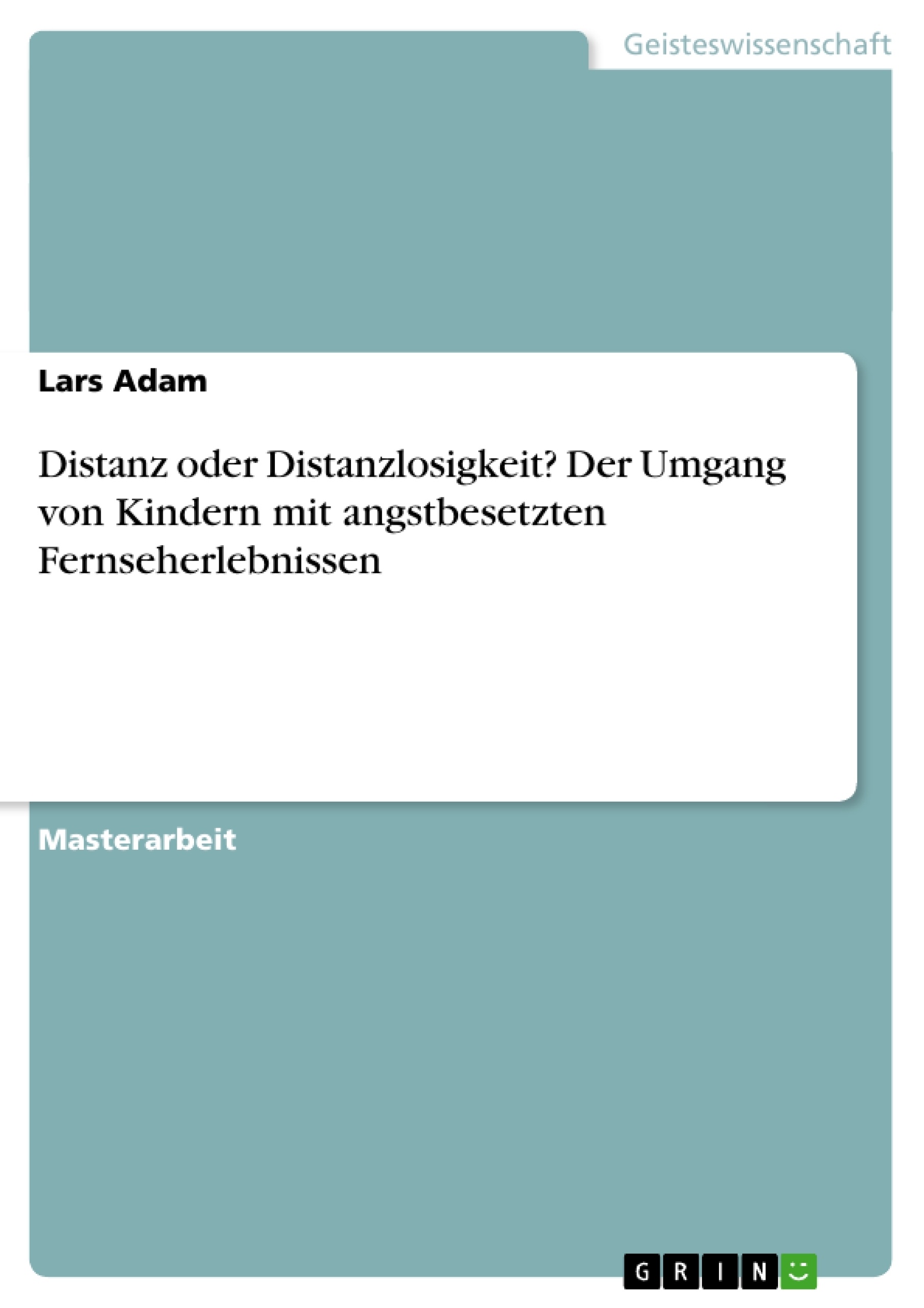„Man sollte sich mal wirklich vorstellen, wenn es kein Fernsehen gäbe, dann hätten Kinder gewiss nicht so viel Angst und wir müssten uns als Eltern nicht ständig fragen, wie sie diese Horrorfilme verkraften oder wie sie damit umgehen oder so. Und Sie müssten dann auch nicht über so ein Thema Ihre Abschlussarbeit schreiben. Bei uns Zuhause erlaube ich meinen Kindern nur wenig fern zu sehen, meistens dann mittags – abends sowieso nicht, da läuft nur Schrott und sowieso nichts für Kinder. Als unsere Kleinste mal einen Horrorfilm geguckt hat, da kam sie ganz verängstigt zu mir ins Bett, seitdem laufen bei uns solche Filme nicht mehr.“
Dieses Zitat einer vom Verfasser im Rahmen seiner Untersuchung befragten Lehrerin kann durchaus als symptomatisch für die Sorgen und Befürchtungen vieler Eltern im Zusammenhang mit dem Fernsehkonsum ihrer Kinder gelten. In zahlreichen Diskussionen um das Verhältnis von Kindern und Fernsehen wird immer wieder die Frage erhoben, ob und inwieweit das Fernsehen überhaupt in die Lebenswelt der Kinder hinein gehören sollte, und ob die Begegnung mit bestimmten Fernsehformaten negativ Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern haben könnte. Viele Eltern und Erzieher ziehen daraus die Konsequenz, Kinder von bestimmten Formaten fernzuhalten oder das Fernsehen sogar ganz zu verbieten. Zwar sind diese Reaktionen aus Sicht der Eltern durchaus nachvollziehbar, die Erkenntnisse, die im Verlauf der hier vorliegenden Arbeit zutage treten werden, lassen indes eine differenziertere Vorgehensweise in diesem Bereich als effektivere Maßnahme erscheinen. Das Fernsehen ist aus unserer Lebenswelt kaum mehr wegzudenken, das schließt die Lebenswelt von Kindern selbstverständlich mit ein. Fernsehen ist eine beliebte und verbreitete Freizeitbeschäftigung und fasziniert Kinder aus unterschiedlichen Gründen. Dabei werden sie mit einer Vielzahl an Emotionen konfrontiert, zu denen auch die Angst gehört. Die Vorstellung vieler Erwachsener, das Fernsehen würde Ängste und Verunsicherungen bei Kindern erst hervorrufen, mit denen sie anderweitig gar nicht konfrontiert würden, entspricht keinesfalls der Realität. Kinder reagieren vor allem dann verstärkt mit Angst, wenn die Bilder, denen sie im Fernsehen begegnen, Anknüpfungspunkte an ihre persönliche Umwelt und Realität bieten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Angst
- Normale und pathologische Angst
- Definition Angst
- Wissenschaftliche Theorien zur Entstehung von Angst
- Kognitionstheoretische Ansätze
- Zwei Faktoren-Theorie der Emotionen
- Das kognitive-emotionale Prozessmodell von Lazarus
- Angst bei Kindern
- Begriffliche Unterscheidungen der Angst
- Angst und Furcht
- Angst als Zustand und Angst als Persönlichkeitsmerkmal
- Zusammenfassung
- Fernsehnutzung und Angst bei Kindern
- Empirische Daten zur Fernsehnutzung
- Generelle Verbreitung und Nutzung des Fernsehens
- Fernsehnutzung im Wochen- und Tagesverlauf
- Sparten und Senderpräferenzen
- Generelle Verbreitung von Angst im Fernsehen
- Kritik
- Nutzungsmotive
- Uses and Gratification Ansatz
- Die Mood-Management Theorie
- Excitation-Transfer-Theorie
- Affektive Dispositionstheorie
- Angstbewältigung und Angstlust
- Angstnutzen? Angst nutzen!
- Zusammenfassung
- Empirische Daten zur Fernsehnutzung
- Kinder: Angstwahrnehmung und Umgangsweisen
- Die kognitive Entwicklung
- Die Bedeutung der kognitiven Entwicklung für das Fernsehen und deren Angstwahrnehmung
- Zum Fernsehverständnis des Kleinkindes
- Zum Fernsehverständnis der Zwei bis Siebenjährigen
- Zum Fernsehverständnis der Sieben bis Zehnjährigen
- Zum Fernsehverständnis der Zehn bis Zwölfjährigen
- Der Einfluss des Fernsehens auf die Wahrnehmung
- Der Umgang mit Angst beim Fernsehen
- Mögliche Umgangsformen während der Fernsehrezeption
- Empirische Betrachtungsweise
- Angstbewältigungstypen
- Mögliche Umgangsweisen nach der Rezeption
- Weitere Einflüsse auf die Wahrnehmung und dem Umgang mit Ängsten beim Fernsehen
- Zusammenfassung
- Die kognitive Entwicklung
- Forschungsdesign und Durchführung
- Forschungsinteresse und Fragestellung der Arbeit
- Untersuchungsgruppe
- Erhebungsmethode
- Problemzentriertes Interview
- Bilder
- Vorbereitung der Erhebung
- Die Haltung des Interviewers zum Kind
- Fragen für das Interview
- Kinder sind die Experten
- Der Pretest
- Der Orientierungsleitfaden
- Zugang zum Feld
- Der Unterricht
- Die Durchführung der Erhebung
- Das Einzelinterview
- Erhebung von Kontextdaten
- Das Datenmaterial
- Beschreibung der Stichprobe
- Vorstellung der Probanden
- Die Auswertungsmethode
- Datenaufzeichnung und Transkription
- Die Auswertungsmethode
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Was Kinder beim Fernsehen beängstigt
- Wie Kinder mit Ängsten beim Fernsehen umgehen
- Wie Kinder mit angstbesetzten Fernseherlebnissen nach der Fernseh-Rezeption umgehen
- Einflüsse auf die Angstwahrnehmung und deren Umgangsweise beim Fernsehen
- Wünsche der Kinder an die Eltern
- Zusammenfassung und Diskussion zentraler Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Umgang von Kindern mit angstbesetzten Fernseherlebnissen. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die Angstwahrnehmung von Kindern im Kontext des Fernsehens zu entwickeln und ihre verschiedenen Umgangsstrategien zu analysieren. Die Studie beleuchtet den Einfluss kognitiver Entwicklungsstufen auf die Verarbeitung von angstauslösenden Inhalten.
- Angstverarbeitung bei Kindern im Kontext des Fernsehens
- Kognitive Entwicklung und Fernsehwahrnehmung
- Umgangsstrategien mit angstbesetzten Fernseherlebnissen
- Einflussfaktoren auf die Angstwahrnehmung
- Eltern-Kind-Interaktion im Umgang mit Fernsehängsten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung des Umgangs von Kindern mit angstbesetzten Fernseherlebnissen. Sie beleuchtet die Sorgen von Eltern und Erziehern bezüglich des Fernsehkonsums und zeigt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise auf. Die Arbeit verdeutlicht, dass Fernsehen ein integraler Bestandteil der kindlichen Lebenswelt ist und Kinder mit einer Vielzahl von Emotionen, darunter auch Angst, konfrontiert werden.
Angst: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über den Begriff der Angst, von der Definition über wissenschaftliche Theorien zu ihrer Entstehung bis hin zu spezifischen Aspekten der Angst bei Kindern. Es werden verschiedene Theorien der Angstentstehung beleuchtet und begriffliche Unterscheidungen, wie Angst und Furcht oder Angst als Zustand und Persönlichkeitsmerkmal, herausgearbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis von kindlicher Angst und ihrer spezifischen Ausprägungen.
Fernsehnutzung und Angst bei Kindern: Dieses Kapitel analysiert die Fernsehnutzung von Kindern und deren Zusammenhang mit Angst. Es werden empirische Daten zur Verbreitung und Nutzung des Fernsehens bei Kindern präsentiert und verschiedene Nutzungsmotive im Kontext der Angst betrachtet. Theorien wie der Uses and Gratification Ansatz, die Mood-Management Theorie und die Affektive Dispositionstheorie werden in Bezug auf die Fernsehnutzung und die Rolle der Angst diskutiert. Der Abschnitt "Angstnutzen? Angst nutzen!" untersucht die paradoxe Beziehung zwischen Angst und der aktiven Suche nach angstauslösenden Inhalten.
Kinder: Angstwahrnehmung und Umgangsweisen: Dieses Kapitel befasst sich mit der kognitiven Entwicklung von Kindern und deren Einfluss auf die Wahrnehmung und den Umgang mit angstbesetzten Fernseherlebnissen. Es werden verschiedene Altersgruppen und ihre spezifischen Fernsehverständnisse betrachtet und der Einfluss des Fernsehens auf die Wahrnehmung von Angst analysiert. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Umgangsformen von Kindern mit Angst, sowohl während als auch nach der Fernsehrezeption. Weitere Einflüsse wie die Rolle der Eltern und des sozialen Umfelds werden ebenfalls diskutiert.
Forschungsdesign und Durchführung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es werden das Forschungsinteresse und die Fragestellungen der Arbeit dargelegt, die Untersuchungsgruppe vorgestellt und die gewählte Erhebungsmethode (problemzentrierte Interviews und Bilder) erläutert. Die Vorbereitung der Erhebung, die Durchführung der Interviews und die Auswertungsmethode werden umfassend dargestellt. Die Stichprobenbeschreibung und die Vorstellung der Probanden geben Einblicke in die Zusammensetzung der untersuchten Gruppe.
Auswertung und Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es wird analysiert, was Kinder beim Fernsehen beängstigt, wie sie mit Ängsten umgehen und wie sie nach der Fernsehrezeption mit angstbesetzten Erlebnissen verfahren. Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Angstwahrnehmung und den Umgang damit wird diskutiert, und die Wünsche der Kinder an ihre Eltern werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kinder, Angst, Fernsehen, Fernsehnutzung, Angstwahrnehmung, kognitive Entwicklung, Umgangsstrategien, Medienrezeption, Empirie, qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umgang von Kindern mit angstbesetzten Fernseherlebnissen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Umgang von Kindern mit angstbesetzten Fernseherlebnissen. Sie zielt darauf ab, die Angstwahrnehmung von Kindern im Kontext des Fernsehens zu verstehen und deren verschiedene Umgangsstrategien zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss der kognitiven Entwicklung auf die Verarbeitung angstauslösender Inhalte im Fernsehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Angstverarbeitung bei Kindern und Fernsehen, kognitive Entwicklung und Fernsehwahrnehmung, Umgangsstrategien mit angstbesetzten Fernseherlebnissen, Einflussfaktoren auf die Angstwahrnehmung (z.B. Alter, kognitive Entwicklung, soziale Umgebung), und die Eltern-Kind-Interaktion im Umgang mit Fernsehängsten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Angst (Definition, Theorien, Angst bei Kindern), Fernsehnutzung und Angst bei Kindern (empirische Daten, Nutzungsmotive), Kinder: Angstwahrnehmung und Umgangsweisen (kognitive Entwicklung, Umgang mit Angst während und nach der Rezeption), Forschungsdesign und Durchführung (Methodologie, Stichprobe, Datenerhebung und -auswertung), Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, und Zusammenfassung und Diskussion zentraler Ergebnisse.
Welche Methode wurde für die Studie verwendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode, genauer problemzentrierte Interviews mit Kindern, ergänzt durch die Verwendung von Bildern. Der Ablauf umfasste die Vorbereitung (Haltung des Interviewers, Fragen, Pretest, Orientierungsleitfaden), die Durchführung der Einzelinterviews mit Erhebung von Kontextdaten, sowie die Auswertung der Daten (Transkription, Auswertungsverfahren).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen, was Kinder beim Fernsehen beängstigt, wie sie mit Ängsten umgehen (während und nach der Fernsehrezeption), welche Einflüsse die Angstwahrnehmung und den Umgang damit beeinflussen, und welche Wünsche die Kinder an ihre Eltern haben. Die detaillierte Auswertung und Interpretation der Ergebnisse sind im entsprechenden Kapitel dargestellt.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht verschiedene Theorien mit ein, darunter kognitionstheoretische Ansätze zur Angstentstehung, die Zwei-Faktoren-Theorie der Emotionen, das kognitive-emotionale Prozessmodell von Lazarus, den Uses and Gratification Ansatz, die Mood-Management Theorie, die Excitation-Transfer-Theorie und die Affektive Dispositionstheorie im Kontext der Fernsehnutzung.
Für welche Zielgruppe ist die Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studenten, Eltern und Erzieher, die sich für den Umgang von Kindern mit Angst im Kontext des Fernsehens interessieren. Sie bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Erkenntnisse zu diesem Thema.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinder, Angst, Fernsehen, Fernsehnutzung, Angstwahrnehmung, kognitive Entwicklung, Umgangsstrategien, Medienrezeption, Empirie, qualitative Forschung, Problemzentriertes Interview.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Angst im Allgemeinen und im Kontext des Fernsehens. Anschließend werden die Methodik, die Ergebnisse und die Diskussion der Ergebnisse vorgestellt. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung.
- Quote paper
- M.A. Lars Adam (Author), 2008, Distanz oder Distanzlosigkeit? Der Umgang von Kindern mit angstbesetzten Fernseherlebnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120616