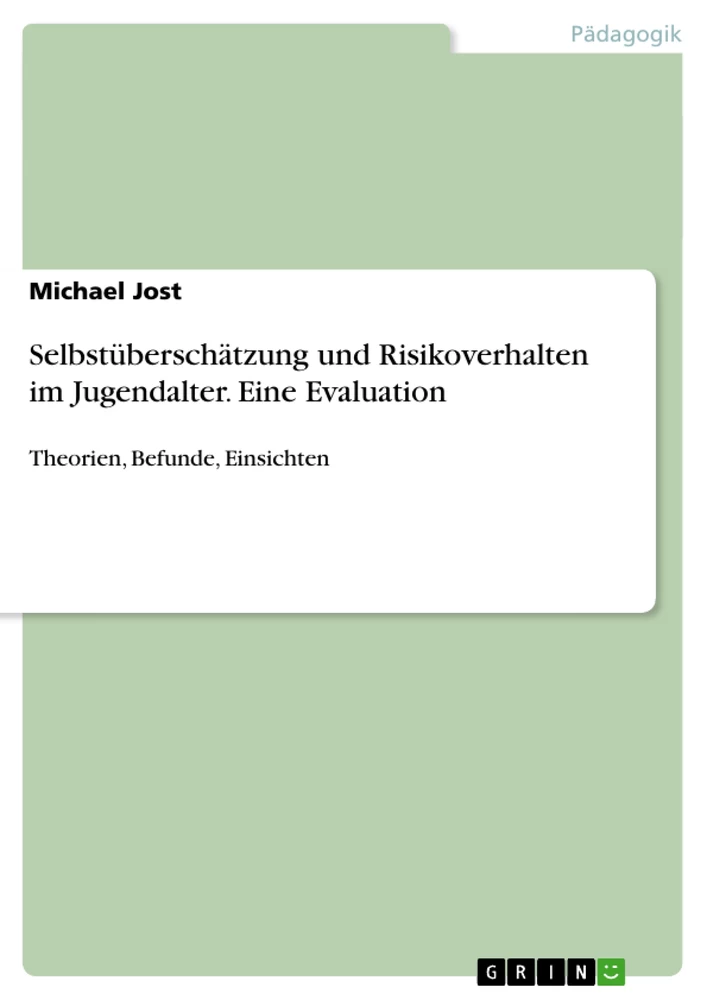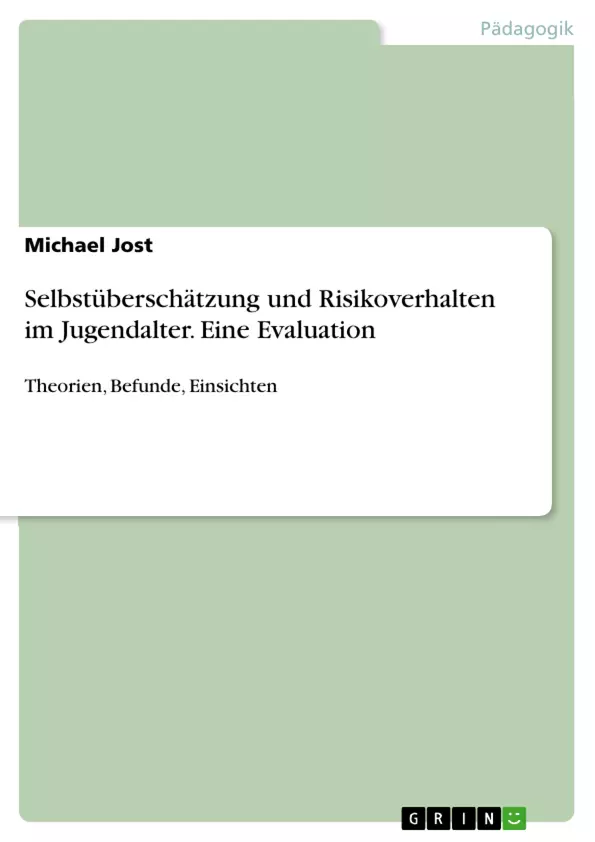Jugendliches Risikoverhalten und die offenbar jugendspezifische Neigung zur Selbstüberschätzung scheinen untrennbar miteinander verbunden zu sein. Ausgehend von seiner quantitativ angelegten Feldstudie, untersucht der Autor dieses Spannungsfeld und stellt Theorien, weitere aktuelle Forschungsarbeiten und Befunde dar, aus denen Einsichten jenseits der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmungsschemata abgeleitet werden. Als paradigmatischer Bezugsrahmen dienen vornehmlich die Schulen der Entwicklungspsychologie und Tiefenpsychologie. Die Besprechung des Forschungsstandes berücksichtigt Studien aus Skandinavien, den USA und Deutschland.
extauszug: Die Phase des Jugendalters birgt im Kanon der menschlichen Genese elementare physiologische, psychische und psycho-soziale Entwicklungsaufgaben und wird – nicht zuletzt aufgrund dessen – von zahlreichen Herausforderungen, Erfahrungen und Unwegsamkeiten begleitet (vgl. Brandtstädter 1985, S. 5 ff). Das Entwickeln des Selbst- und des Fremdbildes, das Suchen und Finden einer klaren Abgrenzung des Ichs vom Anderen oder – allgemeiner formuliert – die Genese einer stabilen und gesunden Persönlichkeit, gehören zu den wesentlichsten dieser Aufgaben. Die Zeit der Jugend wird zudem als eine Zeit des Übergangs charakterisiert, als eine Zeit, in welcher der Jugendliche die geschützte, klar gegliederte Welt der Kindheit verlässt und sich mit einem uneindeutigen, komplexen Universum des Erwachsenseins konfrontiert sieht (vgl. Teen Assessment Project 2000, S. 171).
... Dass derartige Entwicklungsleistungen und -herausforderungen nicht zwangsläufig unproblematisch verlaufen, scheint evident zu sein. Insbesondere die Begriffe des „Risikoverhaltens“ und der „Selbstüberschätzung“ werden häufig miteinander in Bezug gesetzt und als jugendspezifisch beschrieben (vgl. Berger 1998, S. 416 f). Jugendliche überschätzen sich und ihre Fähigkeiten offenbar, scheinen zu einer überhöhten Selbstsicht zu neigen, die bis zu einer Ausblendung der konkret realen Gefahrensituation führen kann, und begeben sich, u.a. auch dadurch bedingt, häufiger in riskante Situationen. In der Regel verlaufen diese, vielfach als Mutproben gestalteten Aktivitäten, ohne weitere Folgen für die Jugendlichen und geben ihnen die Möglichkeit, eigene Grenzen auszuloten und – damit einhergehend – ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen.
Mitunter werden sie jedoch Opfer dieser Dynamik und gefährden sich und andere nachhaltig.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- 1. Untersuchungsgegenstand
- 2. Fragestellung und Hypothese
- 3. Stand der Forschung
- B. Jugendspezifische Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens
- 1. Bestimmung und Verwendung des Jugendbegriffs und seines Umfeldes
- 1.1 Allgemeine Definition des Jugendalters
- 1.2 Sozialgeschichtliche Wurzeln des Jugendalters
- 1.3 Aktuelle juristische Aspekte
- 1.4 Aktuelle demografische Parameter
- 1.5 Pubertät, Adoleszenz, Jugend
- 2. Risikobegriff, Formen und Folgen jugendlichen Risikoverhaltens
- 3. Paradigmatische Zugänge: Jugendliches Risikoverhalten sehen
- C. Quantitative Untersuchung zur Symptomatik einer jugendspezifischen Selbstüberschätzung
- 1. Stichproben
- 2. Untersuchungsinstrumente
- 3. Modus/Procedere
- 4. Untersuchungsergebnisse
- 5. Zusammenführung der Untersuchungsergebnisse
- 6. Abschließende Betrachtung der Ergebnisse
- D. Diskussion der Ergebnisse
- E. Kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns/Ausblick
- F. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die jugendspezifische Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens. Ziel ist die detaillierte Abbildung des Themenfeldes mittels quantitativer Forschung. Die Arbeit analysiert die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen im Hinblick auf verschiedene Risikobereiche und vergleicht diese mit der Einschätzung Erwachsener.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Jugend" in seinen verschiedenen Facetten.
- Analyse des Risikoverhaltens von Jugendlichen und dessen Ursachen und Folgen.
- Entwicklung und Anwendung eines quantitativen Forschungsdesigns zur Erhebung der Selbstüberschätzung.
- Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzung von Jugendlichen in verschiedenen Risikosituationen.
- Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die bestehende Forschung und mögliche Implikationen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel legt den Untersuchungsgegenstand, die Forschungsfrage und die Hypothese der Studie dar. Es liefert einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Selbstüberschätzung und Risikoverhalten bei Jugendlichen und beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit.
B. Jugendspezifische Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst den Jugendbegriff in seinen gesellschaftlichen, juristischen und demografischen Aspekten. Anschließend wird der Risikobegriff definiert und verschiedene Formen jugendlichen Risikoverhaltens sowie deren Folgen beschrieben. Schließlich werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Risikoverhalten vorgestellt, um einen Rahmen für die empirische Untersuchung zu schaffen. Die Kapitelteile beleuchten das Jugendalter aus verschiedenen Blickwinkeln und ebnen den Weg für die quantitative Analyse, indem sie die theoretischen Grundlagen und den Kontext definieren.
C. Quantitative Untersuchung zur Symptomatik einer jugendspezifischen Selbstüberschätzung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Studie. Es beinhaltet die Darstellung der Stichproben (Jugendliche und eine Vergleichsgruppe Erwachsener), die Beschreibung der verwendeten Fragebögen und die Darstellung des Erhebungsverfahrens. Die statistischen Methoden und die Vorgehensweise bei der Datenanalyse werden erläutert, bevor die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der transparenten und nachvollziehbaren Darstellung der Forschungsmethodik und der daraus gewonnenen Daten. Die detaillierte Beschreibung der Stichproben, der Fragebögen und des statistischen Vorgehens gewährleistet die Reproduzierbarkeit der Studie und die Validität der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Jugendspezifische Selbstüberschätzung, Risikoverhalten, Jugend, quantitative Forschung, Selbstwahrnehmung, Gefahrenwahrnehmung, Empirie, Vergleichsgruppe, Statistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Jugendspezifische Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die jugendspezifische Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens. Sie analysiert die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen im Hinblick auf verschiedene Risikobereiche und vergleicht diese mit der Einschätzung Erwachsener.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Jugend", analysiert das Risikoverhalten von Jugendlichen und dessen Ursachen und Folgen, entwickelt und wendet ein quantitatives Forschungsdesign zur Erhebung der Selbstüberschätzung an und vergleicht die Selbst- und Fremdeinschätzung von Jugendlichen in verschiedenen Risikosituationen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die bestehende Forschung und mögliche Implikationen diskutiert.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Dissertation verwendet eine quantitative Forschungsmethode. Es wird eine detaillierte Beschreibung der Stichproben (Jugendliche und eine Vergleichsgruppe Erwachsener), der verwendeten Fragebögen und des Erhebungsverfahrens geliefert. Die statistischen Methoden und die Vorgehensweise bei der Datenanalyse werden transparent dargestellt, um die Reproduzierbarkeit der Studie und die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Wie ist die Dissertation strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: Einleitung (mit Untersuchungsgegenstand, Fragestellung, Hypothese und Stand der Forschung), Kapitel zur jugendspezifischen Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens (mit Definition des Jugendbegriffs, Risikobegriff und theoretischen Ansätzen), Kapitel zur quantitativen Untersuchung (mit Beschreibung der Methodik, Ergebnisse und deren Interpretation), Diskussion der Ergebnisse, kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns und Ausblick, sowie abschließende Bemerkungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Jugendspezifische Selbstüberschätzung, Risikoverhalten, Jugend, quantitative Forschung, Selbstwahrnehmung, Gefahrenwahrnehmung, Empirie, Vergleichsgruppe, Statistik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Dissertation?
Ziel der Dissertation ist die detaillierte Abbildung des Themenfeldes mittels quantitativer Forschung. Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Selbstüberschätzung bei Jugendlichen und deren Zusammenhang mit Risikoverhalten leisten.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Die Dissertation umfasst Kapitel zu Einleitung, Jugendspezifischer Selbstüberschätzung im Kontext jugendlichen Risikoverhaltens (Definition von Jugend und Risiko, theoretische Ansätze), Quantitativer Untersuchung (Methodik, Ergebnisse), Diskussion der Ergebnisse, Kritische Betrachtung des Untersuchungsdesigns/Ausblick und Abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zum Gesamtverständnis bei.
- Arbeit zitieren
- Dr. Michael Jost (Autor:in), 2008, Selbstüberschätzung und Risikoverhalten im Jugendalter. Eine Evaluation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120598