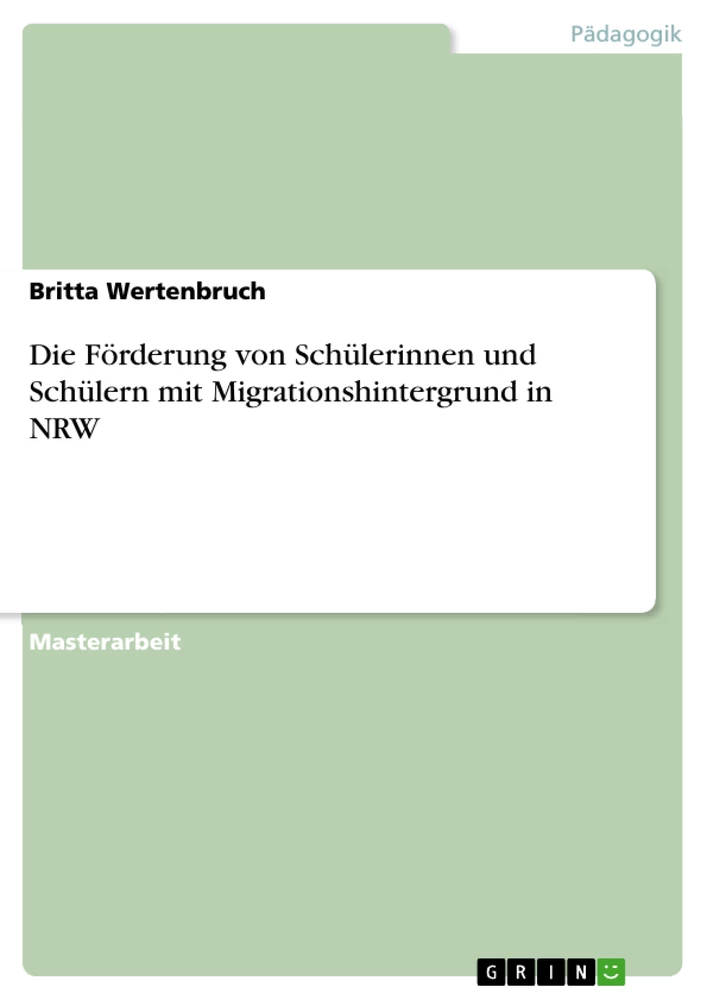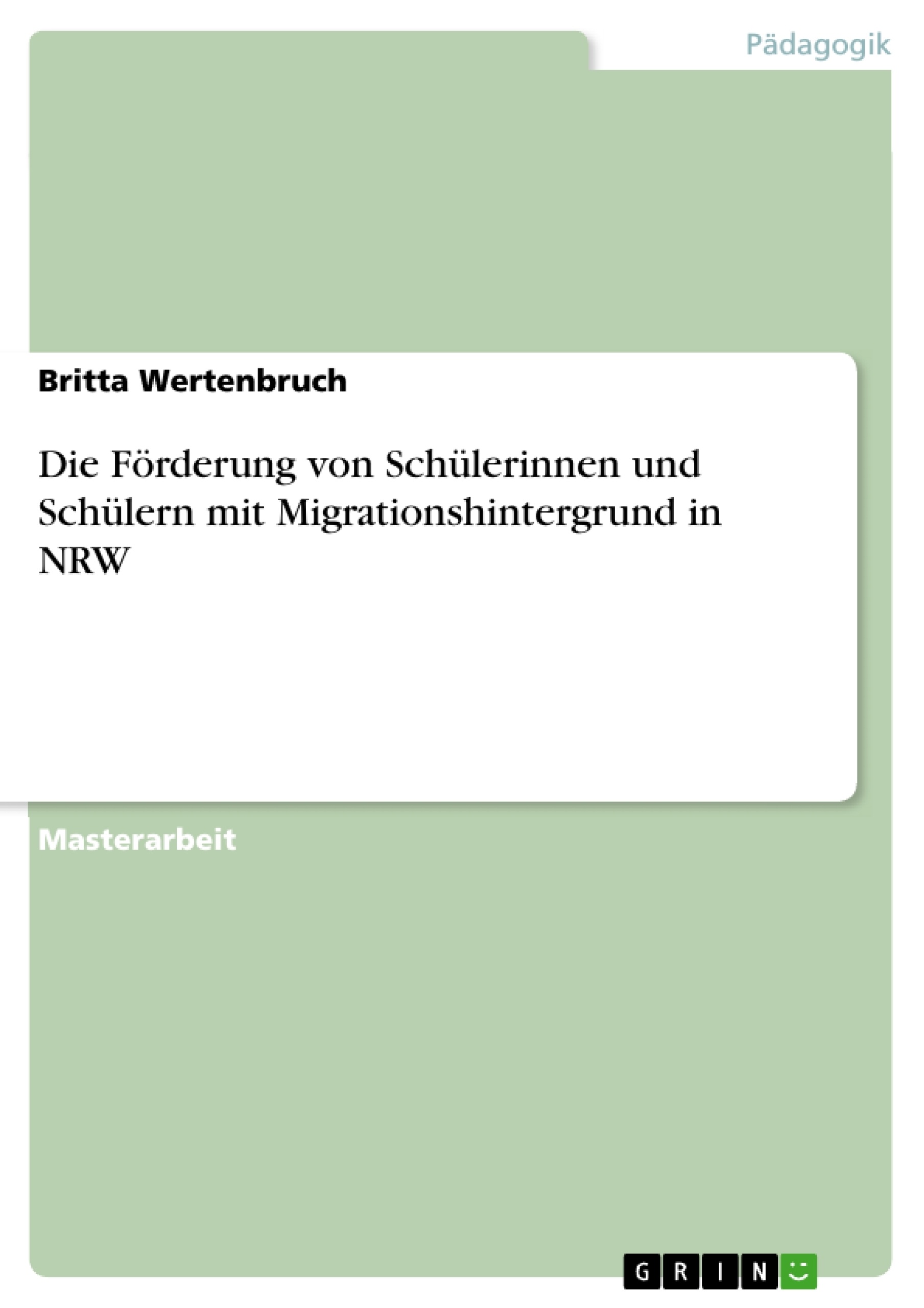Seit Mitte der 1950er Jahre entwickelte sich Deutschland, deutlich zu einem Einwanderungland. Migration wurde zunächst jedoch nur als vorübergehende Phase angesehen. Im Laufe der Jahre hat sich jedoch herausgestellt, dass die ehemaligen Gastarbeiter mit ihren Familien langfristig in Deutschland bleiben und die Integration der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine wichtige und dauerhafte Aufgabe der Schule werden würde. Die spezifischen Probleme, die dem Bildungssystem aus der Migration erwachsen, traten in der Bundesrepublik erst spät – durch die Studie des Programms for International Student Assessment (kurz: PISA) – in den Fokus der Bildungspolitik. Die schlechten Ergebnisse der PISA-Studie dürfen als Indiz dafür gelten, dass es der deutschen Schule in den letzten drei Jahrzehnten nicht gelungen ist, auf die Migration in Deutschland in einer Weise zu reagieren, die den SuS mit Migrationshintergrund eine angemessene Bildungsbeteiligung und –erfolg ermöglicht hätte. Dabei war und ist das Prinzip der Chancengleichheit zweifellos ein Grundsatz für die Gestaltung des deutschen Bildungssystems. Diese Prämisse wird nicht zuletzt durch Artikel 3, Absatz 3, des Grundgesetzes inhaltlich vorgegeben:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Dass das deutsche Schulsystem Kinder und Jugendliche nicht gleichbehandelt stellte auch UN-Sonderberichterstatter VERNOR MUÑOZ in seinem BERICHT FÜR DAS RECHT AUF BILDUNG IN DEUTSCHLAND fest. Dieser inspizierte im Auftrag der Vereinten Nationen im Feburar 2006 – sechs Jahre nach dem ersten PISA-Schock – das deutsche Schulsystem und präsentierte im März 2007 seinen ernüchternden Deutschlandbericht. Dieser charakterisiert das deutsche Schulsystem wie folgt:
„Selektiv, diskriminierend, undemokratisch – das deutsche Schulsystem bietet nicht allen Kindern die gleichen Chancen. […] und das Recht auf Bildung wird nicht überall ausreichend umgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund im nordrhein-westfälischen Schulwesen
- Der Elementarbereich
- Der Primarbereich
- Der Sekundarbereich I
- Determinanten für die Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund
- Die kulturell-defizitäre Erklärung
- Die humankapitaltheoretische Erklärung
- Die Erklärung durch strukturelle Defizite des deutschen Schulsystems
- Die Erklärung durch institutionelle Diskriminierung
- Die Bedeutung von Sprachkenntnissen für den Schulerfolg
- Politische Reaktionen zur Bildungssituation von Migranten
- Interventionsvorschläge der Kultusministerkonferenz
- »Aktionsplan Integration« der Landesregierung NRW
- Interventionen und Fördermaßnahmen zur Verringerung der Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund in NRW
- >RUCKSACK<<-Projekt der RAA
- Durchführung am Beispiel der RAA Herne
- Analyse
- FÖRMIG-NRW
- Durchführung am Beispiel der Grundschule An der Michaelstraße in Herne
- Analyse
- Das Projekt >>Förderunterricht für Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft<< der Stiftung Mercator
- Durchführung am Beispiel des Standorts Essen
- Analyse
- >RUCKSACK<<-Projekt der RAA
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, die faktoren zu identifizieren, die zu Benachteiligungen führen, und erfolgreiche Interventionsmaßnahmen zu analysieren.
- Bildungsbeteiligung und -erfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in NRW
- Analyse verschiedener Erklärungsansätze für Benachteiligung
- Bewertung politischer Reaktionen und Integrationsprogramme
- Ausführliche Betrachtung ausgewählter Förderprojekte
- Identifizierung spezifischer Herausforderungen im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Migration und ihrer Auswirkungen auf das deutsche Bildungssystem ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext von PISA-Studien und Berichten von UN-Sonderberichterstattern. Das zweite Kapitel beschreibt die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in NRW auf Elementar-, Primar- und Sekundarstufe I Ebene. Kapitel drei analysiert verschiedene Erklärungsansätze für die Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund, inklusive kultureller, sozioökonomischer und struktureller Faktoren. Kapitel vier befasst sich mit politischen Reaktionen und Interventionsvorschlägen auf die Herausforderungen. Schließlich werden in Kapitel fünf verschiedene Förderprogramme in NRW detailliert vorgestellt und analysiert, ohne jedoch bereits auf die Ergebnisse und Schlussfolgerungen einzugehen.
Schlüsselwörter
Migrationshintergrund, Bildungsbeteiligung, Bildungserfolg, NRW, Schulsystem, Benachteiligung, Förderprogramme, Integration, PISA, Chancengleichheit, empirische Forschung.
- Quote paper
- Britta Wertenbruch (Author), 2008, Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in NRW, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120568