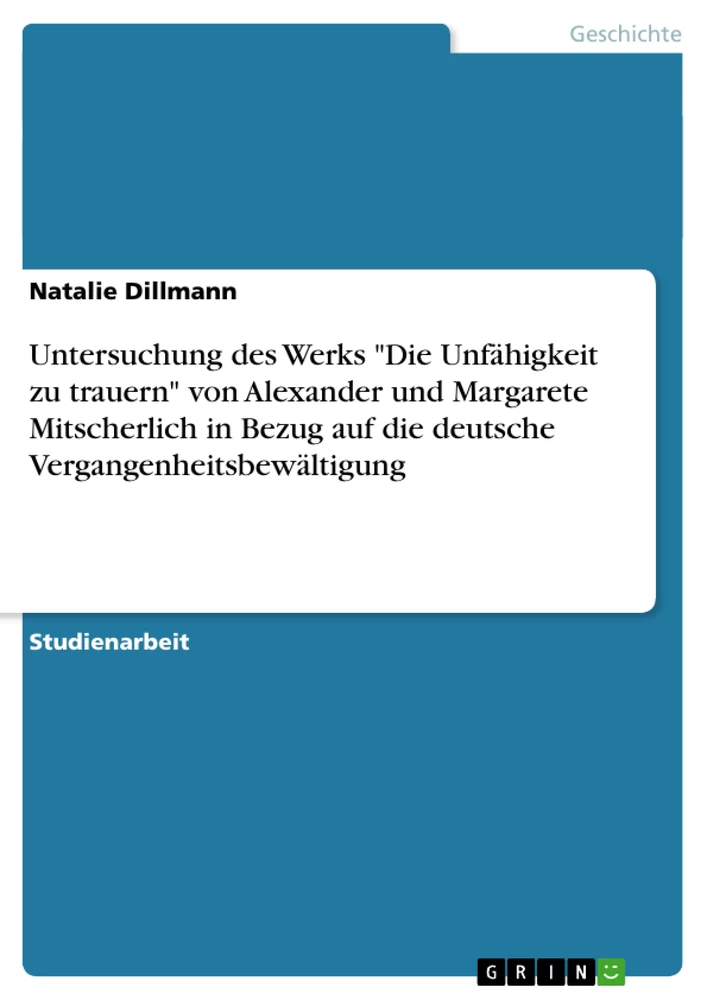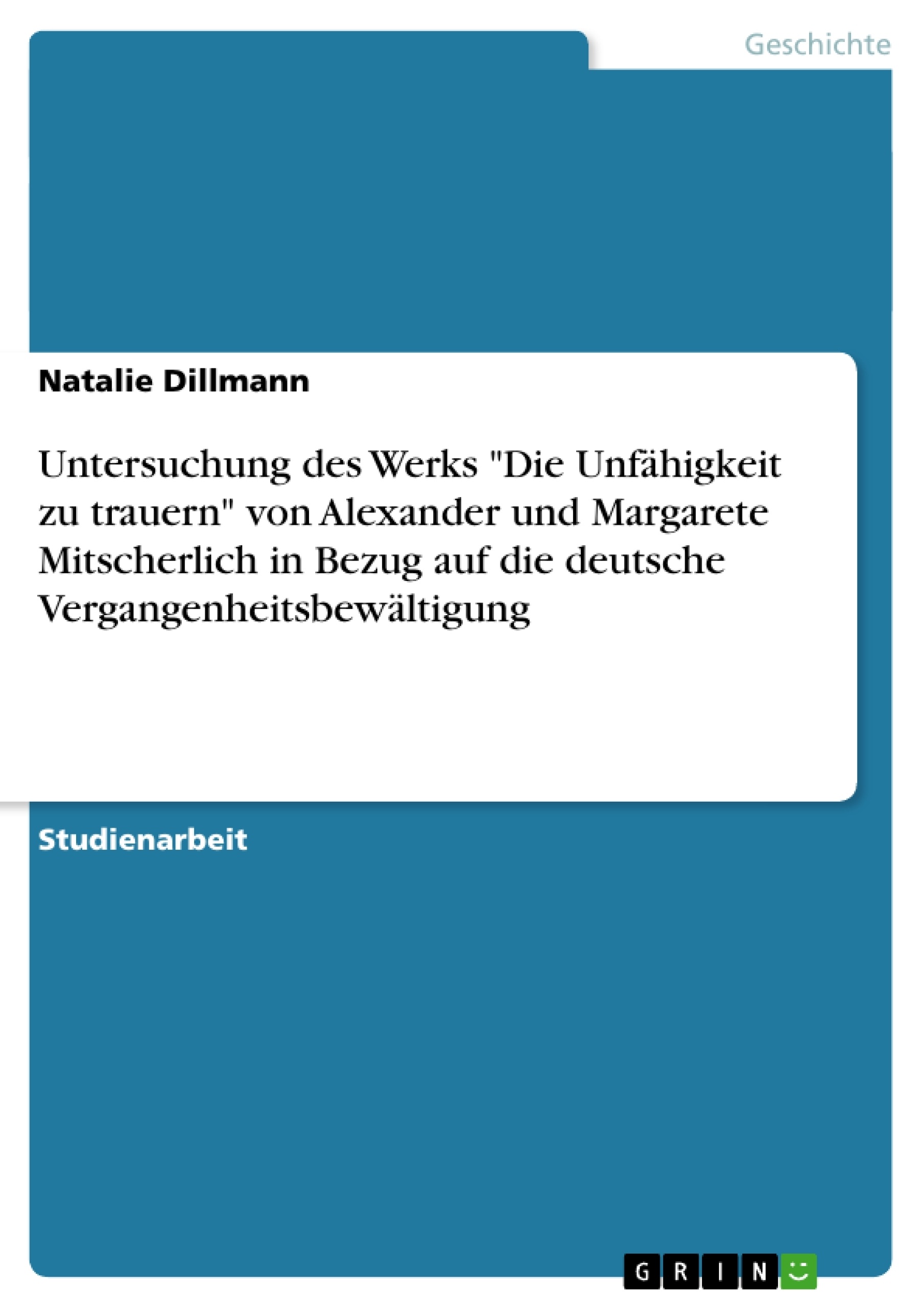Nach dem der Zweite Weltkrieg beendet war und sich erzwungener Friede in Europa breit machte, waren die Verlierer mit schweren Bürden belastet. Eine dieser Bürden war die Verpflichtung ihrer Vergangenheit schonungslos in das erschreckende Antlitz zu schauen und den Versuch zu unternehmen, diese in irgendeiner Form ansatzweise zu „bewältigen“. Der Begriff Vergangenheitsbewältigung wurde für diesen Umstand in Deutschland geprägt.
In dieser Arbeit wird das Werk von Alexander und Margarete Mitscherlich „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens“ in Bezug auf das Verhältnis der Deutschen zu den Geschehnissen im Nationalsozialismus und deren „Bewältigung“ untersucht.
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biographie
2.1 Alexander Mitscherlich
3. Situation vor dem Zweiten Weltkrieg
3.1 Das Kaiserreich
3.2 Der Erste Weltkrieg (1914-1918) und der damit verbundene Versailler Vertrag
3.3 Die Weimarer Republik (1918-1933)
3.4 Geistige Wegbereiter des Nationalsozialismus
3.5 Antisemitismus
4. Zusammenfassung und Erläuterungen zum Buch
5. Bewältigung der Vergangenheit
6. Die direkte Konfrontation mit NS- Tätern und Mitläufern und ihre Techniken der Entwirklichung
7. Ursachen für den blinden Gehorsam
8. Fanatischer Patriotismus
9. Der Führer als Ich-Ideal
10. Politischer und sozialer Immobilismus
11. Ist Trauerarbeit noch möglich?
12. Kollektive Schuld ? Kollektive Unschuld?
13. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Nach dem der Zweite Weltkrieg beendet war und sich erzwungener Friede in Europa breit machte, waren die Verlierer mit schweren Bürden belastet. Eine dieser Bürden war die Verpflichtung ihrer Vergangenheit schonungslos in das erschreckende Antlitz zu schauen und den Versuch zu unternehmen, diese in irgendeiner Form ansatzweise zu „bewältigen“. Der Begriff Vergangenheitsbewältigung wurde für diesen Umstand in Deutschland geprägt.
In dieser Arbeit wird das Werk von Alexander und Margarete Mitscherlich „Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens“ in Bezug auf das Verhältnis der Deutschen zu den Geschehnissen im Nationalsozialismus und deren „Bewältigung“ untersucht.
Dieses Buch ist ein gesellschaftsanalytisches Werk und ist im Jahre 1967 erschienen. Im Untertitel, „Grundlagen kollektiven Verhaltens“, haben die Autoren das zentrale Thema dieser Sammlung einer Reihe in sich abgeschlossener Arbeiten deutlich gemacht. Es wird analysiert ob bzw. inwieweit sich die Deutschen überhaupt mit den damaligen Ereignissen und ihrer Mitschuld daran auseinandersetzten, also inwiefern eine Vergangenheitsbewältigung stattfand. In diesem Buch werden die „psychischen Prozesse in großen Gruppen, als deren Folge sich Freiheit oder Unfreiheit der Reflexion und der Einsicht ausbreiten“[1], näher betrachtet. Es soll der Versuch unternommen werden, mit Hilfe psychologischer Interpretationen „einigen Grundlagen der Politik näher zu kommen“[2].
Interpretiert soll also das, was Politik macht, nämlich menschliches Verhalten in großer Zahl.
Im Blickpunkt steht jene Generation, die den Nationalsozialismus im Erwachsenenalter aktiv miterlebt hat, die also eine aktive Rolle als Täter oder auch als Mitläufer spielte und somit als kleine oder große Rädchen im Getriebe der Realisierung der nationalsozialistischen Ideale, unbeachtet der verbrecherischen Methoden, die vorgeblich als Mittel zum Zweck dienten, verhalf.
Gefragt wird nach den unterschiedlichen Umgangsformen dieser Generation mit der NS-Vergangenheit. Welche Reaktionen und alternative Identifikationsmöglichkeiten boten sich? Welche Abwehrmechanismen sind in diesem Zusammenhang zu finden? Dazu muss jedoch anfangs untersucht werden, wie sich das Leben dieser Generation darstellte, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Unbegreifliche möglich machten, und die Gedankenwelt dieser Zeit aussah, denn „das Verständnis der Motive eines Individuums bringt uns schrittweise an die unbekannte Welt des anderen heran.“[3] Die Erziehung, Werte und die Moral dieser Generation spielen eine entscheidende Rolle, um zu verstehen, was diese Generation dazu brachte sich mit den Idealen des Nationalsozialismus oder gar mit Hitler zu identifizieren und diesen Idealen bedingungslos zu dienen.
Die Autoren dieses Buches versuchten eine Antwort auf die Frage zu geben, warum die Trauer um die Millionen Opfer der „Dritten Reiches“ nicht stattfand.
Einleitend folgen die Biographien des Ehepaars Mitscherlich.
2. Biographie
2.1 Alexander Mitscherlich
Alexander Mitscherlich wurde als Sohn des Chemikers Harbord Mitscherlich und seiner Frau Clara am 20. September 1908 in München geboren. Schon als Heranwachsender litt er unter einem deutschnational gesinnten Vater.
Nach der Absolvierung des Gymnasiums in Hof studierte er in den Jahren 1928-1932 an der Universität München zunächst Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie. Damit brach Alexander Mitscherlich die Familientradition, die durch drei Generationen hindurch Naturwissenschaftler waren.
Mitscherlich begann mit der Dissertation über das historische Lutherbild zu promovieren, die der Historiker Paul Joachimsen, der ein getaufter Jude gewesen ist, als Thema akzeptiert hatte. Doch dieser starb im Jahre 1932. Die Promotion scheiterte dann an der Weigerung vom antisemitischen Nachfolger von Paul Joachimsen, Karl Alexander von Müller. Daraufhin brach Mitscherlich sein Studium ab. 1932 heiratete er die Ärztin Melitta Behr, mit der er dann drei Kinder hat. Diese Ehe ermöglicht, in finanzieller Hinsicht, Freundschaften, unter anderem mit Ernst Niekisch zu schließen. Er eröffnete seine eigene Buchhandlung und studierte nebenbei Medizin. Mitscherlich wird dann Teilhaber von Niekisch Widerstands-Verlag. Niekisch selbst war zu der Zeit den Nazibehörden bereits anstößig geworden, weil er ein Buch verfasst hatte, durch das er vor Hitler und der Gefahr der nationalsozialistischen Machtübernahme warnt (Hitler ein deutsches Verhängnis).
Mitscherlichs Buchhandlung, die für Niekisch warb, wurde 1935 von der SA geschlossen. Im selben Jahr emigriert Mitscherlich in die Schweiz, nachdem er wegen Widerstandsarbeit steckbrieflich gesucht wurde. Dort und auch später noch einmal unterzog sich Mitscherlich einer psychoanalytischen Behandlung, an die er sich dankbar erinnerte. In Zürich setzte er sein Medizinstudium fort.
Als er aber im Februar 1937 für kurze Zeit nach Deutschland kam, um einen Anwalt für den verhafteten Freund Niekisch zu finden, wurde er von der Gestapo festgenommen. Nach achtmonatiger Untersuchungshaft wurde er wegen ungenügendem Beweismaterial freigelassen, erhielt aber die Auflage, in Deutschland das Studium fortzusetzen und sich regelmäßig bei der Polizei zu melden.
1938 nahm ihn Viktor von Weizsäcker als Studierenden in Heidelberg auf. Mitscherlich ging im selben Jahr seine zweite Ehe mit Georgia Wiedemann ein. Aus dieser Verbindung folgen zwei weitere Kinder.
1939 legte er in Heidelberg das medizinische Staatsexamen ab. Mitscherlich promovierte zum Thema „Zur Wesensbestimmung der synästhetischen Wahrnehmung“ im Jahr 1941 bei Viktor von Weizsäcker und arbeitete als Neurologe an der Universitätsklinik in Heidelberg. Durch Weizsäcker wurden ihm die in Deutschland verbotenen Arbeiten von Sigmund Freud zugänglich gemacht, für die er sich schon in München zu interessieren begann. Weizsäcker prägte seine Auffassung von der humanen Aufgabe des Arztes, der im Patienten den ganzen Menschen zu sehen hat.
Eine schwere Gelenkveränderung am Knie, Wehrunwürdigkeit und zuletzt die Unabkömmlichkeit als Leiter einer neurologischen Ambulanz, bewahrten ihn vor dem Kriegsdienst.
Im Jahre 1945 wird Mitscherlich für einige Wochen die Leitung des Gesundheitsamtes in der zunächst amerikanischen Besatzungszone „Saar, Pfalz und Rheinhessen“ übertragen. Als das Gebiet den Franzosen übergeben wurde, veranlasst dies Mitscherlich sein Amt nieder zu legen. Daraufhin arbeitet er in der medizinischen Polyklinik in Zürich.
1946 wird Mitscherlich von der ärztlichen Standesvertretung als Beobachter zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gegen NS-Ärzte entsandt. Darauf veröffentlichte er eine Dokumentation „Das Diktat der Menschenverachtung“ (1947), in der er aufzeigte, wie verführbar eine den lebendigen Menschen vernachlässigende Medizin war und mit welcher Bedenklosigkeit selbst angesehene Kliniker sich im Namen der Wissenschaft an Menschenversuchen beteiligten. Diese Dokumentation stieß auf wehleidige Abwehr zahlreicher Kollegen. Hier begegnete Mitscherlich zum ersten Mal dem Phänomen der Verdrängung und des „Vergessens“ der Nazizeit, auf das er im Buch „Die Unfähigkeit zu trauern, Grundlagen kollektiven Verhaltens“, genau eingegangen ist.
In zahlreichen Vorträgen und Artikeln trat Mitscherlich für die Wiederaufnahme der Psychoanalyse als Therapie und als Methode der Kulturkritik ein.
1949 gründete Mitscherlich an der Uni Heidelberg die Abteilung für psychosomatische Medizin, die bald zu einer eigenen Klinik ausgebaut wurde, der ersten ihrer Art.
1952 erhielt Mitscherlich eine außerplanmäßige Professur für psychosomatische Medizin an der Universität Heidelberg.
Im Jahre 1955 heiratete er die Ärztin und Psychoanalytikerin Margarete Nielsen, mit der er bereits einen Sohn, Matthias, hatte. Trotz wachsender Anerkennung im In- und Ausland dauerte es noch bis 1960, ehe Mitscherlich einen ordentlichen Lehrstuhl für Psychoanalyse an der Universität in Frankfurt erhielt. Im selben Jahr gründete und leitete er das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main, das sich unter Mitscherlichs Leitung der Ausbildung von Psychoanalytikern und der Anwendung der analytischen Methode auf soziale und kulturelle Phänomene widmete. Bis zu seiner Emeritierung 1973 hielt Mitscherlich regelmäßig Vorlesungen, bis er schließlich im Jahre 1976 das Direktorat seines Instituts niederlegte. Daraufhin wurde er zunehmend zum engagierten Kritiker der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft.
In den nächsten Jahren verfasste Mitscherlich zahlreiche Bücher und Dokumentationen, durch die ihm viele Auszeichnungen verliehen wurden. Vor allem sind es drei Arbeiten, die Mitscherlich über den Kreis seiner Kollegen hinaus international Ansehen verschafft haben. Den Anfang machte das Buch „Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft“ (1963), in dem die seelischen Auswirkungen der „Entmachtung“ des Familienvaters infolge der Beschleunigung wissenschaftlich- technischer Entwicklungen, der „Spurlosigkeit von Arbeit“ und der erhöhten Mobilität analysiert werden. Das zweite entstandene Buch, das 1965 veröffentlicht wurde, beschreit die „Unwirtlichkeit unserer Städte“ und will ausdrücklich zum „Unfrieden anstiften“. Er kritisiert hier die Zerstörung gewachsener Strukturen in der Stadtentwicklung der Nachkriegszeit. Und schließlich „Die Unfähigkeit zu trauern“, was er im Jahre 1967 zusammen mit seiner Frau verfasst hat.
Wie unter anderem auch Freud gehörte Mitscherlich in die Reihe der Ärztephilosophen, die daran arbeiten, die bewusste Praxis der Individuen und Kollektive durch Anamnese aufzuhellen, zu lernen und zu lehren, in welchem Maße die Menschen selber Autoren ihres Schicksals sind und in welchem Maße sie es darum sabotieren können.
Am 26. Juni 1982 starb Alexander Mitscherlich in Frankfurt am Main konfessionslos.
2.2. Margarete Mitscherlich
Margarete Mitscherlich, Ärztin, Psychoanalytikerin und Publizistin, geborene Nielsen, wurde am 17. Juli 1917 in Graasten (Dänemark) geboren. Sie studierte zunächst Medizin und machte später eine psychoanalytische Ausbildung in Stuttgart, London und Heidelberg.
Neben der Zusammenarbeit mit ihrem Mann, setzte sie sich unter anderem mit der Problematik der Idealisierung (Das Ende der Vorbilder“; 1978), den Geschlechterbeziehungen („Männer. Zehn exemplarische Geschichten“, 1980, mit Helga Dietrichs) und dem Rollenverhalten der Frau in der Politik („Die friedfertige Frau“, 1985; „Die Zukunft ist weiblich“, 1987) auseinander.
Sie war Mitglied im Beirat des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Im Jahre 1984 wurde ihr der Flensburger Kulturpreis überreicht.
3. Situation vor dem Zweiten Weltkrieg
Wie in der Einleitung schon erwähnt, müssen alle Hintergründe durchleuchtet werden, um das Verhalten und die Reaktionen der Generationen, die das NS- Regime im Erwachsenenalter aktiv miterlebt haben, analysieren zu können. Damit soll der Versuch gestartet werden ein Stück weit verstehen zu können, was diese Generation dazu veranlasst hat, den Idealen des Nationalsozialismus blind zu dienen.
In diesem Kapitel werden daher der geschichtliche Hintergrund, die Lebenslage dieser Generation, deren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Erziehung, deren Verständnis von Moral und Werte und deren Gedankenwelt näher beschrieben. Auffallend ist in der Zeit des Kaiserreiches, der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus die Kontinuität gewisser Wertvorstellungen, die sich vor allem im Autoritätsglauben der Deutschen spiegelt.
3.1 Das Kaiserreich
Nach der Gründung des Deutschen Reiches, das aus 25 Bundesstaaten bestand, wurde der Reichstag in elf Staaten nach dem Dreiklassenwahlrecht fest, nachdem das Abgeordnetenhaus und die Gemeindevertretung gewählt wurden.
Dieses 1849 von König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) verordnetes Wahlrecht teilte die Wähler nach ihrem direkten Steueraufkommen in drei Klassen ein. So umfasste 1908 die erste Klasse der am höchsten Besteuerten nur vier Prozent der Wähler, durfte aber ebenso viele Wahlmänner stellen wir die dritte Klasse mit rund 82 Prozent der Wahlberechtigten. Die Stimme der breiten Massen ging also völlig unter. Es wurde von ihr zwar ihr Beitrag zu allen Lasten des Krieges abgefordert, die „Demokratisierung der Rechte“ ließ aber auf sich warten. Erst im November 1918, nach dem militärischen Zusammenbruch, wurde das Dreiklassenwahlrecht außer Kraft gesetzt. Im Gegensatz zu anderen Ländern fehlte den Deutschen deshalb eine demokratische „Tradition“, so dass viele mit der Weimarer Republik in gewisser Weise überfordert waren.
3.2 Der Erste Weltkrieg (1914-1918) und der damit verbundene Versailler Vertrag
Die deutsche Öffentlichkeit reagierte mit den Sätzen auf die Friedensbedingungen des Versailler Vertrags, der am 10. Januar 1920 in Kraft trat. Das Deutsche Reich verlor sämtliche Kolonien, ein Grossteil seiner Flotte sowie ein siebtel seines Gebiets mit einem zehntel seiner Bevölkerung. Die Reichswehr durfte die Stärke von 100 000 Berufssoldaten nicht überschreiten. Die Höhe der Reparationen blieb eine Zeit heftig umstritten, da sie eng verbunden war mit dem so genannten Kriegsschuldartikel. Im Artikel 231 des Versailler Vertrags wurde nämlich festgelegt, dass das Deutsche Reich die Alleinschuld am Beginn und
an den Schäden des Entente- Staaten zu tragen habe. Dadurch wurde das Deutsche Reich zu erheblichen alliierten Reparationsforderungen herangezogen. Mehr als alle materiellen Sachlieferungen war es aber die mit der Wiedergutmachung verbundene moralische Anklage der Kriegsschuld, die einen Großteil der Deutschen verbitterte und politisch radikalisierte. Dieses Gefühl des Unwohlseins, bei dem Gedanken, Schuld am Krieg zu sein, drückt Mattias Claudius bereits in seinem Kriegslied aus: „…`s ist leider Krieg – und begehre nicht Schuld daran zu sein!“[4]
Deshalb wurde der Versailler Vertrag von den äußersten Rechten bis hin zur Sozialdemokratie grundsätzlich als ein „Diktat- und Schandfreiden“ abgelehnt. Letztere musste sich dabei den Vorwurf gefallen lassen, mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages zu einer Erniedrigung des Deutschen Reichs und zur Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts Deutschlands beigetragen zu haben. Insbesondere die radikalen Rechte wie die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und die NSDAP sowie die Repräsentanten des alten Regimes nutzen die so genannte Dolchstoßlegende um gegen die Vertreter der bürgerlichen Parteien und damit auch gegen die Weimarer Republik front zu machen. Die Folgen des Krieges, der Niederlage und der umkämpfte Versailler Vertag bewirkten, dass die erste deutsche Demokratie von Anfang an einen schweren Stand hatte.
[...]
[1] A., M. Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967, S. 7.
[2] Ebd., S. 7.
[3] Ebd., S. 186.
[4] Ebd., S. 216
- Quote paper
- Natalie Dillmann (Author), 2006, Untersuchung des Werks "Die Unfähigkeit zu trauern" von Alexander und Margarete Mitscherlich in Bezug auf die deutsche Vergangenheitsbewältigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120425