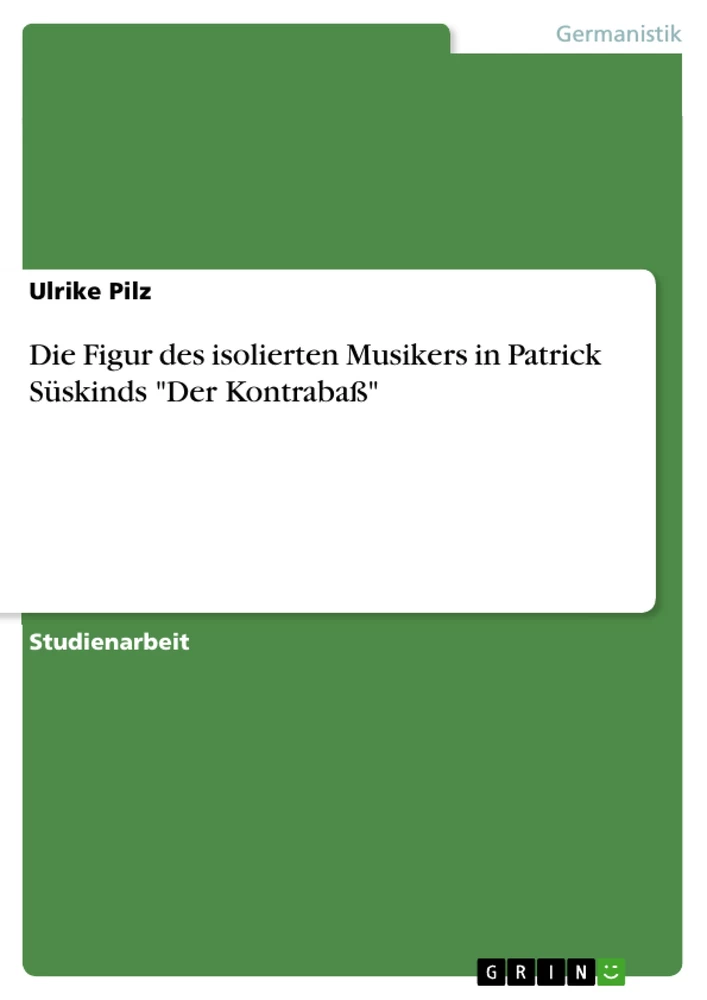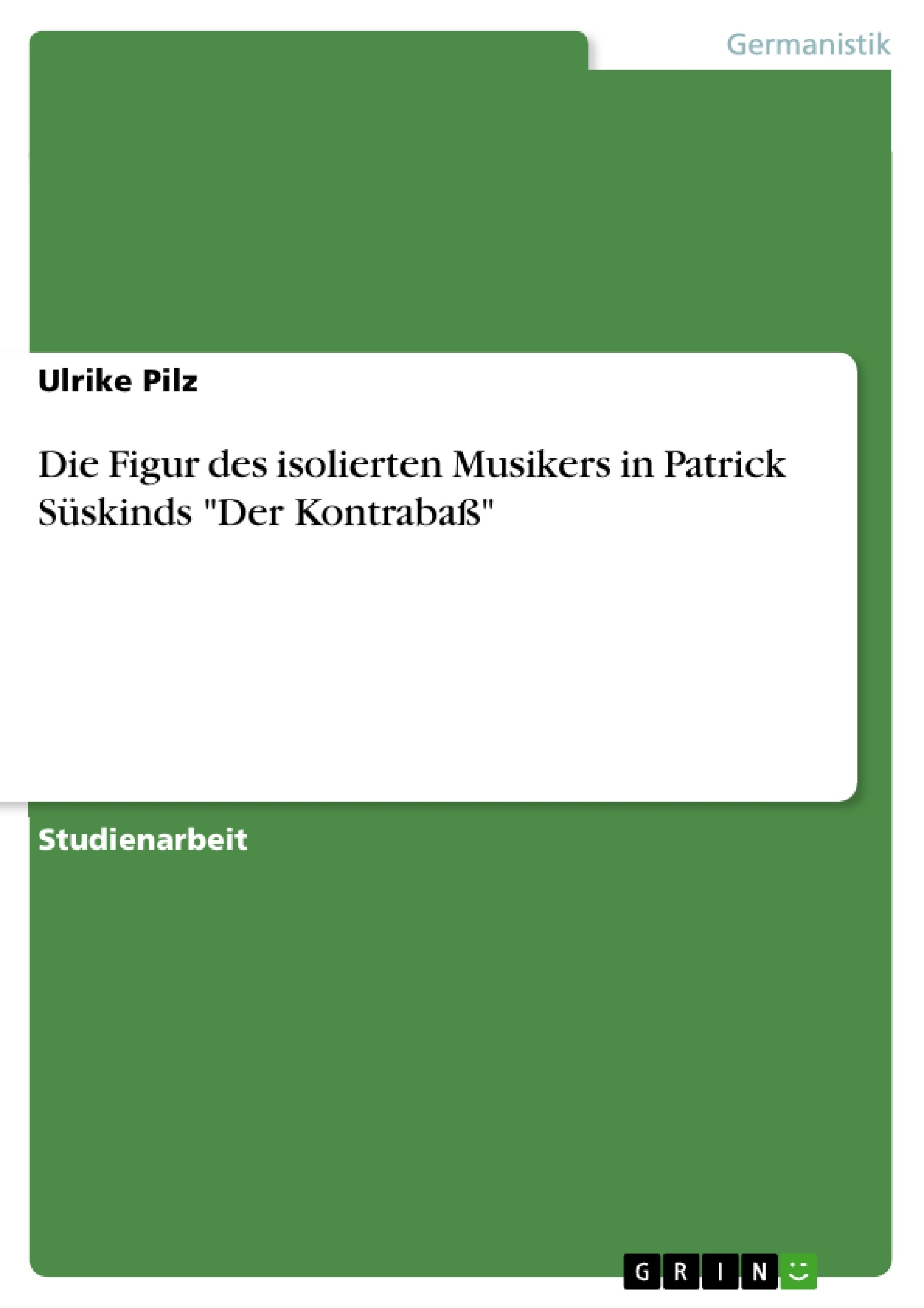Selbst nach über 20 Jahren haben Süskinds Werke nichts an ihrer Faszination, Aktualität und ihrer „…stilistischen Virtuosität“ verloren: Im September dieses Jahres kommt die Bernd Eichinger Verfilmung von Süskinds Debütroman „Das Parfum“ in die deutschen Kinos.
Noch lange Zeit nach seinem Erscheinen 1985 war dieser „…spannend[e] und artistisch[e]“ Roman in vielen Feuilletons zu finden und wurde bis heute über acht Mio. Mal verkauft und in 33 Sprachen übersetzt.
Auch das Erstlingswerk von Patrick Süskind – der Einakter „Der Kontrabaß“ – erfreute sich schon bei seiner Veröffentlichung großer Resonanz: In den Jahren 1984/85 war es mit 25 Inszenierungen und 522 Aufführungen das meist gespielte Stück auf deutschen Bühnen.
Der Erfolg ist wohl der Schlichtheit und dabei dennoch bestehenden Zeitlosigkeit des Dramas zugeschrieben: Exemplarisch wird dem Publikum ein weltfremder Mensch unserer anonymen Gesellschaft, vorgeführt.
Diese Hausarbeit hat den Protagonisten im „Kontrabaß“, seine Einsamkeit und sein dadurch resultierendes gestörtes Verhältnis zur Umwelt als Schwerpunkt.
Das Werk ist laut Angaben Süskinds im Sommer 1980 entstanden und wurde im Juni 1981 als Hörspielfassung beim WDR aufgezeichnet, bevor es am 22. September desselben Jahres zur Uraufführung in München kam. Nikolaus Paryla führte in diesem Einakter Regie und spielte zugleich die Hauptrolle des Bassisten.
Erst zwei Monate später -in der Novemberausgabe der Fachzeitschrift Theater heute- wurde die erste Druckfassung veröffentlicht.
1984 erschien das Stück als Buchfassung im Diogenes-Verlag. Mit diesem Werk gelang Süskind sein literarischer Durchbruch.
Inhalt
1 Einführung
2 Übersicht von Leben und Werk Süskinds
3 „Der Kontrabaß“
3.1 Das Monodrama und seine Protagonisten
3.1.1 Der gescheiterte Musiker
3.1.2 Die ‚engelsgleiche’ Sängerin
3.1.3 Das ‚plumpe’ Instrument
3.2 Isolation im Werk Süskinds
3.2.1 Isolation in „Der Kontrabaß“
4 Konklusion
5 Bibliographie
1 Einführung
Selbst nach über 20 Jahren haben Süskinds Werke nichts an ihrer Faszination, Aktualität und ihrer „…stilistischen Virtuosität“[1] verloren: Im September dieses Jahres kommt die Bernd Eichinger Verfilmung von Süskinds Debütroman „Das Parfum“ in die deutschen Kinos.
Noch lange Zeit nach seinem Erscheinen 1985 war dieser „…spannend[e] und artistisch[e]“[2] Roman in vielen Feuilletons zu finden und wurde bis heute über acht Mio. Mal verkauft und in 33 Sprachen übersetzt.
Auch das Erstlingswerk von Patrick Süskind – der Einakter „Der Kontrabaß“ – erfreute sich schon bei seiner Veröffentlichung großer Resonanz: In den Jahren 1984/85 war es mit 25 Inszenierungen und 522 Aufführungen das meist gespielte Stück auf deutschen Bühnen.
Der Erfolg ist wohl der Schlichtheit und dabei dennoch bestehenden Zeitlosigkeit des Dramas zugeschrieben: Exemplarisch wird dem Publikum ein weltfremder Mensch unserer anonymen Gesellschaft, vorgeführt.
Diese Hausarbeit hat den Protagonisten im „Kontrabaß“, seine Einsamkeit und sein dadurch resultierendes gestörtes Verhältnis zur Umwelt als Schwerpunkt.
Das Werk ist laut Angaben Süskinds im Sommer 1980 entstanden und wurde im Juni 1981 als Hörspielfassung beim WDR aufgezeichnet, bevor es am 22. September desselben Jahres zur Uraufführung in München kam. Nikolaus Paryla führte in diesem Einakter Regie und spielte zugleich die Hauptrolle des Bassisten.
Erst zwei Monate später -in der Novemberausgabe der Fachzeitschrift Theater heute - wurde die erste Druckfassung veröffentlicht.
1984 erschien das Stück als Buchfassung im Diogenes-Verlag. Mit diesem Werk gelang Süskind sein literarischer Durchbruch.
2 Übersicht von Leben und Werk Süskinds
Wie auch die meisten seiner Charaktere ist der 1949 in Amberg geborene Schriftsteller ein zurückgezogenes Wesen. „Biographisches ist über Patrick Süskind, der sich selbst(-ironisch) als einen von den Zeitläufen überrumpelten Altachtundsechziger porträtierte, nur spärlich zu erfahren; […] er … verweigert Interviews und Fototermine…“[3].
Die Züricher Sonntagszeitung nannte 1991 Patrick Süskind „das berühmteste Phantom der deutschen Unterhaltungsliteratur“.
Als der Sohn des Publizisten Wilhelm Emanuel Süskind sein Abitur in Holzhausen abschloss, studierte er daraufhin ab 1968 Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität München. Zwischenzeitlich schob Patrick Süskind einen einjährigen Studienaufenthalt in Aix-en-provence in Frankreich ein. Nach seinem erfolgreichen Studienabschluss 1974 arbeitete er als freiberuflicher Schriftsteller in München. Schon während seiner letzten Studienjahre schrieb er kleine (unveröffentlichte) Prosastücke und Drehbücher.
„Der Kontrabaß“ wurde als sein Erstlingswerk 1981 in Theater heute veröffentlicht und setzte Patrick Süskind zum ersten Mal in den Fokus der Feuilletons.
Er war Autor für verschiedene Drehbücher, wie für die Fernsehserien „Monaco Franze, der ewige Stenz“ (1981/82) und „Kir Royal. Aus dem Leben eines Klatschreporters“ im Jahr 1986. Er verfasste 1999 auch das Drehbuch für den Kinofilm „Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“. Sein Debütroman „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“ wurde 1985 publiziert und verhalf ihm zum Welterfolg.
Die Erzählung „Die Taube“ veröffentlichte er 1987 und die Erzählung „Die Geschichte von Herrn Sommer“ 1991. Neben der Mitarbeit an diversen Drehbüchern erschien bis dato nur noch 1995 „Drei Geschichten und eine Betrachtung“ des Amberger Autoren.
Die Verleihung des Tukan – und des FAZ-Literaturpreises lehnte er ab.
Heute lebt Süskind abwechselnd in München, Paris und Montolieu (Südfrankreich).
3 „Der Kontrabaß“
3.1 Das Monodrama und seine Protagonisten
Da in diesem Stück zwar mehrere Charaktere Erwähnung finden, aber nur einer präsent ist, „…handelt es sich … um ein Monodram[sic]…“[4]. Allen Stücken, in denen nur eine handelnde Person auftritt, wird diese Bezeichnung zugeschrieben.
Ferner ist dieses Stück auch ein Einakter, da Süskind weder Einteilungen in Aufzüge oder Auftritte vorgenommen hat.
Obwohl keine von Süskind vorgenommene Untertitelung auf eine spezielle Gattung, wie zum Beispiel „Schauspiel“ oder „Drama“ hinweist, so impliziert doch die vom Diogenes-Verlag vorgenommene Ergänzung über die Uraufführung die Gattungsbestimmung eines Theaterstückes.
Ferner ist dieses Werk formal als ‚geschlossene Form’ des Dramas zu bezeichnen, da hier konsequent eine Einhaltung von Ort, Zeit und Handlung stattfindet.
Diese Gegebenheit ist nicht nur von formalem, sondern auch von inhaltlichem Interesse, da der „…Zustand der Isolation, des Alleinseins und der Einsamkeit…“[5] des Protagonisten nur durch diese Einhaltung möglich ist.
In Süskinds Einakter sind nur drei Charaktere präsent:
Zum einem der Musiker selbst, sein Kontrabass und die Mezzosopranistin Sarah.
Alle Äußerungen über Sarah und den Bass werden von dem namenlos bleibenden Bassisten getroffen, welcher sich jedoch direkt und indirekt selbst charakterisiert: „[Er] läßt schwadronierend die Innenansichten eines autoritätshörigen Menschen und seines ‚instrumentalisierten’ Weltbildes entstehen.“[6].
Zu beachten ist bei der Charakterisierung des Kontrabasses und der Mezzosopranistin Sarah, dass diese nur vom emotional verklärten Musiker dargestellt werden und diese Darstellung nie von außen differenziert wird und auch nie werden kann.
3.1.1 Der gescheiterte Musiker
Auch wenn das Einpersonen- Stück mit „Der Kontrabaß“ tituliert ist, so ist doch Handlungsträger eher der Musiker und nicht das Instrument an sich.
Der mittdreißiger Kontrabassist des Staatsorchesters sitzt alleine in seiner Wohnung und legt sein Innerstes, sein Wissen über sein Instrument, Wissen über Musikgeschichte, aber auch philosophisch-metaphysische Ansichten, sowie biographische Erinnerungen einem imaginären Publikum dar.
„Diese mit enormen Sprachwitz versehene Groteske zeigt einen Musiker aus dem zweiten Glied, der an seiner Mittelmäßigkeit leidet.“[7].
Anfänglich ganz harmlos „…wendet [er] sich monologisch an ein Publikum, dem er sprunghaft und assoziativ seine Gedankenwelt eröffnet.“[8], später aber offenbart er durch unbewusste Äußerungen seine wahre Identität des „…frustrierte[n] Kleinbürger[s]…“[9]. Dieser Sachverhalt entlarvt sich vor allem in Äußerungen über finanzielle Belange.
Das Stück beginnt mit der Zweiten Sinfonie von Brahms, welche dem Musiker den Indikator gibt sich zu präsentieren, er kann die Wichtigkeit seines Instruments –des Kontrabasses- betonen und mystifiziert diesen zum „…Fundament, auf dem sich dieses ganze herrliche Gebäude erhebt…“[10].
Als der Tuttist von der Rolle seines Instruments zum musikalischen Gegenpol desselben kommt, wirkt er angespannt und nervös. Im Text ist dies durch Satzabbrüche (Aposiopesen), Inversionen, Wortwiederholungen (Repetitionen) und die Häufung von Auslassungspunkten hervorgehoben:
„…wäre dann… wäre dann dieser Sopran… oder Mezzosopran… genau jener Gegenpol, von dem hin aus… oder besser: zu dem hin… oder mit dem vereint der Kontrabaß… ganz unwiderstehlich –quasi- den musikalischen Funken schlägt…“[11]
Dieses Verhalten entlarvt unbewusste Träume und Wunschvorstellung, denn wie sich später noch herausstellt, ist unser Musiker heimlich in eine Mezzosopranistin –die junge Sarah- verliebt. Auffällig ist, dass der Musiker anscheinend ein großes Bedürfnis hat sich zu profilieren: Permanent „…stellt der Kontrabassist sein Wissen um Akustisches und Musikalisches exzessiv zur Schau…“[12], vom Faktenwissen über Musikgeschichte und die musikalische Entwicklung seines Instruments bis hin zu philosophischen „…Ausführungen über Pantheismus und Mystik.“[13].
[...]
[1] Spinner, Kaspar H.: Stil-Etüden zu Süskind. In: Der Deutschunterricht 48 (1996). S. 32
[2] Frizen, Werner: Patrick Süskinds ‚postmoderne’ Didaktik. In: Der Deutschunterricht 48 (1996) S. 26
[3] Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text + Kritik 2002. S. 1
[4] Krischel, Volker: Erläuterungen zu Patrick Süskind: Der Kontrabaß. Königs Erläuterungen und Materialien. Hollfeld: Bange 2002. S. 35
[5] Freudenthal, David: Zeichen der Einsamkeit. Sinnstiftungen und Sinnverweigerung im Erzählen von Patrick Süskind. Hamburg: Kovac 2005. S. 2
[6] Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text + Kritik 2002. S. 3
[7] Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945. Hrsg. von Thomas Kraft. München: Nymphenburger 2003. S. 1225
[8] Ebd. S. 1225
[9] Ebd. S. 1225
[10] Süskind, Patrick: Der Kontrabaß. Zürich: Diogenes 1984. S. 10
[11] Ebd. S. 13
[12] Degler, Frank: Aisthetische Reduktionen. Analysen zu Patrick Süskinds ‚Der Kontrabaß’, ‚Das Parfum’ und ‚Rossini’. Berlin/ New York: Walter de Gruyter 2003. S. 31
[13] Krischel, Volker: Erläuterungen zu Patrick Süskind: Der Kontrabaß. Königs Erläuterungen und Materialien. Hollfeld: Bange 2002. S. 41
- Citar trabajo
- Ulrike Pilz (Autor), 2006, Die Figur des isolierten Musikers in Patrick Süskinds "Der Kontrabaß", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120390