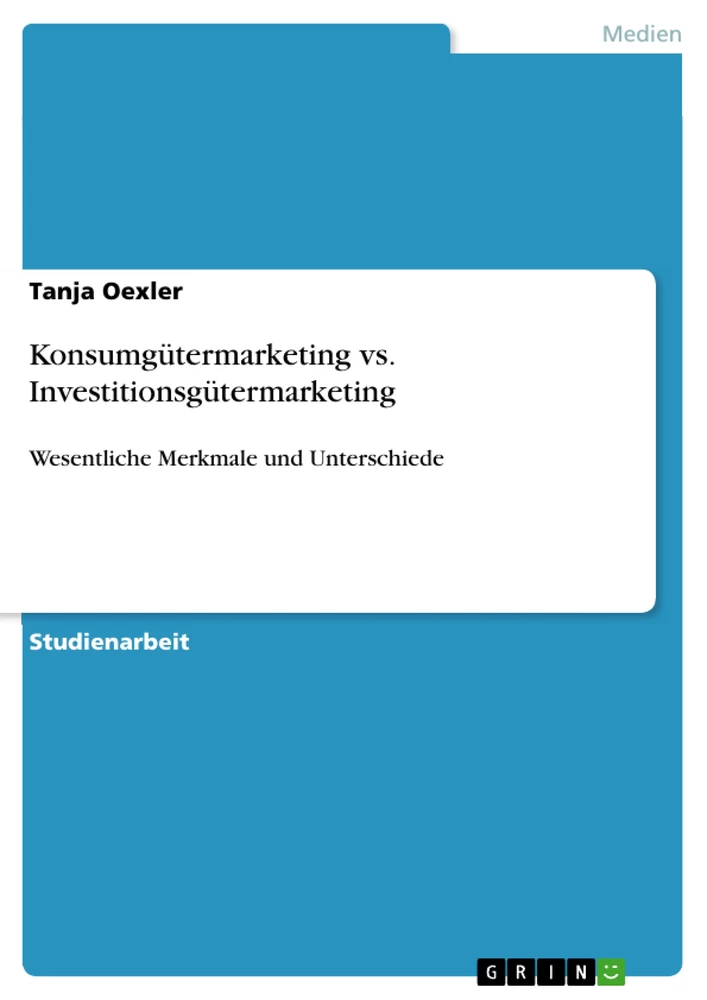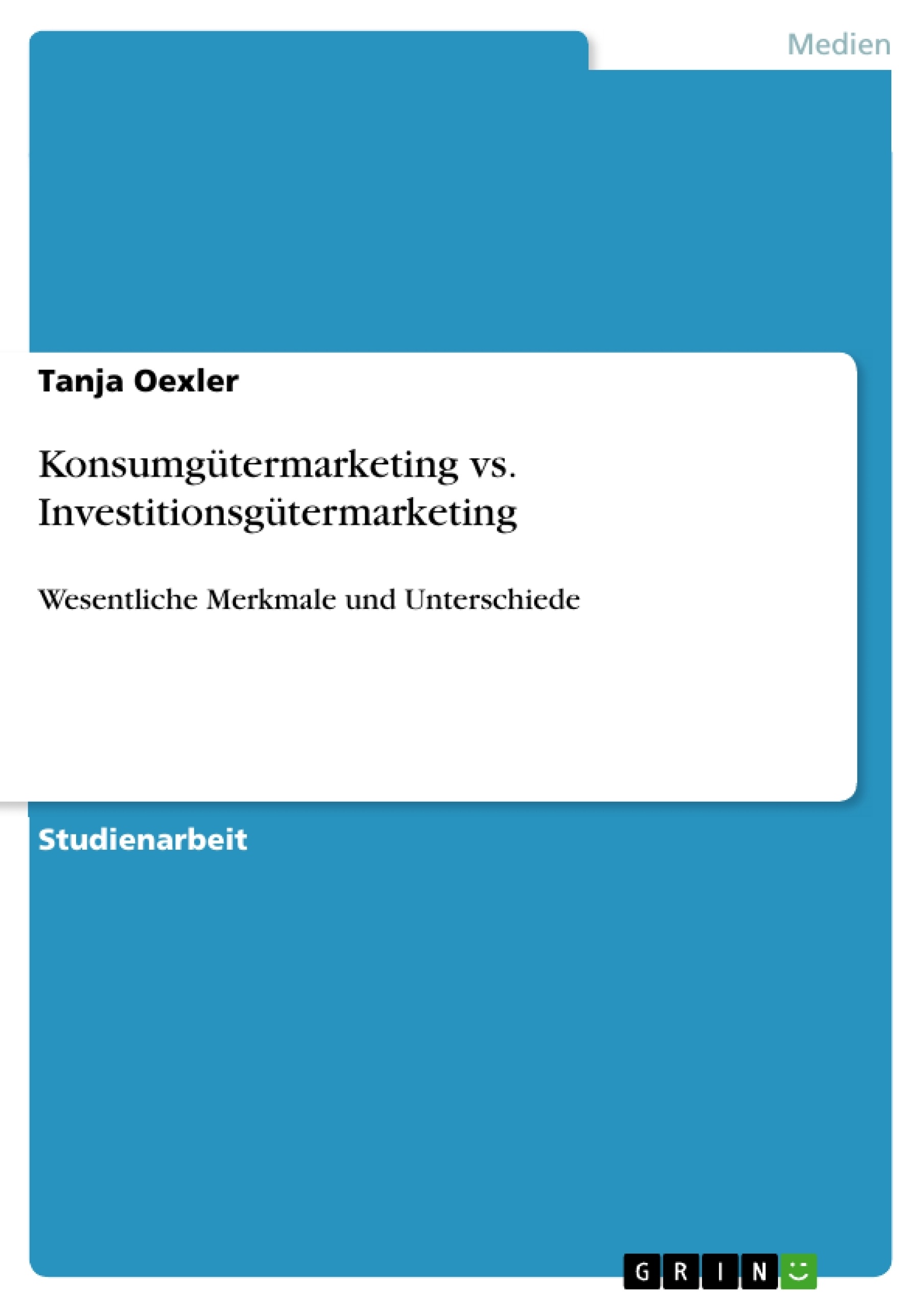Betrachtet man die aktuelle wirtschaftliche Lage – geprägt durch den immer größer werdenden Konkurrenzdruck, kurzlebigere Produktionszyklen und zunehmende Internationalisierung der Märkte – ist die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens auf Dauer nur gewährleistet, wenn es sich durch kundenorientierte, zielgerichtete Maßnahmen und marktorientierte Aktivitäten von Mitbewerbern differenziert. Besonders in der heutigen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Angebot deutlich höher ist als die Nachfrage und der Absatzmarkt eindeutig zum Engpass geworden ist, muss sich die Unternehmung mehr den je am Kunden und Absatzmarkt ausrichten. Das Schlüsselwort hierfür lautet: Marketing.
Während Marketing früher als Synonym für Verkaufen stand, steht Marketing heute für Bedürfnis- und Marktorientierung. Unter anderem ist hierfür die zunehmende Sättigungserscheinung beim Kunden verantwortlich. Die im fünfjährigen Rhythmus durchgeführte Studie „Einkommens- und Verbrauchsstichprobe“ des Statistischen Bundesamts belegt, dass im Jahre 2003 bereits 61,4 % aller Privathaushalte einen Computer besaßen, während 1998 nur 38,7 % sein eigen nannten. Eine weitere Steigerung ist für das Ergebnis in 2008 zu erwarten (vgl. Destatis 2008).
Eine identische Entwicklung lässt sich in sämtlichen Branchen und Produktsparten beobachten. Die Vielfalt der Güter und die Verschiedenheit der Nachfragegruppen führen dahin, dass sich Marketing in Form des sektoralen Marketings mit den spezifischen Problemen der Vermarktung diverser Güter auseinandersetzt. Anhand dieser Arbeit erfolgt eine Abgrenzung zwischen Konsumgütermarketing und Investitionsgütermarketing, die einen Teilbereich des sektoralen Marketings darstellen. Die Arbeit soll einen generellen Überblick über die spezifischen Merkmale und die wesentlichen Unterschiede geben. Je ein Fallbeispiel aus dem Konsumgüter- sowie Investitionsgütermarketing stützen praktisch die beschriebenen theoretischen Ansätze und verdeutlichen, inwiefern sich der Einsatz der marketingpolitischen Instrumente unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung zum Konsum- und Investitionsgütermarketing
- 2 Wesentliche begriffliche Klärungen
- 2.1 Konsumgüter
- 2.2 Konsumgütermarketing
- 2.3 Investitionsgüter
- 2.4 Investitionsgütermarketing
- 3 Abgrenzung Käuferverhalten auf B2C- und B2B-Märkten
- 3.1 Käuferverhalten auf B2C-Märkten
- 3.1.1 Einflussfaktoren und B2C-Kaufentscheidungstypen
- 3.1.2 Konsumentenverhalten als Modell
- 3.2 Käuferverhalten auf B2B-Märkten
- 3.2.1 Merkmale und B2B-Kaufentscheidungstypen
- 3.2.2 Organisationales Beschaffungsverhalten als Modell
- 3.1 Käuferverhalten auf B2C-Märkten
- 4 Konsum- und Investitionsgütermarketing im Vergleich
- 4.1 Besonderheiten im Konsumgütermarketing
- 4.2 Besonderheiten im Investitionsgütermarketing
- 4.3 Wesensmerkmale und Unterschiede im Marketing-Mix
- 4.3.1 Produktpolitik
- 4.3.2 Preispolitik
- 4.3.3 Kommunikationspolitik
- 4.3.4 Distributionspolitik
- 5 Praxisbeispiel mit Situationsanalyse im Marketing-Mix
- 5.1 Konsumgütermarketing
- 5.2 Investitionsgütermarketing
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die wesentlichen Merkmale und Unterschiede zwischen Konsumgütermarketing und Investitionsgütermarketing zu erläutern. Sie bietet einen Überblick über die spezifischen Charakteristika beider Bereiche und veranschaulicht diese anhand von Praxisbeispielen. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Käuferverhalten auf B2C- und B2B-Märkten und analysiert die Besonderheiten des Marketing-Mix in beiden Bereichen.
- Unterschiede im Käuferverhalten auf B2C- und B2B-Märkten
- Spezifische Merkmale des Konsumgütermarketings
- Spezifische Merkmale des Investitionsgütermarketings
- Vergleich des Marketing-Mix in beiden Bereichen
- Praxisbeispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung zum Konsum- und Investitionsgütermarketing: Die Einleitung betont die Bedeutung von kundenorientiertem Marketing angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der Internationalisierung der Märkte. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, sich durch marktorientierte Aktivitäten von Mitbewerbern zu differenzieren, insbesondere in Zeiten von Überangebot. Der Wandel des Marketings vom reinen Verkauf zum Bedürfnis- und Marktorientierung wird im Kontext der Marktsättigung erläutert, unterstützt durch statistische Daten zum Computerbesitz in Privathaushalten. Die Arbeit fokussiert auf die Abgrenzung von Konsumgüter- und Investitionsgütermarketing als Teilbereiche des sektoralen Marketings und verspricht einen Überblick über deren Merkmale und Unterschiede, veranschaulicht durch Fallbeispiele.
2 Wesentliche begriffliche Klärungen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen von Konsumgütern und Investitionsgütern, klassifiziert Konsumgüter nach Kaufgewohnheiten (Güter des täglichen Bedarfs, Suchgüter, Sonderprodukte und Spezialitäten, unbekannte oder unerwünschte Güter) und definiert Konsumgütermarketing als die Ausrichtung auf private Konsumenten.
3 Abgrenzung Käuferverhalten auf B2C- und B2B-Märkten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Unterschieden im Käuferverhalten auf Konsumentenmärkten (B2C) und Geschäftskundenmärkten (B2B). Es analysiert die Einflussfaktoren und Kaufentscheidungstypen auf beiden Märkten, einschließlich der Modellierung des Konsumentenverhaltens und des organisatorischen Beschaffungsverhaltens. Die Kapitel beschreibt die Unterschiede in der Entscheidungsfindung und den involvierten Faktoren.
4 Konsum- und Investitionsgütermarketing im Vergleich: Dieser Abschnitt vergleicht die Besonderheiten des Konsumgüter- und Investitionsgütermarketings. Er analysiert die Unterschiede im Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) für beide Arten von Gütern. Der Fokus liegt auf den spezifischen Herausforderungen und Strategien, die für den Erfolg auf jeweiligen Märkten notwendig sind.
Schlüsselwörter
Konsumgütermarketing, Investitionsgütermarketing, B2C, B2B, Käuferverhalten, Marketing-Mix, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributionspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Marktsättigung.
Häufig gestellte Fragen zum Konsum- und Investitionsgütermarketing
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Unterschiede zwischen Konsumgüter- und Investitionsgütermarketing. Sie beinhaltet eine Einführung, begriffliche Klärungen, eine Analyse des Käuferverhaltens auf B2C- und B2B-Märkten, einen Vergleich des Marketing-Mix in beiden Bereichen und ein Praxisbeispiel. Der Fokus liegt auf der Darstellung der spezifischen Merkmale und Herausforderungen beider Marketingarten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen im Detail: Definitionen von Konsum- und Investitionsgütern, Klassifizierung von Konsumgütern, Analyse des Käuferverhaltens auf B2C- und B2B-Märkten (einschließlich Einflussfaktoren und Kaufentscheidungstypen), Vergleich des Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik) für Konsum- und Investitionsgüter, sowie Praxisbeispiele zur Veranschaulichung der theoretischen Ansätze.
Welche Unterschiede zwischen Konsumgüter- und Investitionsgütermarketing werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die Unterschiede im Käuferverhalten (B2C vs. B2B), die spezifischen Merkmale des Marketing-Mix (Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik) und die jeweiligen Herausforderungen und Strategien für den Erfolg auf den einzelnen Märkten hervor. Die Unterschiede in der Entscheidungsfindung und den involvierten Faktoren werden ebenfalls detailliert beschrieben.
Wie wird das Käuferverhalten auf B2C- und B2B-Märkten abgegrenzt?
Die Arbeit analysiert die Einflussfaktoren und Kaufentscheidungstypen auf Konsumentenmärkten (B2C) und Geschäftskundenmärkten (B2B). Es werden Modelle des Konsumentenverhaltens und des organisatorischen Beschaffungsverhaltens vorgestellt und verglichen, um die Unterschiede in der Entscheidungsfindung und den beteiligten Faktoren zu verdeutlichen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: 1. Einführung, 2. Begriffliche Klärungen (Konsum- und Investitionsgüter), 3. Käuferverhalten (B2C und B2B), 4. Vergleich Konsum- und Investitionsgütermarketing (Marketing-Mix), 5. Praxisbeispiel. Jedes Kapitel behandelt die spezifischen Aspekte des Themas, aufbauend auf den vorherigen Kapiteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Konsumgütermarketing, Investitionsgütermarketing, B2C, B2B, Käuferverhalten, Marketing-Mix, Produktpolitik, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Distributionspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Marktsättigung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die wesentlichen Merkmale und Unterschiede zwischen Konsumgütermarketing und Investitionsgütermarketing zu erläutern und anhand von Praxisbeispielen zu veranschaulichen. Sie soll einen Überblick über die spezifischen Charakteristika beider Bereiche bieten und die Unterschiede im Käuferverhalten und Marketing-Mix aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Tanja Oexler (Autor:in), 2008, Konsumgütermarketing vs. Investitionsgütermarketing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120386