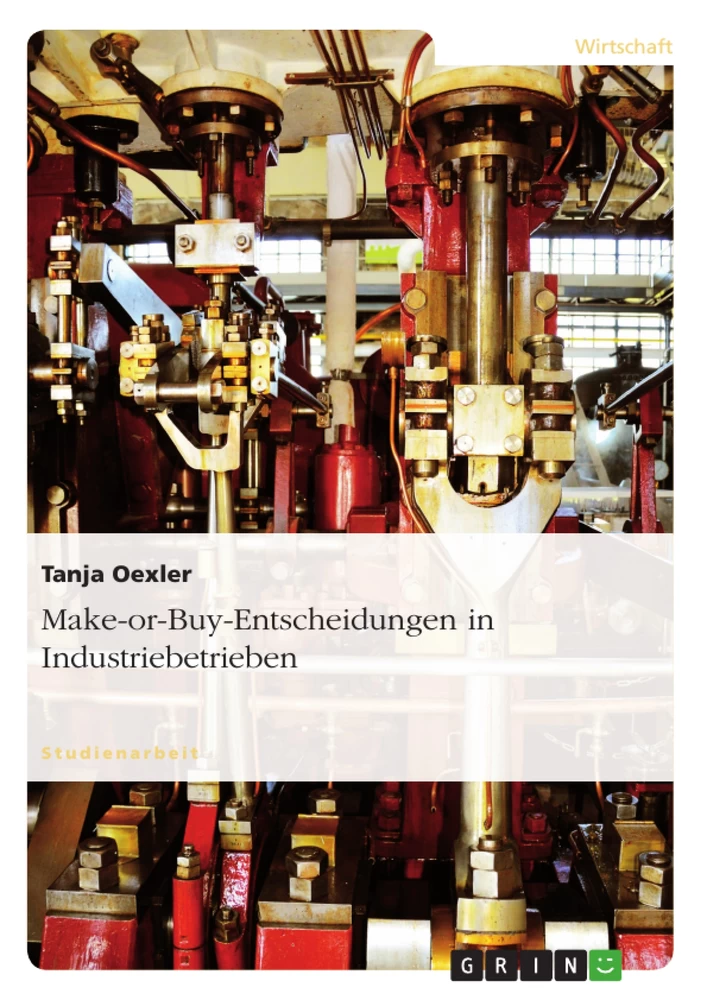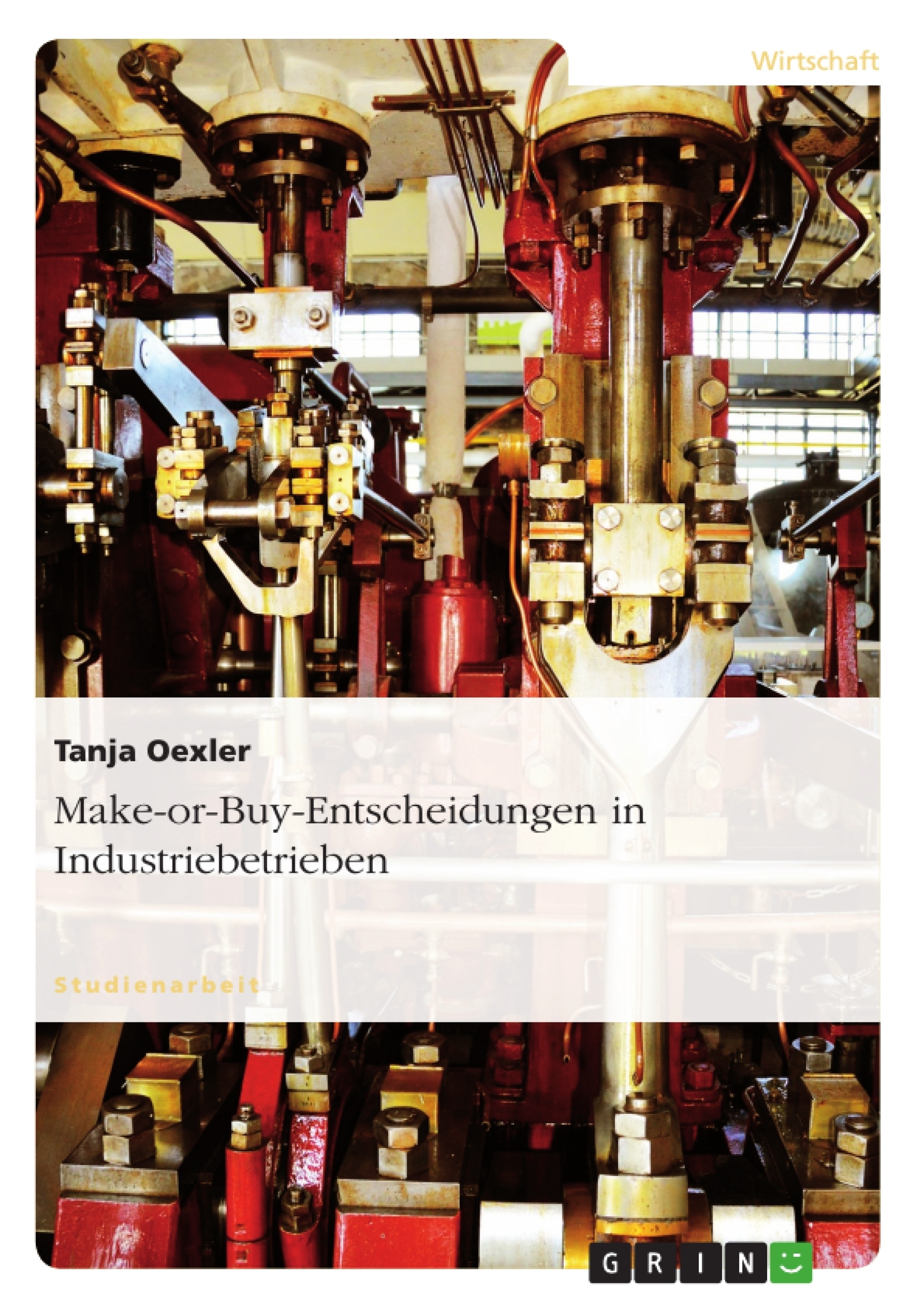Betrachtet man die aktuelle wirtschaftliche Lage – geprägt durch den immer größer werdenden Konkurrenzdruck, kurzlebigere Produktionszyklen und zunehmende Globalisierung der Märkte – ist die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens auf Dauer nur dann gewährleistet, wenn es flexibel und kostengünstig auf die ändernden Marktbedingungen reagieren kann.
In Bezug auf die Fähigkeit des wirtschaftlichen Überlebens muss sich der Unternehmer u.a. mit der Frage auseinandersetzen, ob es lukrativer ist, Produkte in Eigenregie zu fertigen oder gewisse Produkte fremd zu vergeben. An dieser Stelle führen die Überlegungen von der Wettbewerbsfähigkeit direkt zu der Problematik der Entscheidung: Eigenfertigung oder Fremdbezug?
Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um die materielle Herstellung von Gütern, Dienstleistungen oder den Fremdbezug von Forschung und Entwicklung handelt, die Make-or-Buy-Entscheidung ist in sämtlichen Bereichen anzutreffen. Aufgrund der essenziellen Tragweite solcher Entscheidungen ist es von wesentlicher Bedeutung für den wirtschaftlichen und existenzsichernden Erfolg der Unternehmung, die Entscheidung bestens zu fundieren.
Anhand dieser Arbeit wird die Fragestellung „Make or Buy in Industriebetrieben“ erörtert und ein genereller Überblick über die wesentlichen Gesichtspunkte dieser Entscheidung vermittelt. Ein Fallbeispiel soll die beschriebenen theoretischen Ansätze praktisch stützen und verdeutlichen, inwiefern qualitative sowie quantitative Kriterien in der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung zum Thema Make-or-Buy in Industriebetrieben
- Wesentliche begriffliche Klärungen
- Charakterisierung des Begriffs „Make-or-Buy“
- Unterschiede zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug
- Outsourcing
- Make-or-Buy in diversen Betriebsbereichen
- Produktionsbereich
- Forschung und Entwicklung
- Sonstige Bereiche
- Entscheidungsanlässe und Gründe für Make-or-Buy
- Transformationsanlässe
- zur Eigenfertigung
- zum Fremdbezug
- Gründe für Eigenfertigung oder Fremdbezug
- Transformationsanlässe
- Systematisierung der Entscheidungsfindung
- Operative Make-or-Buy-Entscheidungen
- Strategische Make-or-Buy-Entscheidungen
- Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung
- Make-or-Buy-Portfolio
- Punktewertverfahren
- Weitere Instrumente
- Praxisbeispiel Make-or-Buy im Industriebetrieb
- Ausgangsszenario
- Situationsanalyse und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Make-or-Buy-Entscheidungen in Industriebetrieben. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Aspekte dieser Entscheidungen zu geben und die Bedeutung sowohl qualitativer als auch quantitativer Kriterien in der Entscheidungsfindung zu verdeutlichen. Ein Praxisbeispiel soll die theoretischen Ansätze veranschaulichen.
- Begriffliche Klärung von „Make-or-Buy“ und seinen Implikationen
- Unterschiede zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug in verschiedenen Betriebsbereichen
- Analyse von Entscheidungsanlässen und -gründen für Make-or-Buy
- Systematisierung der Entscheidungsfindung (operative und strategische Aspekte)
- Anwendung der theoretischen Konzepte anhand eines Praxisbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung zum Thema Make-or-Buy in Industriebetrieben: Die Einleitung betont die Bedeutung flexibler und kostengünstiger Reaktionen auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck, kurzlebigere Produktionszyklen und die Globalisierung der Märkte. Die zentrale Frage der Eigenfertigung versus Fremdbezug wird als essenziell für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens herausgestellt. Die Arbeit verspricht eine Erörterung der Fragestellung „Make-or-Buy in Industriebetrieben“ und die Vermittlung eines generellen Überblicks, gestützt durch ein praxisnahes Fallbeispiel, welches die Rolle qualitativer und quantitativer Kriterien in der Entscheidungsfindung veranschaulicht.
Wesentliche begriffliche Klärungen: Dieses Kapitel klärt die Begriffe „Make“ und „Buy“ und erläutert die Unterschiede zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug. Es betont, dass die Entscheidung für „Make“ oder „Buy“ ein unternehmerisches Risiko beinhaltet, welches entweder vom Unternehmen selbst getragen oder auf einen Marktpartner übertragen wird. Die Voraussetzungen für Eigenfertigung (Produktionskapazität, finanzielle Mittel, Know-how etc.) und Fremdbezug (Beschaffbarkeit in benötigter Qualität, Menge und Zeit) werden detailliert beschrieben. Schließlich werden die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Alternativen – finanzwirtschaftlicher, kostenmäßiger, kapazitätsmäßiger und qualitativer Natur – hervorgehoben, wobei die divergierenden Auffassungen in Literatur und Praxis bezüglich der kostengünstigeren Variante diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Make-or-Buy, Eigenfertigung, Fremdbezug, Outsourcing, Entscheidungsfindung, Industriebetriebe, Wettbewerbsfähigkeit, Kosten, Kapazität, Qualität, strategische Entscheidungen, operative Entscheidungen, Praxisbeispiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Make-or-Buy in Industriebetrieben"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über Make-or-Buy-Entscheidungen in Industriebetrieben. Sie behandelt begriffliche Klärungen, Entscheidungsanlässe und -gründe, systematische Entscheidungsfindung (operativ und strategisch) und veranschaulicht die Theorie anhand eines Praxisbeispiels. Der Fokus liegt auf der Bedeutung sowohl qualitativer als auch quantitativer Kriterien.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Abgrenzung von "Make" und "Buy", Unterschiede zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug in verschiedenen Betriebsbereichen (Produktion, Forschung & Entwicklung etc.), Analyse von Entscheidungsanlässen (Transformationsanlässe), Gründe für Eigenfertigung oder Fremdbezug, Systematisierung der Entscheidungsfindung (mit Hilfsmitteln wie Make-or-Buy-Portfolio und Punktewertverfahren), und ein ausführliches Praxisbeispiel mit Situationsanalyse und Bewertung.
Welche Arten von Make-or-Buy-Entscheidungen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen operativen und strategischen Make-or-Buy-Entscheidungen. Operative Entscheidungen betreffen den kurzfristigen Bezug von Gütern und Dienstleistungen, während strategische Entscheidungen langfristige Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie haben.
Welche Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung, darunter das Make-or-Buy-Portfolio und das Punktewertverfahren. Zusätzlich werden weitere Instrumente erwähnt.
Welche Schlüsselfaktoren beeinflussen Make-or-Buy-Entscheidungen?
Wichtige Faktoren sind Kosten, Kapazität, Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und die Verfügbarkeit von Ressourcen (Know-how, finanzielle Mittel etc.). Die Arbeit betont die Berücksichtigung sowohl quantitativer als auch qualitativer Kriterien.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Make-or-Buy-Entscheidungen in Industriebetrieben zu vermitteln und die Bedeutung einer fundierten Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien zu verdeutlichen.
Wie wird die Theorie veranschaulicht?
Ein detailliertes Praxisbeispiel veranschaulicht die Anwendung der theoretischen Konzepte und die Rolle qualitativer und quantitativer Kriterien in der Entscheidungsfindung.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Make-or-Buy, Eigenfertigung, Fremdbezug, Outsourcing, Entscheidungsfindung, Industriebetriebe, Wettbewerbsfähigkeit, Kosten, Kapazität, Qualität, strategische Entscheidungen, operative Entscheidungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich des Produktionsmanagements, des Supply Chain Managements und der Unternehmensführung in Industriebetrieben.
- Quote paper
- Tanja Oexler (Author), 2008, Make-or-Buy-Entscheidungen in Industriebetrieben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120384