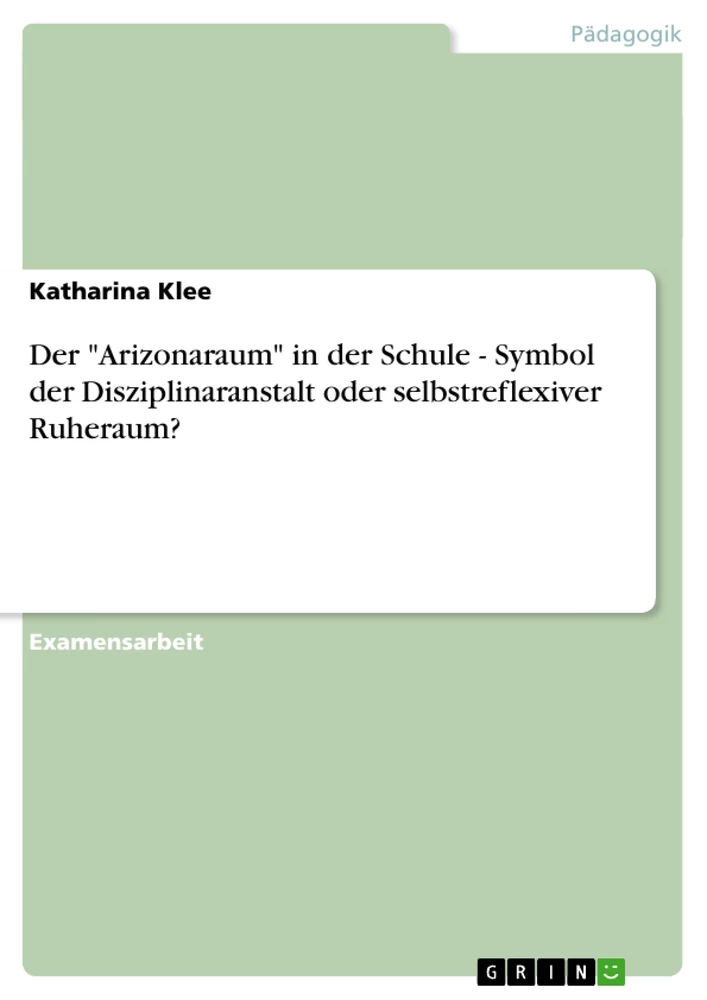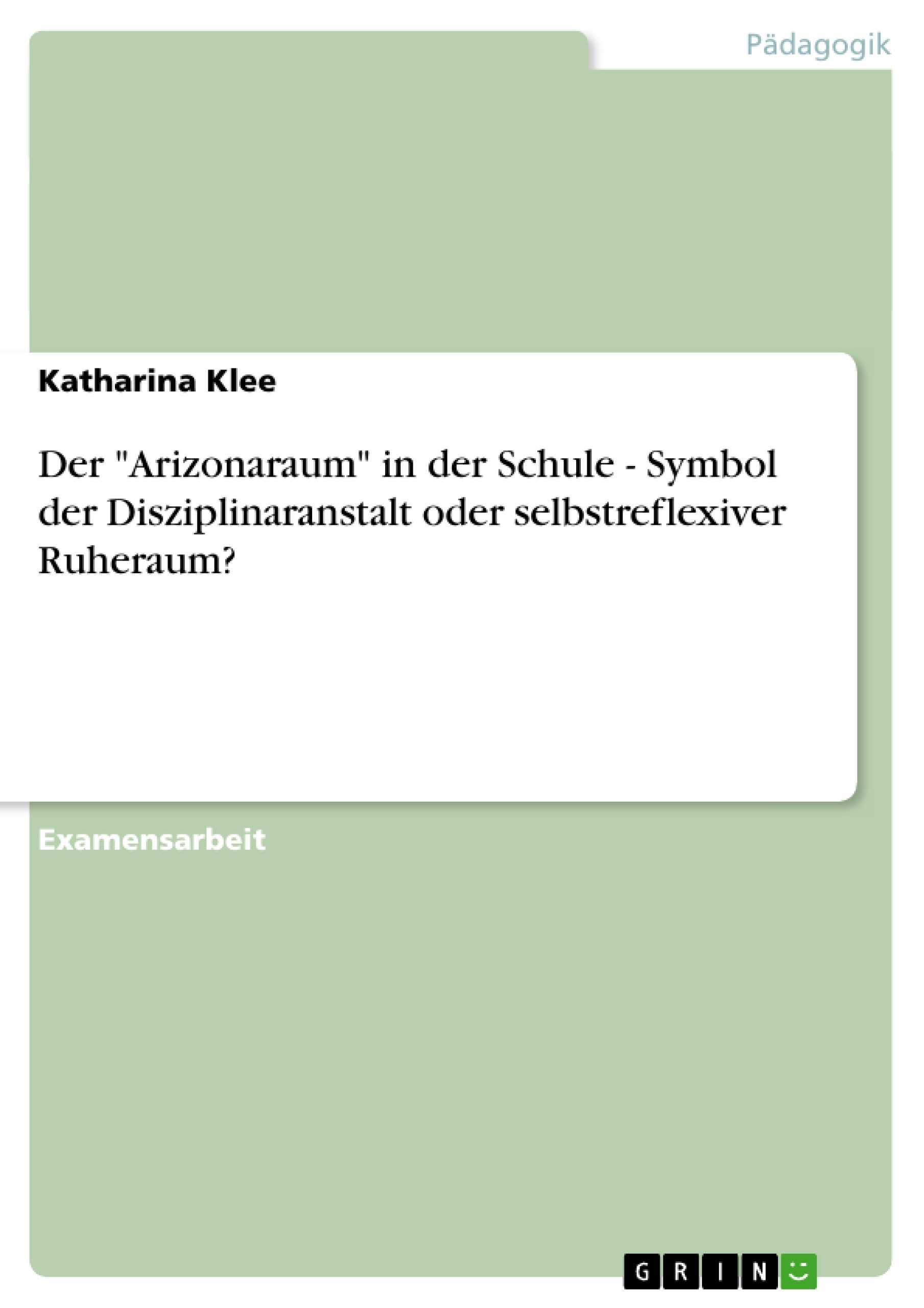Unterrichtsstörungen gehören an den meisten Schulen zur Tagesordnung. Das Getuschel in der letzten Reihe oder das fliegende Mäppchen scheinen vielerorts ebenso selbstverständlich wie der Tafelanschrieb und der endlose Lehrervortrag. Diese Störungen stellen für die Lehrer, im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Unterrichts, ein großes Hindernis dar und können bis zu 60% einer Unterrichtsstunde ausmachen. Die Reaktionen der Lehrer auf die Störungen sind vielfältig und breit gestreut: Sie reichen vom energischen Einschreiten bis hin zum gänzlichen Ignorieren des Schülerverhaltens. Es ist jedoch gleichgültig, wie der Lehrer reagiert, denn in jedem Fall stellt eine solche Unterbrechung eine Belastung dar. Es kommt nicht von ungefähr, dass immer
mehr Lehrer über psychisch-vegetative beziehungsweise psychosomatische Beschwerden klagen und aus diesem Grund frühpensioniert werden. Neben diesen emotionalen Beschwerden können Unterrichtsstörungen aber auch zu Aggressionen und Ungerechtigkeiten gegenüber der Klasse führen, was wiederum die Schüler als sehr unangenehm erleben. Dies kommt vor allem
dadurch, dass die Lehrer häufig spontan Maßnahmen ergreifen, die für die Schüler nicht berechenbar sind. Mit diesen Maßnahmen wollen die Lehrer meist nur die Handlungen der Schüler beeinflussen, nicht aber deren Denken, Wünsche und Zielsetzungen. Letzteres wäre jedoch wichtig, um die Störungen auch langfristig beheben zu können. Wie aber soll es der Lehrer schaffen, die Klasse zu unterrichten und gleichzeitig auf die Hintergründe der Störaktionen der einzelnen Schüler einzugehen?
Ein Lösungsansatz bietet das Trainingsraum - Programm, auch „Arizonaraum“-Programm genannt, das 1996
von Dr. Stefan Balke in Deutschland eingeführt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematische Relevanz und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Unterrichtsstörungen
- Verschiedene Definitionen zum Begriff „Unterrichtsstörungen“
- Wünsche und Vorstellungen der Lehrer für ihren Unterricht
- Unterrichtsstörungen aus Lehrersicht
- Unterrichtstörungen aus Schülersicht
- Verschiedene Typen von „Unterrichtsstörungen“
- Unterrichtsstörungen, die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen von Schülern resultieren
- Unterrichtsstörungen, die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen der Lehrkräfte resultieren
- Unterrichtsstörungen, die durch äußere Ereignisse entstehen
- Der Einfluss der Schüler, Lehrer und der Schule als Institution im Hinblick auf die Entstehung von Unterrichtsstörungen
- Die Schule als Institution
- Der Einfluss der störenden Schüler
- Der Einfluss des jeweiligen Lehrerverhaltens
- Folgen von Unterrichtsstörungen
- Welche Möglichkeiten haben die Lehrer den Unterrichtsstörungen entgegenzuwirken?
- Das „Arizonaraum“ - Programm
- Der Ursprung des Programms
- Die Gründer des Programms
- Die Wahrnehmungskontrolltheorie nach William T. Powers
- Warum die üblichen Theorien über das Verhalten nicht ausreichen
- Die Funktion der Wahrnehmungskontrolltheorie
- Die Erklärung des Streitverhaltens
- Die Wahrnehmungskontrolltheorie in Verbindung mit Unterrichtsstörungen
- Die Grundzüge des „Arizonaraum“ – Programms
- Allgemeine Ziele
- Pädgogische Prinzipien
- Konkrete Abläufe
- Realisierung in der Praxis
- Die Umsetzung des Programms nach Balke
- Die Umsetzung des Programms nach Bründel und Simon
- Gegenüberstellung der beiden Abläufe
- Die Ausbildung des „Arizonaraum“ - Teams
- Die Ziele des Programms
- An welchen Schulen wird das Programm eingesetzt?
- Strafe und Gerechtigkeit im Hinblick auf das „Arizonaraum“ - Programm
- Ist das Programm rechtlich zulässig?
- § 82 Hessisches Schulgesetz: Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen
- Einige Maßnahmen des „Arizonaraum“ – Programms und deren rechtliche Zuordnung
- Die Voraussetzungen für eine gerechte und sinnvolle Anwendung des Programms
- Bekannte Gründe für eine fehlerhafte Durchführung des „Arizonaraum“ – Programms nach Balz
- Beschreibung der Schule
- Der Einsatz des „Arizonaraum\" - Programms am Beispiel der Langenbergschule in Birkenau
- Die Umsetzung des „Arizonaraum“ – Programms
- Der Ablauf in der Klasse
- Der Ablauf im Arizonaraum
- Die Rückkehr in die Klasse
- Weiterführende Maßnahmen
- Die Ausbildung der „Arizonaraum“ – Betreuer
- Eigene Schülerbefragung zum „Arizonaraum“ an der Langenbergschule
- Durchführung der eigenen Befragung
- Auswertung der Fragebögen
- Résumée: Der „Arizonaraum“ in der Schule – Disziplinaranstalt oder selbstreflexiver Ruheraum?
- Gegenüberstellung der Theorie und der Ergebnisse des Fragebogens
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das „Arizonaraum“-Programm als Ansatz zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen. Ziel ist es, das Programm im Kontext bestehender Theorien und rechtlicher Rahmenbedingungen zu analysieren und seine Effektivität anhand eines Praxisbeispiels zu beleuchten.
- Ursachen und Folgen von Unterrichtsstörungen
- Das „Arizonaraum“-Programm: Theorie und Praxis
- Rechtliche Aspekte des Programms
- Schülerperspektive auf das „Arizonaraum“-Programm
- Bewertung der Effektivität des Programms
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Unterrichtsstörungen ein, verdeutlicht deren Relevanz und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Problematik von Unterrichtsstörungen für Lehrer und Schüler hervor und stellt das „Arizonaraum“-Programm als Lösungsansatz vor. Die Zielsetzung der Arbeit wird klar definiert: Analyse des Programms im Hinblick auf seine Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit.
Unterrichtsstörungen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von Unterrichtsstörungen aus Lehrer- und Schülerperspektive und untersucht die Ursachen und Folgen dieser Störungen. Es werden verschiedene Typen von Störungen differenziert und der Einfluss von Schülern, Lehrern und der Schule als Institution auf die Entstehung von Störungen beleuchtet. Schließlich werden mögliche Maßnahmen zur Prävention und Intervention diskutiert.
Das „Arizonaraum“-Programm: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das „Arizonaraum“-Programm, beginnend mit seinem Ursprung und den beteiligten Personen. Die zugrundeliegende Wahrnehmungskontrolltheorie wird erklärt und in Bezug zu Unterrichtsstörungen gesetzt. Die Grundzüge des Programms werden dargestellt, und verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten werden verglichen. Die Verbreitung und die Ziele des Programms werden ebenfalls thematisiert.
Strafe und Gerechtigkeit im Hinblick auf das „Arizonaraum“-Programm: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Aspekte des „Arizonaraum“-Programms im Kontext des hessischen Schulgesetzes. Es wird geprüft, ob die im Programm angewendeten Maßnahmen rechtlich zulässig sind und welche Voraussetzungen für eine gerechte und sinnvolle Anwendung des Programms erfüllt sein müssen. Mögliche Fehlerquellen bei der Durchführung werden ebenfalls erörtert.
Beschreibung der Schule und Einsatz des „Arizonaraum“-Programms: Dieses Kapitel beschreibt den Einsatz des „Arizonaraum“-Programms an der Langenbergschule in Birkenau. Es berichtet über die konkrete Umsetzung des Programms, beginnend mit dem Ablauf im Unterricht über den Aufenthalt im „Arizonaraum“ bis hin zur Rückkehr in die Klasse und weiterführenden Maßnahmen. Die Ausbildung der Betreuer wird ebenfalls detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, „Arizonaraum“-Programm, Wahrnehmungskontrolltheorie, Schulgesetz, rechtliche Zulässigkeit, Schülerbeteiligung, Praxisbeispiel, Effektivität, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das „Arizonaraum“-Programm
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das „Arizonaraum“-Programm als Methode zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen. Sie analysiert das Programm im Kontext bestehender Theorien und rechtlicher Rahmenbedingungen und beleuchtet dessen Effektivität anhand eines Praxisbeispiels an der Langenbergschule in Birkenau.
Welche Aspekte von Unterrichtsstörungen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von Unterrichtsstörungen aus Lehrer- und Schülerperspektive, untersucht deren Ursachen und Folgen, differenziert verschiedene Störungstypen und beleuchtet den Einfluss von Schülern, Lehrern und der Schule auf deren Entstehung. Mögliche Maßnahmen zur Prävention und Intervention werden ebenfalls diskutiert.
Was ist das „Arizonaraum“-Programm?
Das „Arizonaraum“-Programm ist ein Ansatz zur Bewältigung von Unterrichtsstörungen. Die Arbeit beschreibt detailliert seinen Ursprung, die beteiligten Personen und die zugrundeliegende Wahrnehmungskontrolltheorie nach William T. Powers. Verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten des Programms werden verglichen, und seine Verbreitung und Ziele werden thematisiert.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmungskontrolltheorie?
Die Wahrnehmungskontrolltheorie bildet die theoretische Grundlage des „Arizonaraum“-Programms. Die Arbeit erklärt die Theorie und zeigt, wie sie das Verständnis und die Bewältigung von Streitverhalten und Unterrichtsstörungen unterstützt. Sie erläutert, warum übliche Verhaltenstheorien nicht ausreichen und wie die Wahrnehmungskontrolltheorie diese Lücke schließt.
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die rechtliche Zulässigkeit des „Arizonaraum“-Programms im Kontext des hessischen Schulgesetzes (§ 82). Sie untersucht, ob die im Programm angewendeten Maßnahmen rechtmäßig sind und welche Voraussetzungen für eine gerechte und sinnvolle Anwendung erfüllt sein müssen. Mögliche Fehlerquellen bei der Durchführung werden ebenfalls erörtert.
Wie wird das Programm an der Langenbergschule in Birkenau umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt detailliert den Einsatz des „Arizonaraum“-Programms an der Langenbergschule in Birkenau. Der Ablauf im Unterricht, der Aufenthalt im „Arizonaraum“, die Rückkehr in die Klasse und weiterführende Maßnahmen werden beschrieben. Die Ausbildung der Betreuer wird ebenfalls detailliert dargestellt.
Welche Ergebnisse liefert die Schülerbefragung?
Die Arbeit beinhaltet eine eigene Schülerbefragung zur Einschätzung des „Arizonaraum“-Programms an der Langenbergschule. Die Durchführung und Auswertung der Fragebögen werden vorgestellt, und die Ergebnisse werden im Kontext der theoretischen Überlegungen und der Praxisbeobachtungen diskutiert.
Welches Fazit zieht die Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Theorie mit den Ergebnissen der Schülerbefragung und zieht ein Fazit zur Effektivität und Rechtmäßigkeit des „Arizonaraum“-Programms. Sie diskutiert, ob das Programm als Disziplinaranstalt oder selbstreflexiver Ruheraum betrachtet werden kann und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, „Arizonaraum“-Programm, Wahrnehmungskontrolltheorie, Schulgesetz, rechtliche Zulässigkeit, Schülerbeteiligung, Praxisbeispiel, Effektivität, Prävention, Intervention.
- Citar trabajo
- Katharina Klee (Autor), 2008, Der "Arizonaraum" in der Schule. Symbol der Disziplinaranstalt oder selbstreflexiver Ruheraum?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120205