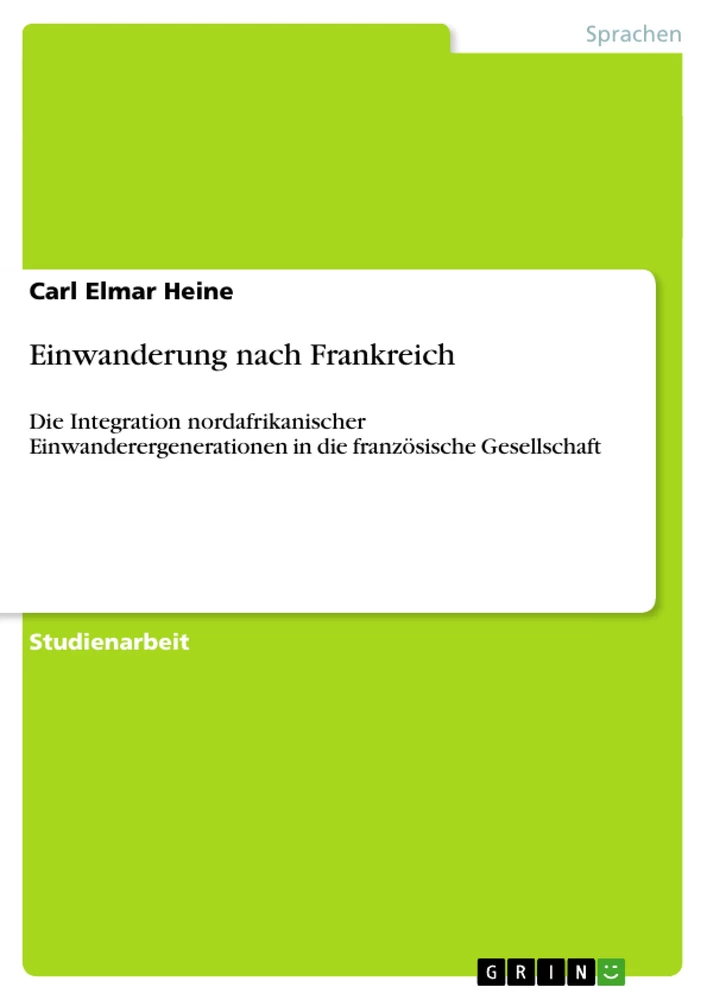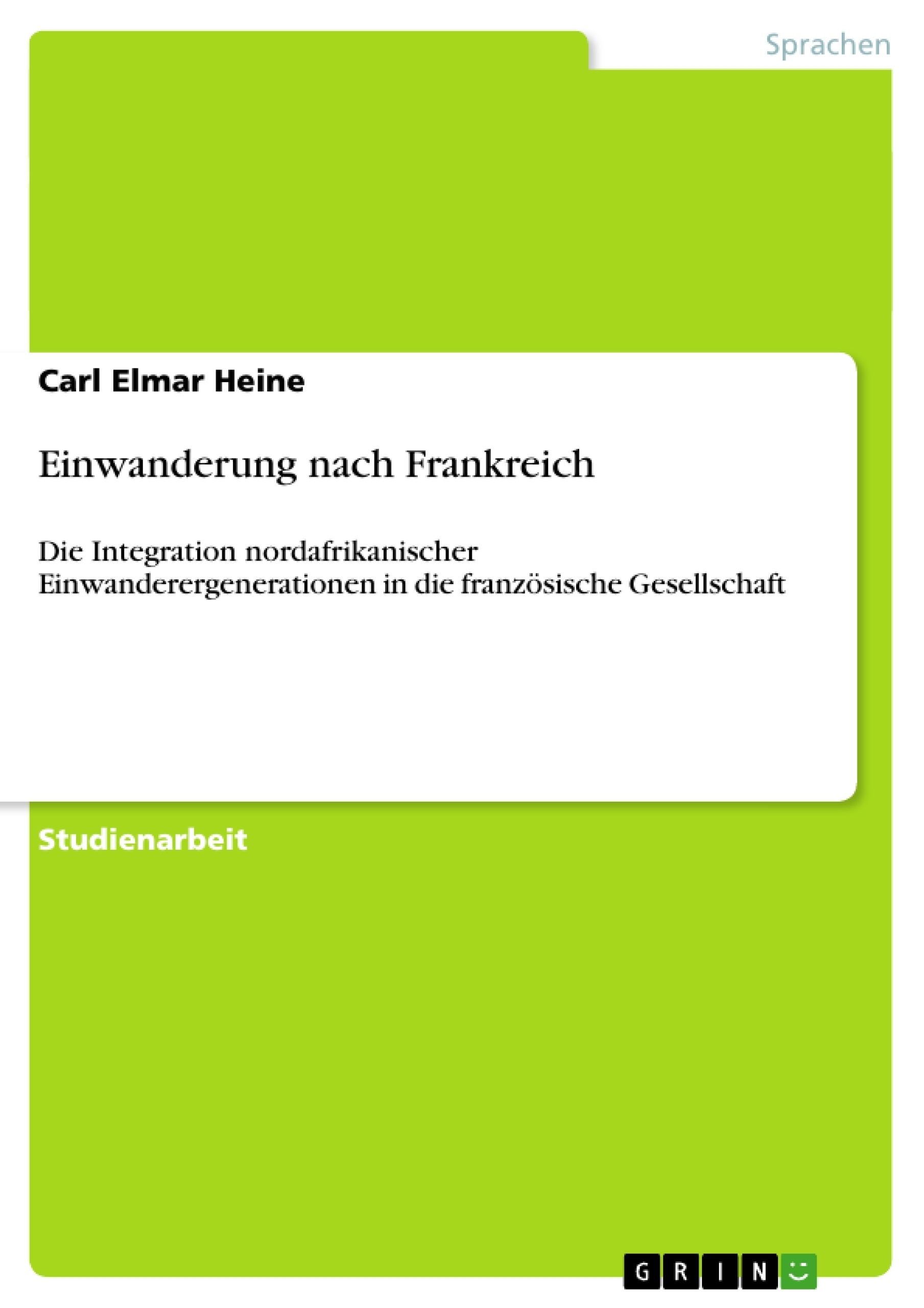Spätestens seit dem erneuten Ausbruch der Unruhen in den französischen Vorstädten im Oktober 2005, die vor allem durch ein zuvor in seinem Ausmaß deutlich unterschätztes Hasspotential der Jugendlichen aus den Banlieues gekennzeichnet waren, rückt man in der öffentlichen Debatte um die Integration der zweiten und dritten Einwanderergeneration wieder vermehrt die Möglichkeit des Scheiterns des französischen Integrationsmodells ins Zentrum der Diskussion.
In diesem Zusammenhang geht es fast ausschließlich um die Bevölkerungsgruppe der so genannten Beurs, der jungen Araber aus Nordafrika und dort überwiegend aus den Ländern Algerien und Marokko. Diese Gruppe, die sich aus den Nachkommen der zum größten Teil in den 60er und 70er Jahren zugewanderten nordafrikanischen Gastarbeiterfamilien zusammensetzt, steht seit den 80er Jahren ununterbrochen im Mittelpunkt einer Diskussion um eine geglückte oder misslungene vollständige Integration von Ausländern in Frankreich.
In dieser Arbeit wird auf geschichtliche Hintergründe der Einwanderung, die besondere Problematik der Kolonialherrschaft in Nordafrika und die Integration nordafrikanischer Einwanderer in die französische Gesellschaft eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Hintergrund
- 3. Das problematische Erbe des Kolonialismus am Beispiel Algeriens
- 3.1 Die französischen Staatsbürger Algeriens
- 3.2 Doppeltes Bodenrecht für junge Algerier
- 4. Die heraufbeschworene Identitätskrise der zweiten Generation
- 4.1 Problematische Eingliederung in die Gesellschaft
- 4.2 Ausgrenzung durch französische Integrationspolitik?
- 5. Lösungsansätze
- 6. Fazit
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration nordafrikanischer Einwanderergenerationen in die französische Gesellschaft, insbesondere im Kontext der Unruhen in den französischen Vorstädten. Sie analysiert die Herausforderungen der Integration unter Berücksichtigung historischer und politischer Faktoren.
- Das problematische Erbe des französischen Kolonialismus in Nordafrika und dessen Einfluss auf die Integration.
- Die Schwierigkeiten der zweiten Generation nordafrikanischer Einwanderer bei der Eingliederung in die französische Gesellschaft.
- Die Rolle der französischen Integrationspolitik und ihre Auswirkungen auf die Integration von Einwanderern.
- Die kulturellen Unterschiede und deren Einfluss auf die Integration.
- Mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung der Integration.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Unruhen in den französischen Vorstädten und deren Zusammenhang mit der Integration der zweiten und dritten Einwanderergeneration. Sie führt die beiden zentralen Hypothesen der Arbeit ein: Erstens, dass ein kulturelles Wertesystem, das mit europäischen Normen nicht kompatibel ist, zu Spannungen führt; und zweitens, dass die französische Integrationspolitik seit der Kolonialzeit zu Desintegration beiträgt. Der Fokus liegt auf der Bevölkerungsgruppe der „Beurs“, jungen Arabern aus Nordafrika, insbesondere Algeriern und Marokkanern.
2. Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel skizziert die Geschichte der Einwanderung nach Frankreich, beginnend mit dem 18. und 19. Jahrhundert, als Frankreich aufgrund von Industrialisierung und sinkender Geburtenrate Arbeitskräfte benötigte. Es werden die Anwerbeabkommen mit europäischen Ländern nach den Weltkriegen erwähnt, sowie die Zunahme der Einwanderung aus ehemaligen französischen Kolonien nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg. Der Kapitel beschreibt die zwei wesentlichen Einwanderungsformen: Arbeitskräfte und französische Staatsbürger aus den Kolonien, wobei letztere bis heute nicht vollständig integriert sind.
3. Das problematische Erbe des Kolonialismus am Beispiel Algeriens: Dieses Kapitel analysiert das Erbe des französischen Kolonialismus in Algerien und dessen Einfluss auf die Integration algerischer Einwanderer in Frankreich. Es beleuchtet die schwierige Situation französischer Staatsbürger algerischer Herkunft und das doppelte Bodenrecht junger Algerier. Dieses Kapitel bildet die Grundlage für das Verständnis der anhaltenden Integrationsherausforderungen, die sich aus der kolonialen Vergangenheit ergeben.
4. Die heraufbeschworene Identitätskrise der zweiten Generation: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen, denen sich die zweite Generation nordafrikanischer Einwanderer in Frankreich gegenübersieht. Es behandelt die problematische Eingliederung in die Gesellschaft, in Bezug auf Wohnsituation, Arbeitslosigkeit und Schulausbildung, und hinterfragt kritisch die französische Integrationspolitik und ihren Einfluss auf die Ausgrenzung dieser Gruppe. Der Fokus liegt auf dem republikanischen Gedanken und dem (Miss-)Verständnis einer erfolgreichen Integration.
5. Lösungsansätze: Dieses Kapitel, welches leider nicht im Ausgangstext enthalten ist, würde vermutlich verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Integration nordafrikanischer Einwanderer in die französische Gesellschaft untersuchen und beleuchten. Es wäre zu erwarten, dass Konzepte zur Förderung der kulturellen Teilhabe, zur Verbesserung der Bildung und des Arbeitsmarktzugangs, sowie Strategien zur Bekämpfung der Diskriminierung und Ausgrenzung im Mittelpunkt stünden.
Schlüsselwörter
Integration, Einwanderung, Frankreich, Nordafrika, Algerien, Kolonialismus, Identitätskrise, zweite Generation, Integrationspolitik, Beurs, Banlieues, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung, kulturelle Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Integration nordafrikanischer Einwanderer in Frankreich
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Integration nordafrikanischer Einwanderergenerationen in die französische Gesellschaft, insbesondere im Kontext der Unruhen in den französischen Vorstädten. Sie analysiert die Herausforderungen der Integration unter Berücksichtigung historischer und politischer Faktoren, mit besonderem Fokus auf die „Beurs“, junge Araber aus Nordafrika (Algerien und Marokko).
Welche zentralen Hypothesen werden aufgestellt?
Die Arbeit geht von zwei zentralen Hypothesen aus: Erstens, dass ein kulturelles Wertesystem, das mit europäischen Normen nicht kompatibel ist, zu Spannungen führt; und zweitens, dass die französische Integrationspolitik seit der Kolonialzeit zu Desintegration beiträgt.
Welche Aspekte des historischen Hintergrunds werden behandelt?
Das Kapitel zum historischen Hintergrund beleuchtet die Einwanderung nach Frankreich seit dem 18. und 19. Jahrhundert, die Anwerbeabkommen nach den Weltkriegen und die zunehmende Einwanderung aus ehemaligen französischen Kolonien nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg. Es werden die zwei wesentlichen Einwanderungsformen – Arbeitskräfte und französische Staatsbürger aus den Kolonien – beschrieben, wobei letztere bis heute nicht vollständig integriert sind.
Wie wird das problematische Erbe des Kolonialismus behandelt?
Das problematische Erbe des französischen Kolonialismus in Algerien und dessen Einfluss auf die Integration algerischer Einwanderer wird am Beispiel der schwierigen Situation französischer Staatsbürger algerischer Herkunft und des doppelten Bodenrechts junger Algerier analysiert. Dieses Kapitel zeigt, wie die koloniale Vergangenheit die anhaltenden Integrationsherausforderungen prägt.
Welche Herausforderungen der zweiten Generation werden beleuchtet?
Das Kapitel zur zweiten Generation untersucht die problematische Eingliederung in die Gesellschaft, betrachtet Aspekte wie Wohnsituation, Arbeitslosigkeit und Schulausbildung und hinterfragt kritisch die französische Integrationspolitik und ihren Einfluss auf die Ausgrenzung dieser Gruppe. Der republikanische Gedanke und das (Miss-)Verständnis einer erfolgreichen Integration werden ebenfalls thematisiert.
Was wird in Bezug auf Lösungsansätze diskutiert?
Das Kapitel zu Lösungsansätzen (leider nicht im Ausgangstext enthalten) würde vermutlich verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Integration untersuchen, wie z.B. die Förderung der kulturellen Teilhabe, die Verbesserung der Bildung und des Arbeitsmarktzugangs sowie Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, Einwanderung, Frankreich, Nordafrika, Algerien, Kolonialismus, Identitätskrise, zweite Generation, Integrationspolitik, Beurs, Banlieues, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung, kulturelle Unterschiede.
Welche Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis enthalten?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Historischer Hintergrund, Das problematische Erbe des Kolonialismus am Beispiel Algeriens (mit Unterkapiteln), Die heraufbeschworene Identitätskrise der zweiten Generation (mit Unterkapiteln), Lösungsansätze, Fazit und Literatur.
- Quote paper
- Carl Elmar Heine (Author), 2008, Einwanderung nach Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120190