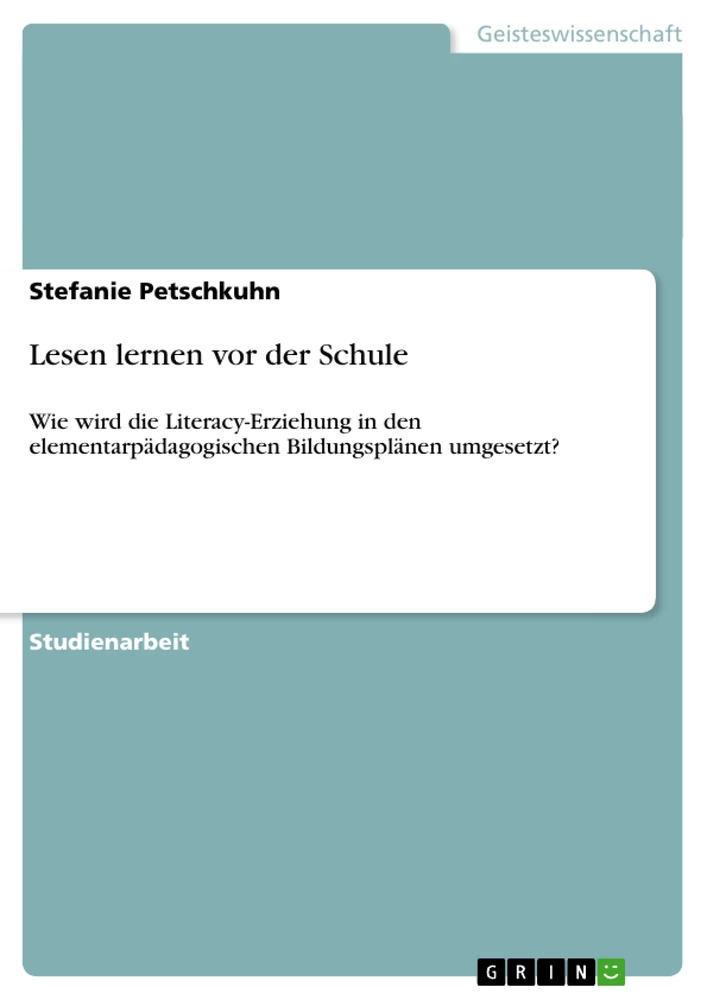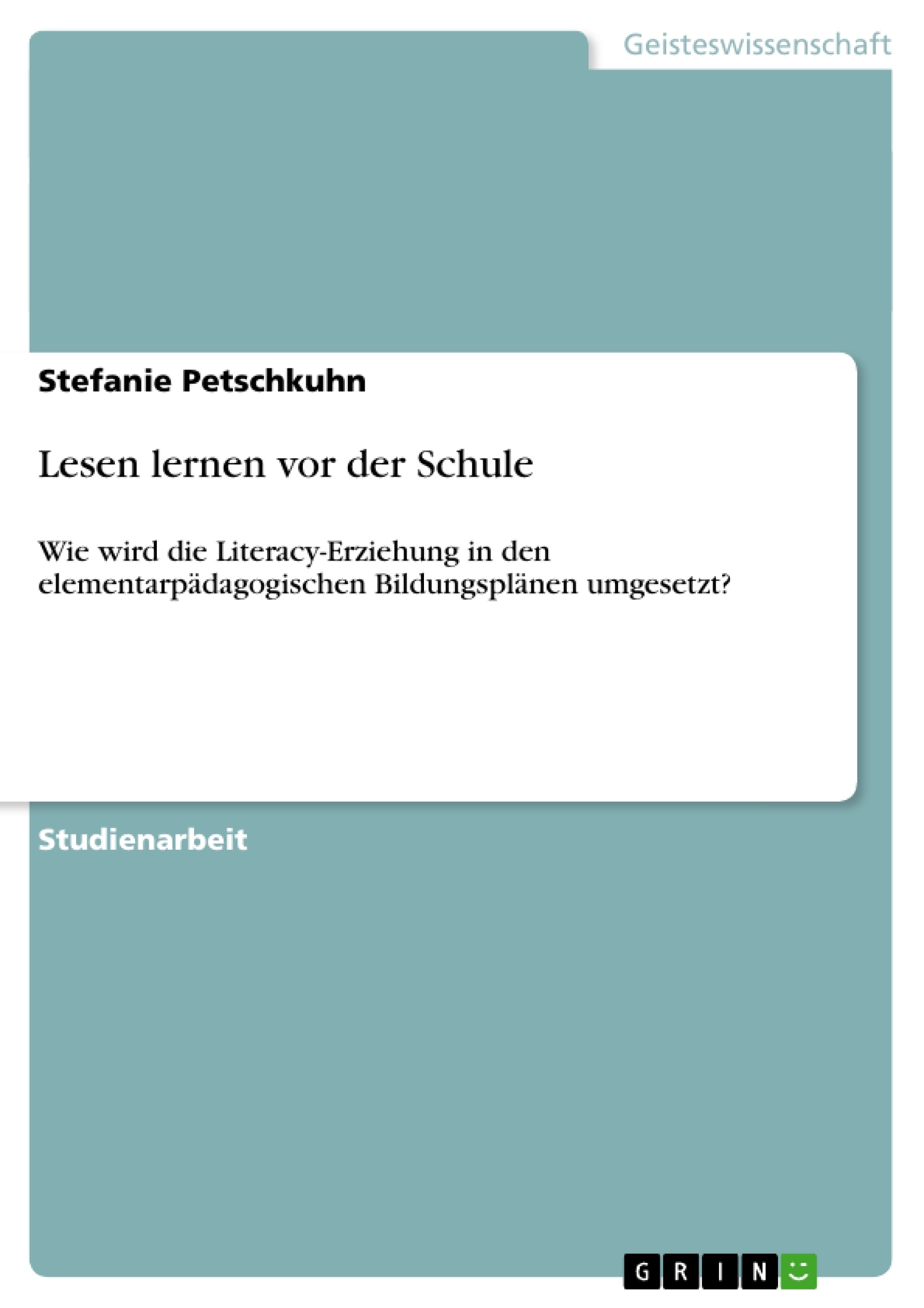Ich möchte in meiner Arbeit herausarbeiten in wie weit die Bildungspläne der
Bundesländer auf das Thema „frühes Lesen“, in der Fachsprache oft „Literacy“
genannt, eingehen. Dabei soll geklärt werden, ob, und wenn ja, worin die
Bildungspläne sich in der Umsetzung des Themas frühe Schreib- und
Leseerfahrungen unterscheiden. Die Aufmerksamkeit soll vor allem dem frühen
Lesen gewidmet werden.
Als theoretische Grundlage ziehe ich den lebensbezogenen Ansatz heran, eine
Pädagogik, die ihren Ausgangspunkt im Leben eines jeden Kindes sieht.
Einleitend kläre ich den Begriff „Literacy“, erläutere, ab wann und wie Kinder im Alltag
sich für Schrift und Lesen interessieren und fasse zusammen, wie man nach dem lebensbezogenen Ansatz das Thema Sprachförderung und „frühes Lesen“ im
Kindergarten realisieren kann. Mit diesem Hintergrund werde ich dann die
Bildungspläne der Bundesländer Saarland, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz,
Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern nach dem Thema Literacy, Literalität oder
Erfahrungen mit Schrift durcharbeiten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klärung des Begriffs „Literacy“
- Wie Kinder vor der Schule lesen lernen?
- Wie kann Sprachentwicklungsförderung als Grundlage für Lesekompetenz im Kindergarten umgesetzt werden?
- Rollenspiele
- Darstellung der Bildungspläne der einzelnen Bundesländer
- Saarland
- Bremen
- Hamburg
- Rheinland-Pfalz
- Sachsen
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Kritischer Vergleich der dargestellten Bildungspläne
- Weiterführende und eigene Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung von Literacy-Erziehung in elementarpädagogischen Bildungsplänen der Bundesländer. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise an frühe Lese- und Schreiberfahrungen aufzuzeigen und die Berücksichtigung des Themas „frühes Lesen“ in den jeweiligen Bildungsplänen zu analysieren. Der lebensbezogene Ansatz dient als theoretische Grundlage.
- Definition und Bedeutung von „Literacy“
- Methoden der Sprachentwicklungsförderung im Kindergarten
- Analyse der Bildungspläne verschiedener Bundesländer hinsichtlich des Themas „frühes Lesen“
- Vergleich der Ansätze zur Förderung von Lese- und Schreibkompetenz
- Perspektiven für die zukünftige Literacy-Förderung im Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung frühkindlicher Förderung für die Entwicklung von Lese- und Schreibkompetenz und die Notwendigkeit, diese bereits im Kindergarten zu berücksichtigen. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsansatz, der sich auf die Analyse von Bildungsplänen verschiedener Bundesländer konzentriert, um die Umsetzung von Literacy-Erziehung zu untersuchen. Die Bedeutung frühkindlicher Bildung und der lebensbezogene Ansatz als theoretische Grundlage werden hervorgehoben.
Klärung des Begriffs „Literacy“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Literacy“, der im Englischen seinen Ursprung hat. Es wird deutlich gemacht, dass eine einfache Übersetzung in „Lese- und Schreibkompetenz“ zu kurz greift, da wichtige Aspekte wie Textverständnis, Symbolverständnis, Sprachgefühl und Lesefreude nicht erfasst werden. Die UNESCO-Definition von Literacy wird vorgestellt, die den Begriff umfassender definiert.
Wie Kinder vor der Schule lesen lernen?: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext und mit aussagekräftigem Inhalt) würde die natürlichen Wege beschreiben, auf denen Kinder vor der Schule mit Schrift und Lesen in Kontakt kommen und ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln. Es würde mögliche Phasen und Entwicklungsschritte beleuchten und möglicherweise auf unterschiedliche Lernstile eingehen.
Wie kann Sprachentwicklungsförderung als Grundlage für Lesekompetenz im Kindergarten umgesetzt werden?: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext und mit aussagekräftigem Inhalt) würde sich mit konkreten Methoden der Sprachförderung befassen, die die Entwicklung von Lesekompetenz im Kindergarten unterstützen. Es würde vielfältige Ansätze beschreiben, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und die Bedeutung des spielerischen Lernens betonen. Ein Beispiel wie Rollenspiele könnte detaillierter erläutert werden.
Darstellung der Bildungspläne der einzelnen Bundesländer: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext und mit aussagekräftigem Inhalt) würde die Bildungspläne der genannten Bundesländer im Detail analysieren. Es würde die jeweiligen Schwerpunkte, Ansätze und Methoden der Literacy-Förderung darstellen und mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Bundesländern herausarbeiten. Jedes Bundesland (Saarland, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern) würde in einem eigenen Unterkapitel behandelt.
Kritischer Vergleich der dargestellten Bildungspläne: Dieses Kapitel (falls vorhanden im Originaltext und mit aussagekräftigem Inhalt) würde einen kritischen Vergleich der in den vorherigen Kapiteln analysierten Bildungspläne bieten, Stärken und Schwächen aufzeigen und mögliche Verbesserungsvorschläge formulieren. Es würde die verschiedenen Ansätze in Relation setzen und möglicherweise Empfehlungen für eine optimierte Literacy-Förderung im Kindergarten abgeben.
Schlüsselwörter
Literacy, Literalität, frühes Lesen, Sprachentwicklungsförderung, elementarpädagogische Bildungspläne, Kindergarten, Lesekompetenz, Schreibkompetenz, Bundesländer, Bildungspläne, Vergleich, lebensbezogener Ansatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umsetzung von Literacy-Erziehung in elementarpädagogischen Bildungsplänen der Bundesländer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Umsetzung von Literacy-Erziehung in den elementarpädagogischen Bildungsplänen verschiedener Bundesländer. Sie untersucht Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Herangehensweise an frühe Lese- und Schreiberfahrungen und bewertet die Berücksichtigung des Themas „frühes Lesen“ in den jeweiligen Plänen. Der lebensbezogene Ansatz dient als theoretische Grundlage.
Welche Bundesländer werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Bildungspläne folgender Bundesländer: Saarland, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern.
Was versteht die Arbeit unter „Literacy“?
Die Arbeit geht über eine einfache Übersetzung von „Literacy“ als „Lese- und Schreibkompetenz“ hinaus. Sie betont die umfassendere Bedeutung des Begriffs, der Aspekte wie Textverständnis, Symbolverständnis, Sprachgefühl und Lesefreude einschließt. Die UNESCO-Definition von Literacy dient als Referenz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Bedeutung von „Literacy“, Methoden der Sprachentwicklungsförderung im Kindergarten, Analyse der Bildungspläne verschiedener Bundesländer hinsichtlich des „frühen Lesens“, Vergleich der Ansätze zur Förderung von Lese- und Schreibkompetenz und Perspektiven für die zukünftige Literacy-Förderung im Kindergarten.
Wie werden die Bildungspläne analysiert?
Die Arbeit analysiert die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer im Detail, zeigt deren Schwerpunkte, Ansätze und Methoden der Literacy-Förderung auf und arbeitet Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus. Jeder Bundesland wird separat betrachtet.
Gibt es einen Vergleich der analysierten Bildungspläne?
Ja, die Arbeit beinhaltet einen kritischen Vergleich der analysierten Bildungspläne. Dieser Vergleich zeigt Stärken und Schwächen auf und formuliert mögliche Verbesserungsvorschläge für eine optimierte Literacy-Förderung im Kindergarten.
Welche Methoden der Sprachentwicklungsförderung werden erwähnt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Sprachförderung, die die Entwicklung von Lesekompetenz im Kindergarten unterstützen. Sie betont vielfältige Ansätze, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden und die Bedeutung des spielerischen Lernens. Ein Beispiel ist die Erläuterung von Rollenspielen.
Wie wird die Bedeutung des „frühen Lesens“ dargestellt?
Die Arbeit betont die Bedeutung frühkindlicher Förderung für die Entwicklung von Lese- und Schreibkompetenz und die Notwendigkeit, diese bereits im Kindergarten zu berücksichtigen. Sie beleuchtet (falls im Originaltext vorhanden) natürliche Wege, auf denen Kinder vor der Schule mit Schrift und Lesen in Kontakt kommen und ein grundlegendes Verständnis entwickeln.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literacy, Literalität, frühes Lesen, Sprachentwicklungsförderung, elementarpädagogische Bildungspläne, Kindergarten, Lesekompetenz, Schreibkompetenz, Bundesländer, Bildungspläne, Vergleich, lebensbezogener Ansatz.
- Quote paper
- Stefanie Petschkuhn (Author), 2007, Lesen lernen vor der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120127