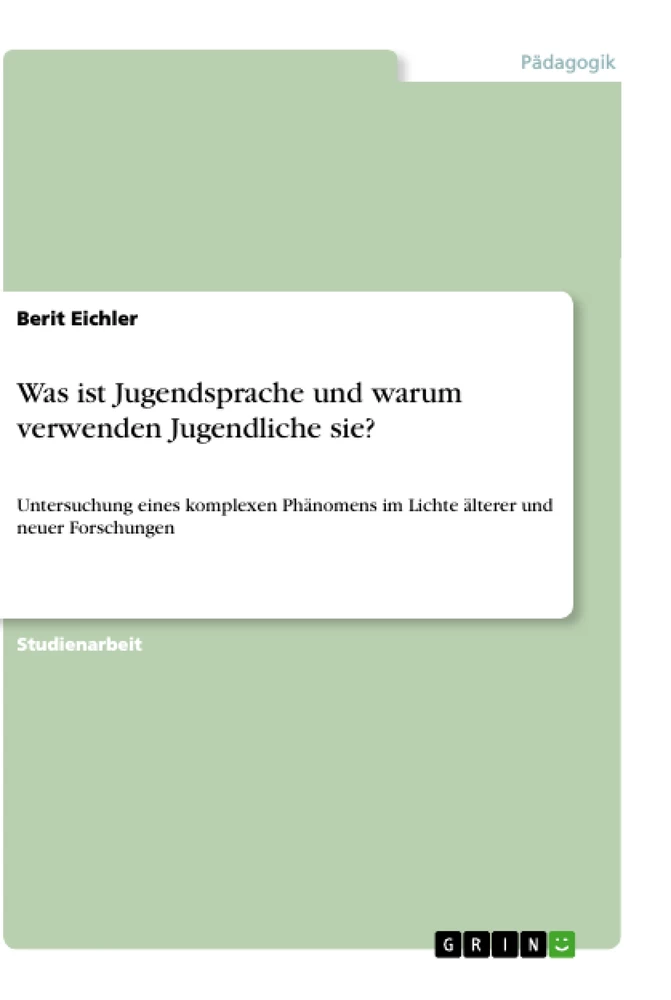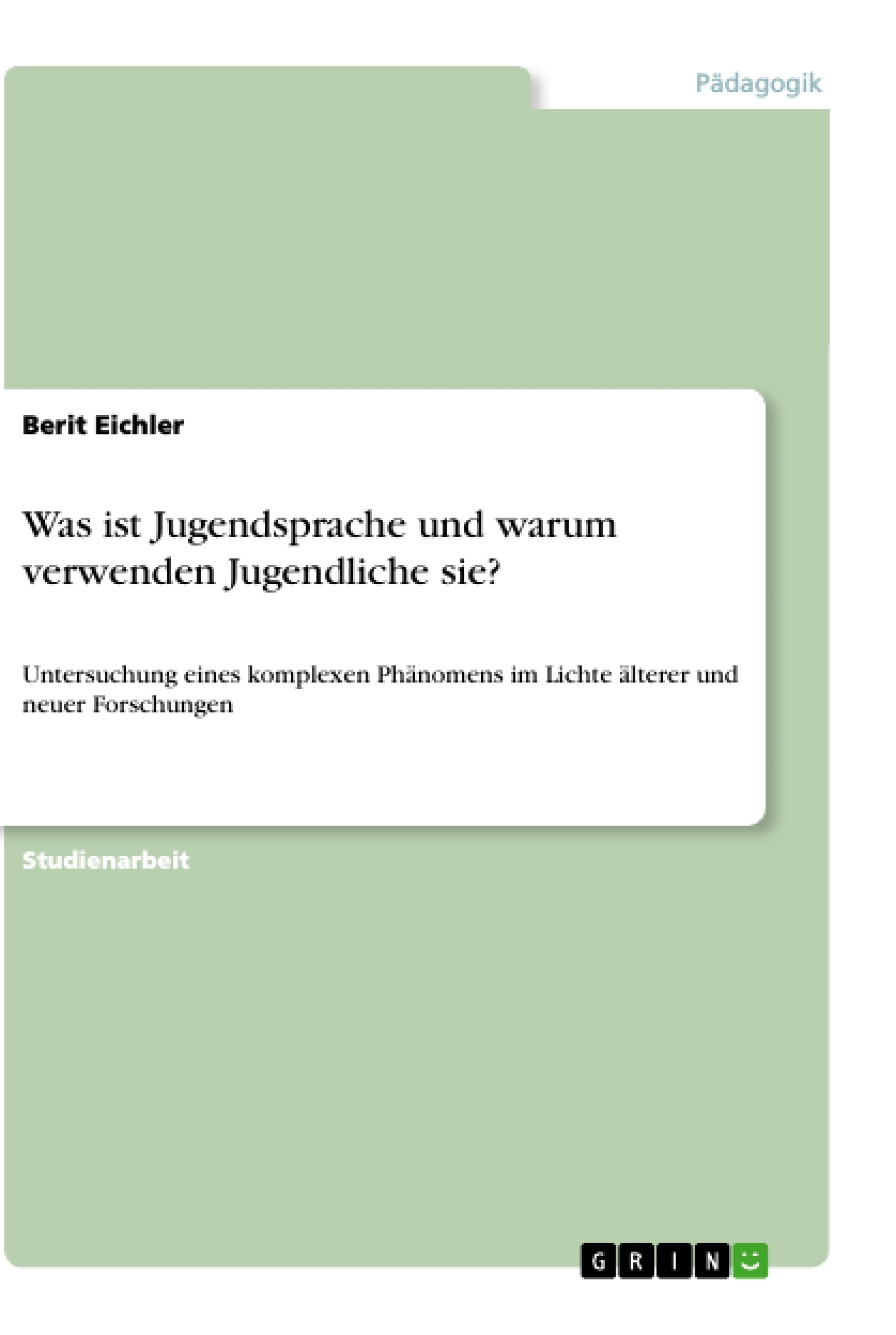Zu „Jugendsprache“, dem Thema meiner neuen Hausarbeit, hat jeder etwas zu sagen. Man schmunzelt über Begriffe, die man von Jugendlichen aufgeschnappt hat, schwelgt in Erinnerungen und staunt noch heute über die täppischen Versuche von Eltern und Lehrern, Jugendsprache zu sprechen. Aber benutzen wir nicht alle bei unseren Gespräch ab und zu jugendsprachliche Elemente? Oder handelt es sich dann um Umgangssprache, wenn die Sprechenden schon erwachsen sind? Was ist Jugendsprache eigentlich? Ist jedes Wort, das ein Jugendlicher äußert, Jugendsprache? Sind es bestimme Ausdrücke oder Tonlagen, die Jugendsprache bestimmen? Können auch Erwachsene Jugendsprache sprechen? Oder wird die Jugendsprache einer Generation automatisch zur Erwachsenensprache, sobald diese Generation volljährig ist? Existiert Jugendsprache überhaupt?
In meiner Hausarbeit gehe ich diesen Fragen anhand älterer und neuerer Forschungsansätze nach. Dazu gebe ich zunächst einen Überblick über Forschungen zum Thema Jugendsprache. Anschließend stelle ich Helmut Hennes Vorschlag, Jugendsprache über die Betrachtung ihrer allgemeinen strukturellen Merkmale sowie ihrer Lexik zu fassen, dar. In Bezug darauf zeige ich am Beispiel des Eintrags über Jugendsprache bei ‘Wikipedia’ welche Popularität Ansätze dieser Art noch heute haben. Im dritten Teil erläutere ich, inwiefern spätere Forschungen diese Herangehensweise kritisieren und welche Ansätze sie stattdessen vorschlagen. Dabei konzentriere ich mich hauptsächlich auf den ethnographischen Ansatz, den Peter Schlobinski, Gaby Kohl und Irmgard Ludewigt in ihrem Buch „Jugendsprache. Fiktion und Wirklichkeit“ (1993) vorstellen. Unter Punkt vier beleuchte ich mögliche Motivationen Jugendlicher, eine eigene Sprache zu sprechen. Ebenso wie bei den Annahmen bezüglich der Merkmale von Jugendsprache wird sich auch hier zeigen, dass die in der Öffentlichkeit verbreiteten Vorstellungen auf vorschnellen Schlüssen beruhen. Den Schluss bildet eine Darstellung des Verständnisses von Jugendsprache aus der Sicht von Jugendlichen selbst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anfänge und Entwicklung der Jugendsprachforschung
- 2.1 Konzentration auf die Lexik
- 2.2 Merkmale von Jugendsprache auf struktureller Ebene
- 3. Jugendsprache im Kontext
- 3.1 Die Ethnographie des Sprechens
- 3.2 Elemente der Ausbildung jugendlichen Sprachstils
- 3.3 Die Partikel „ey“
- 4. Warum sprechen Jugendliche Jugendsprache?
- 5. Jugendliche über Jugendsprache. Darstellung und Bewertung
- 5.1 Darstellung
- 5.2 Bewertung
- 6. Fazit
- 6.1 Nachtrag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das komplexe Phänomen der Jugendsprache anhand älterer und neuerer Forschungsansätze. Ziel ist es, gängige Vorstellungen und Mythen über Jugendsprache zu hinterfragen und ein differenzierteres Verständnis zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Forschungsmethoden und deren Ergebnisse, um die Entwicklung und die Merkmale von Jugendsprache zu analysieren.
- Entwicklung der Jugendsprachforschung und deren methodische Ansätze
- Kritik an lexikalisch orientierten Forschungsansätzen
- Ethnographische Betrachtungsweisen und deren Bedeutung für das Verständnis von Jugendsprache
- Motivationen für den Gebrauch von Jugendsprache
- Jugendliche Perspektiven auf ihre eigene Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt anhand von Beispielen alltäglicher Beobachtungen und Diskussionen über Jugendsprache in die Thematik ein. Sie verdeutlicht die Unsicherheiten und Vorurteile, die mit dem Thema verbunden sind, und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit: Was ist Jugendsprache? Welche Merkmale kennzeichnen sie? Welche Motivationen liegen dem Gebrauch von Jugendsprache zugrunde? Die Einleitung kündigt den Aufbau der Arbeit an und beschreibt den methodischen Ansatz.
2. Anfänge und Entwicklung der Jugendsprachforschung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Jugendsprachforschung, beginnend mit Untersuchungen studentischer Sprache im 16. Jahrhundert bis hin zu den Erhebungen nach 1945. Es wird deutlich, dass frühe Forschung oft von gesellschaftlichen Vorurteilen und Wertungen geprägt war und sich primär auf die Lexik konzentrierte. Der Sprachwandel wurde oft negativ als „Verfall“ interpretiert. Die Entstehung des Begriffs „Jugendkultur“ im Kontext des Rock 'n' Roll und sein Einfluss auf die Sprachforschung werden ebenfalls thematisiert.
2.1 Konzentration auf die Lexik: Dieses Unterkapitel kritisiert den lexikalisch orientierten Ansatz früherer Forschung, der die Jugendsprache als Sondersprache verstand und sich auf das Sammeln und Kategorisieren von Wörtern konzentrierte, ohne den Kontext und die soziale Bedeutung ausreichend zu berücksichtigen. Am Beispiel der Synonyme für „Mädchen“ wird die Problematik einer ideologisch voreingestellten Lexikographie verdeutlicht, die zu Fehlinterpretationen und Stigmatisierungen führt.
2.2 Merkmale von Jugendsprache auf struktureller Ebene: Dieses Unterkapitel stellt Helmut Hennes Ansatz vor, Jugendsprache anhand struktureller Merkmale zu analysieren. Henne beschreibt Jugendsprache als ein „spielerisches Sekundärgefüge“, das die Standardsprache kreativ abwandelt. Die Ergebnisse seiner Fragebogenuntersuchung aus dem Jahr 1982 werden kurz erwähnt, ohne im Detail auf die identifizierten strukturellen Merkmale einzugehen.
3. Jugendsprache im Kontext: Dieses Kapitel widmet sich neueren Forschungsansätzen, die den ethnographischen Ansatz betonen. Es wird die Bedeutung von Kontext, Symbolen und der „Bricolage“ (Zusammenfügen von Elementen aus unterschiedlichen Quellen) für die Bildung jugendlichen Sprachstils erläutert. Der Fokus liegt auf der sozialen und kulturellen Einbettung der Jugendsprache.
4. Warum sprechen Jugendliche Jugendsprache?: Dieses Kapitel untersucht die Motivationen Jugendlicher, eine eigene Sprache zu verwenden. Es wird deutlich, dass die in der Öffentlichkeit verbreiteten Vorstellungen oft auf vorschnellen Schlüssen beruhen und ein differenzierteres Verständnis der komplexen sozialen und kommunikativen Funktionen von Jugendsprache notwendig ist.
5. Jugendliche über Jugendsprache. Darstellung und Bewertung: Dieses Kapitel präsentiert die Perspektiven von Jugendlichen selbst auf ihre Sprache. Die Darstellung ihrer eigenen Sichtweise und Bewertung der Jugendsprache bildet den Schlusspunkt der Arbeit, ohne jedoch die Schlussfolgerungen zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachwandel, Jugendkultur, Ethnographie, Lexik, Helmut Henne, Forschungsmethoden, Soziolinguistik, Kommunikation, Identität.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Jugendsprache
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Phänomen der Jugendsprache, hinterfragt gängige Vorstellungen und Mythen und entwickelt ein differenziertes Verständnis. Sie analysiert die Entwicklung und Merkmale von Jugendsprache anhand älterer und neuerer Forschungsansätze, beleuchtet verschiedene Forschungsmethoden und deren Ergebnisse.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Jugendsprachforschung und deren methodische Ansätze, Kritik an lexikalisch orientierten Forschungsansätzen, ethnographische Betrachtungsweisen und deren Bedeutung für das Verständnis von Jugendsprache, Motivationen für den Gebrauch von Jugendsprache und jugendliche Perspektiven auf ihre eigene Sprache.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Anfänge und Entwicklung der Jugendsprachforschung (mit den Unterkapiteln Konzentration auf die Lexik und Merkmale von Jugendsprache auf struktureller Ebene), Jugendsprache im Kontext, Warum sprechen Jugendliche Jugendsprache?, Jugendliche über Jugendsprache (Darstellung und Bewertung) und Fazit (mit Nachtrag).
Wie wird die Jugendsprache in der Hausarbeit betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet Jugendsprache zunächst aus der Perspektive der älteren Forschung, die sich oft auf die Lexik konzentrierte und den Kontext vernachlässigte. Sie kritisiert diesen Ansatz und präsentiert neuere ethnographische Ansätze, die die soziale und kulturelle Einbettung von Jugendsprache stärker berücksichtigen. Die Perspektiven der Jugendlichen selbst werden ebenfalls einbezogen.
Welche Forschungsmethoden werden diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert lexikalisch orientierte Forschungsansätze, die im Laufe der Zeit kritisch betrachtet werden, und ethnographische Ansätze, die den Kontext und die soziale Bedeutung von Jugendsprache stärker berücksichtigen. Der Ansatz von Helmut Henne, der Jugendsprache anhand struktureller Merkmale analysiert, wird ebenfalls vorgestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden erst im Fazit präsentiert. Die Arbeit zielt darauf ab, gängige Vorurteile zu hinterfragen und ein differenzierteres Verständnis von Jugendsprache zu ermöglichen, indem sie verschiedene Forschungsansätze und die Perspektiven der Jugendlichen selbst berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Jugendsprache, Sprachwandel, Jugendkultur, Ethnographie, Lexik, Helmut Henne, Forschungsmethoden, Soziolinguistik, Kommunikation, Identität.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die genauen Quellenangaben werden nicht im FAQ aufgeführt, jedoch wird deutlich, dass sowohl ältere als auch neuere Forschungsansätze und -literatur zur Jugendsprache herangezogen werden. Die Arbeit bezieht sich auf Untersuchungen studentischer Sprache im 16. Jahrhundert und Erhebungen nach 1945, sowie auf den Ansatz von Helmut Henne.
- Quote paper
- Berit Eichler (Author), 2008, Was ist Jugendsprache und warum verwenden Jugendliche sie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120070