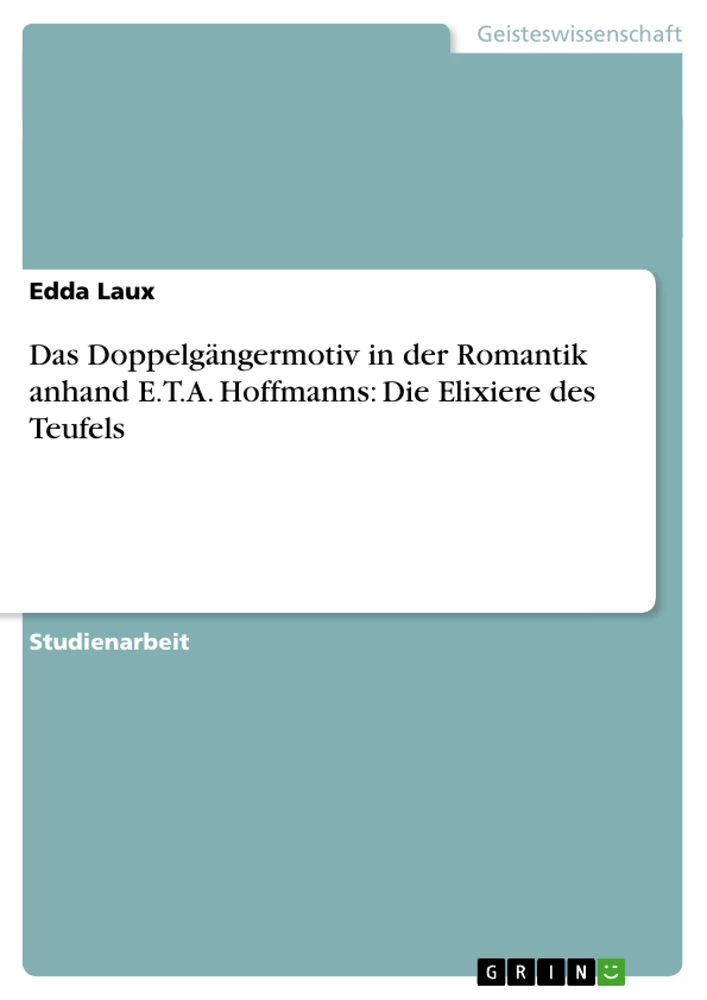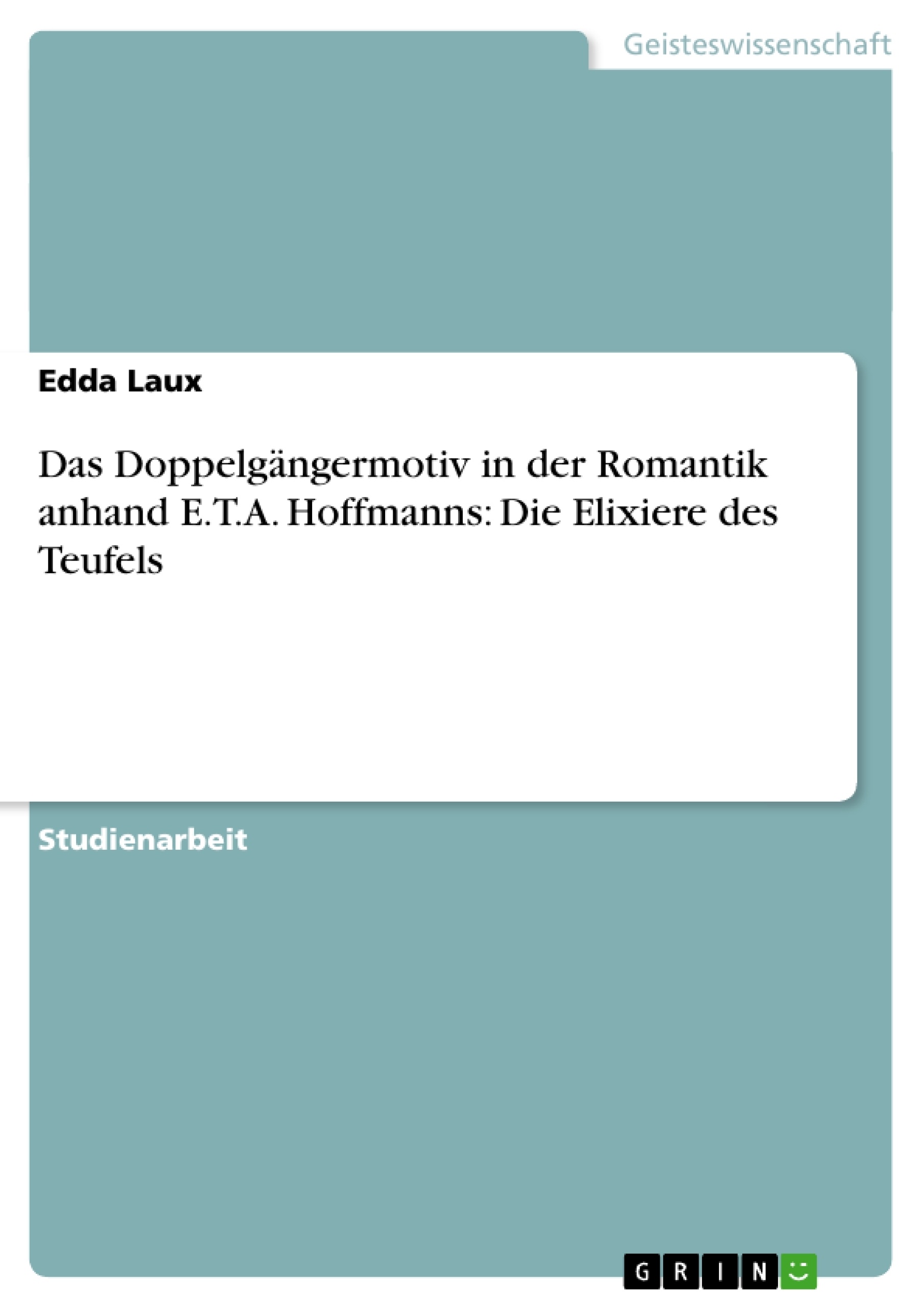Lange vor der Etablierung der Psychologie kam es in der deutschsprachigen Literatur zu einer intensiven Auseinandersetzung mit problematischer Identität. Insbesondere das Motiv des Doppelgängers wurde zur Beschreibung wahnhafter Zustände und verunsicherter Ich-Wahrnehmung in der romantischen Literatur häufig verwendet. Doch lassen sich auch Zeitgeist und Lebensgefühl der Romantik anhand schauerlich schöner Romane wie die ELIXIERE DES TEUFELS von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann herausarbeiten.
In einem ersten Schritt wird auf die Epoche der Romantik im Allgemeinen eingegangen. Dazu gehören eine Epochenbestimmung und die kurze Beschreibung wichtiger philosophischer, wissenschaftlicher und geistesgeschichtlicher Strömungen. So der Ich-Philosophie von Fichte, des Mesmerismus, die Stellung Künstlerpersönlichkeit in der Romantik und so weiter.
In einem zweiten Schritt wird das literarische Doppelgängermotiv in seiner Vielfalt vorgestellt.
Schließlich soll anhand DIE ELIXIERE DES TEUFELS von E.T.A. Hoffmann eine Analyse des Doppelgängermotivs in der Romantik unter Berücksichtigung psychologischer und geistesgeschichtlich-philosophischer Momente vorgenommen werden. Die Frage, welche dieser Interpretation zugrunde liegt, ist die nach der romantischen Identität, also auch nach der Selbsterfahrung in Zeiten gesellschaftlichen Wandels.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Romantik
- 2.1. Etymologische Bestimmung
- 2.2. Zeitgeschichte und Epochenbestimmung
- 2.2.1. Die Frühromantik (1790-1801)
- 2.2.2. Die Hochromantik (1801-1815)
- 2.2.3. Die Spätromantik (1820-1850)
- 2.3. Philosophie
- 2.3.1. Fichte: Ich-Philosophie
- 2.3.2. Schelling: Transzendentaler Idealismus
- 2.3.3. Schlegel: Ästhetische Subjetivität
- 2.4. Literatur und Ästhetischer Diskurs
- 2.5. Psychologie
- 2.6. Mesmerismus
- 3. Das Motiv des Doppelgängers
- 3.1. Antike und Neuzeit
- 3.3. Romantische Variationen
- 4. E.T.A. Hoffmann und DIE ELIXIERE DES TEUFELS
- 4.1. Biographische Notiz
- 4.2. Inhalt der Elixiere
- 4.3. Medardus und seine Doppelgänger
- 4.3.1 Psychologie der Elixiere
- 4.3.2. Zeitgeist der Elixiere
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Doppelgängermotiv in der Romantik anhand E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“. Ziel ist es, die Verwendung dieses Motivs als Ausdruck problematischer Identität und verunsicherter Ich-Wahrnehmung im Kontext des gesellschaftlichen Wandels der Epoche zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den historischen und philosophischen Hintergrund der Romantik und setzt dies in Beziehung zum literarischen Werk.
- Die Romantik als Epoche: ihre philosophischen, gesellschaftlichen und literarischen Strömungen.
- Das Doppelgängermotiv in der Literatur: seine historische Entwicklung und seine unterschiedlichen Ausprägungen.
- Analyse von E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“: der Einsatz des Doppelgängermotivs und seine psychologische sowie gesellschaftliche Bedeutung.
- Die romantische Identität: Selbsterfahrung im Kontext gesellschaftlichen Wandels.
- Der Einfluss von Zeitgeist und Lebensgefühl der Romantik auf die literarische Darstellung von Identität.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der problematischen Identität in der deutschen Romantik ein und kündigt die Untersuchung des Doppelgängermotivs in E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ an. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Epoche, des Motivs und des Romans umfasst, um die romantische Identität im Kontext gesellschaftlichen Wandels zu verstehen. Der Bezug auf Schwarz (1993) unterstreicht die Komplexität des romantischen Ichs.
2. Die Romantik: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Romantik als kulturelle Epoche, beginnend mit einer etymologischen Betrachtung des Begriffs „Romantik“. Es erörtert die Schwierigkeiten einer präzisen Epochenbestimmung und beschreibt den historischen Kontext, einschließlich der französischen Revolution, der industriellen Revolution und des Wandels der ständischen Ordnung. Die drei Phasen der Romantik (Früh-, Hoch- und Spätromantik) werden vorgestellt, wobei die verwendeten Quellen genannt werden. Der Abschnitt beleuchtet wichtige philosophische Strömungen (Fichte, Schelling, Schlegel) und ihren Einfluss auf das literarische Schaffen.
3. Das Motiv des Doppelgängers: Dieses Kapitel widmet sich dem Doppelgängermotiv, indem es dessen historische Entwicklung von der Antike bis in die Neuzeit nachzeichnet. Es bereitet den Boden für die anschließende Analyse des Motivs in Hoffmanns Werk, indem es die verschiedenen romantischen Variationen und Interpretationen des Doppelgängers beschreibt, ohne jedoch bereits konkrete Beispiele aus dem Roman zu nennen.
4. E.T.A. Hoffmann und DIE ELIXIERE DES TEUFELS: Dieses Kapitel analysiert E.T.A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ mit dem Fokus auf das Doppelgängermotiv. Es beginnt mit einer kurzen biographischen Notiz zu Hoffmann, gefolgt von einer Zusammenfassung des Inhalts der „Elixiere“. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Figur Medardus und seinen Doppelgängern, wobei sowohl die psychologischen als auch die gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Aspekte erörtert werden. Die Kapitel unterstreichen, wie Hoffmanns Werk die Fragen nach Identität und Selbsterfahrung in Zeiten des Umbruchs reflektiert.
Schlüsselwörter
Romantik, Doppelgängermotiv, E.T.A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels, Identität, Ich-Philosophie, Gesellschaftlicher Wandel, Zeitgeist, Psychologie, Mesmerismus, Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Elixiere des Teufels" und dem Doppelgängermotiv in der Romantik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Doppelgängermotiv in E.T.A. Hoffmanns Roman "Die Elixiere des Teufels" im Kontext der deutschen Romantik. Sie untersucht, wie dieses Motiv die problematische Identität und die verunsicherte Ich-Wahrnehmung in Zeiten gesellschaftlichen Wandels ausdrückt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Romantik als Epoche, ihre philosophischen und gesellschaftlichen Strömungen, die historische Entwicklung des Doppelgängermotivs, eine detaillierte Analyse von "Die Elixiere des Teufels", die psychologische und gesellschaftliche Bedeutung des Doppelgängers bei Hoffmann und den Einfluss des Zeitgeists auf die Darstellung von Identität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Romantik (mit Unterkapiteln zu Etymologie, Epochenbestimmung, Philosophie, Literatur und Ästhetik, Psychologie und Mesmerismus), Das Motiv des Doppelgängers, E.T.A. Hoffmann und "Die Elixiere des Teufels" (mit Analyse von Medardus und seinen Doppelgängern) und Schluss.
Wie wird die Romantik in der Arbeit dargestellt?
Das Kapitel über die Romantik bietet einen umfassenden Überblick über die Epoche, inklusive etymologischer Bestimmung des Begriffs, Epochenbestimmung (Früh-, Hoch- und Spätromantik), wichtigen philosophischen Strömungen (Fichte, Schelling, Schlegel) und ihrem Einfluss auf die Literatur.
Wie wird das Doppelgängermotiv behandelt?
Das Doppelgängermotiv wird historisch von der Antike bis in die Neuzeit verfolgt und in seinen verschiedenen romantischen Ausprägungen beschrieben. Die Analyse konzentriert sich auf seine Verwendung in "Die Elixiere des Teufels".
Wie wird E.T.A. Hoffmanns "Die Elixiere des Teufels" analysiert?
Die Analyse von "Die Elixiere des Teufels" konzentriert sich auf die Figur Medardus und seine Doppelgänger. Es werden sowohl die psychologischen als auch die gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Aspekte des Motivs im Roman untersucht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse des Doppelgängermotivs als Ausdruck problematischer Identität und verunsicherter Ich-Wahrnehmung in der Romantik. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Motiv, dem literarischen Werk und dem gesellschaftlichen Wandel der Epoche.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Romantik, Doppelgängermotiv, E.T.A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels, Identität, Ich-Philosophie, Gesellschaftlicher Wandel, Zeitgeist, Psychologie, Mesmerismus, Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik.
- Quote paper
- Edda Laux (Author), 2007, Das Doppelgängermotiv in der Romantik anhand E.T.A. Hoffmanns: Die Elixiere des Teufels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120042