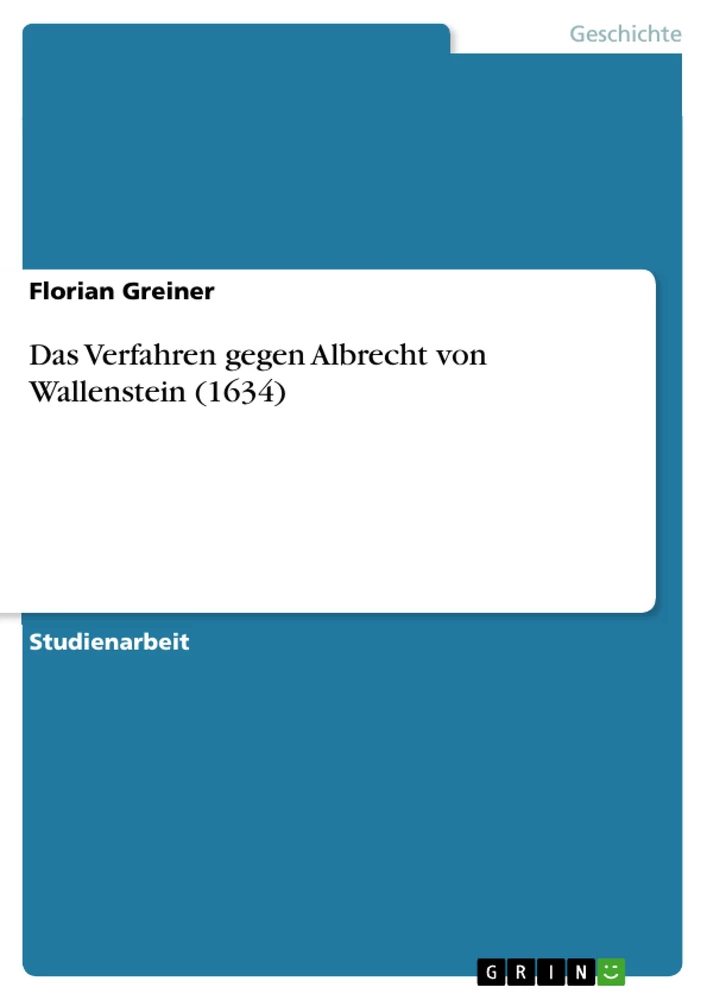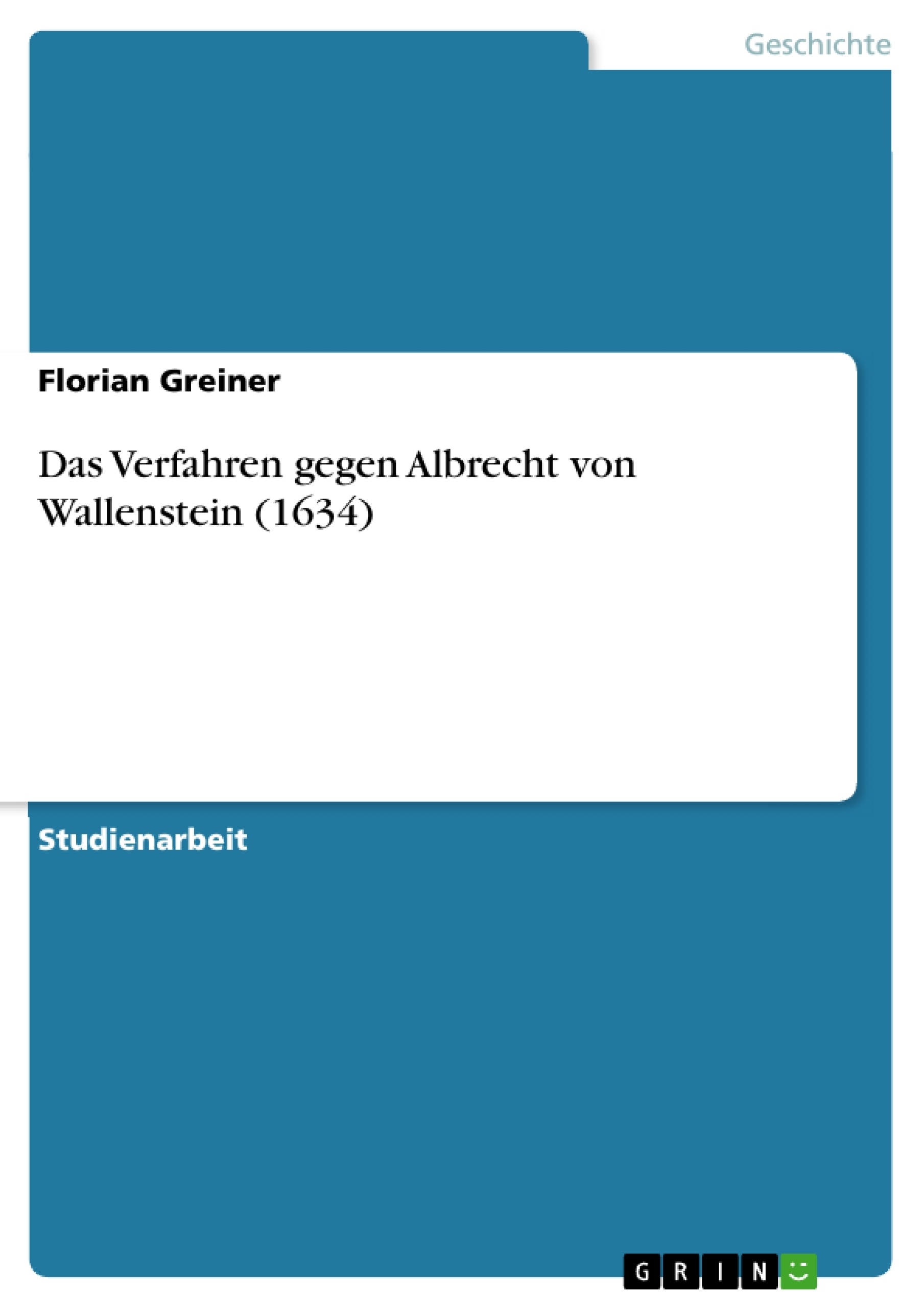Der gewaltsame Tod Albrechts von Wallenstein am 25. Februar 1634 zählt in vielerlei Hinsicht zu den bedeutendsten Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges. Einerseits erregten die Vorkommnisse in der böhmischen Grenzstadt Eger sowohl auf katholischer als auch auf protestantischer Seite bereits zeitgenössisch große Aufmerksamkeit und führten zu einer scharfen publizistischen Kontroverse. Andererseits wurde die Wallenstein-Frage seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem der beherrschenden Themen in der deutschsprachigen Historiographie. Worin diese Bedeutung genau liegt ist dabei in der Forschung umstritten, zumal in der Beantwortung dieser Frage oftmals bereits eine Stellungnahme in Hinblick auf die weiterreichende Frage nach der Schuld Wallensteins bzw. nach der Richtigkeit des kaiserlichen Vorgehens gegen ihn liegt. [...] Im Rahmen dieser Hausarbeit wird darauf aufbauend untersucht werden, wie in der Geschichtsforschung die Frage nach der Schuld des Generalissimus zu unterschiedlichen Zeiten beantwortet wurde. Welche Bedeutung wurde entscheidenden Faktoren wie den Göllersdorfer Abmachungen oder dem 1. Pilsener Revers zugemessen? Eine zweite Leitfrage soll die nach der rechtshistorischen Legitimität des kaiserlichen Vorgehens sein. Dabei ist grundsätzlich fraglich, wie dieses juristisch überhaupt zu klassifizieren ist. Während in der Forschung immer wieder von einem in Wien abgehaltenen Geheimprozess gegen den Herzog gesprochen wird , wendet etwa Christoph Kampmann dagegen ein, dass von einem solchen Untersuchungsverfahren nicht gesprochen werden könne. Anders formuliert: inwieweit ist der Fall Wallenstein überhaupt als politischer (Straf-) Prozess einzustufen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wallenstein - Aufstieg und erste Entlassung 1630
- Das 2. Generalat
- Die Göllersdorfer Abmachungen
- Konfliktpunkt Kaiser - Wallenstein 1632/1633
- Der Weg nach Eger (1634)
- Der 1. Pilsener Revers
- Die kaiserliche Reaktion – Das 1. und 2. Absetzungspatent
- Der 2. Pilsener Revers, Flucht und Tod Wallensteins
- Das rechtliche Nachspiel
- Die Frage nach der Schuld Wallensteins im Spiegel der Historiographie
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Schuld Wallensteins und der rechtlichen Legitimität des kaiserlichen Vorgehens gegen ihn im Jahre 1634. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe, insbesondere Wallensteins Aufstieg und erste Entlassung, sowie die entscheidenden Ereignisse, die zu seinem Tod führten. Die Arbeit analysiert zudem die unterschiedlichen Interpretationen dieser Ereignisse in der Geschichtsschreibung.
- Wallensteins Aufstieg und Fall
- Die Göllersdorfer Abmachungen und ihre Bedeutung
- Die rechtliche Bewertung des kaiserlichen Vorgehens
- Konflikt zwischen Kaiser und Wallenstein
- Die Interpretation der Ereignisse in der Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des gewaltsamen Todes Wallensteins im Dreißigjährigen Krieg heraus und skizziert die kontroversen Interpretationen in der Forschung, die von Verrat bis zu einem unrechtmäßigen Attentat reichen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage nach Wallensteins Schuld und der rechtlichen Legitimität des kaiserlichen Vorgehens.
Wallenstein - Aufstieg und erste Entlassung 1630: Dieses Kapitel beschreibt Wallensteins Aufstieg vom eher unbedeutenden Adligen zum mächtigen Herzog und Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen. Sein kometenhafter Aufstieg, getrieben von militärischen Erfolgen und geschickter Politik, wird ebenso beleuchtet wie die letztendlich zur Entlassung führenden Konflikte mit dem Kaiser und anderen Reichsfürsten, die seine zunehmende Macht als Bedrohung empfanden.
Das 2. Generalat: Dieses Kapitel analysiert Wallensteins Rückkehr als Oberbefehlshaber und die umstrittenen Göllersdorfer Abmachungen. Es beleuchtet die wiederkehrenden Konflikte zwischen Kaiser und Wallenstein sowie die sich zuspitzenden Spannungen, die letztlich zum erneuten Bruch führten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der politischen und militärischen Hintergründe der Auseinandersetzung.
Der Weg nach Eger (1634): Der Fokus liegt auf dem 1. Pilsener Revers, einem Dokument, das im Zentrum der Debatte um Wallensteins Loyalität steht. Das Kapitel analysiert die Reaktion des Kaisers, die Verabschiedung der Absetzungspatente und die Ereignisse, die zum zweiten Pilsener Revers und schließlich zu Wallensteins Tod in Eger führten. Die Analyse befasst sich mit den verschiedenen Interpretationen dieser Ereignisse und ihrer Bedeutung für das weitere Kriegsgeschehen.
Das rechtliche Nachspiel: Dieses Kapitel untersucht, wie der Kaiser und seine Berater versuchten, ihr Vorgehen gegen Wallenstein im Nachhinein juristisch zu rechtfertigen. Es analysiert die verschiedenen rechtlichen Argumente und die Schwierigkeiten, das Vorgehen eindeutig juristisch zu klassifizieren.
Schlüsselwörter
Wallenstein, Dreißigjähriger Krieg, Kaiser Ferdinand II., Göllersdorfer Abmachungen, Pilsener Revers, politischer Prozess, rechtliche Legitimität, Verrat, Historiographie, Reichsfürsten, kaiserliche Strafjustiz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wallenstein - Aufstieg, Fall und rechtliche Aufarbeitung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den gewaltsamen Tod Albrecht von Wallensteins im Jahr 1634. Im Fokus stehen die Frage nach Wallensteins Schuld an den Ereignissen und die rechtliche Legitimität des kaiserlichen Vorgehens gegen ihn.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Wallensteins Aufstieg und ersten Sturz, sein zweites Generalat inklusive der Göllersdorfer Abmachungen, die entscheidenden Ereignisse um die Pilsener Rezesse und Wallensteins Tod in Eger. Sie analysiert die rechtliche Aufarbeitung des Geschehens und die unterschiedlichen Interpretationen in der Geschichtsschreibung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Wallenstein - Aufstieg und erste Entlassung 1630, Das 2. Generalat (inkl. Göllersdorfer Abmachungen und Konflikt Kaiser-Wallenstein), Der Weg nach Eger (1634) (inkl. Pilsener Rezesse und Wallensteins Tod), Das rechtliche Nachspiel und Die Frage nach der Schuld Wallensteins im Spiegel der Historiographie, sowie ein Fazit und Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Schuldfrage Wallensteins und die rechtliche Legitimität des kaiserlichen Vorgehens zu beleuchten. Sie analysiert die historischen Hintergründe und die verschiedenen Interpretationen dieser Ereignisse in der Geschichtsschreibung.
Welche Schlüsselereignisse werden detailliert untersucht?
Wichtige Ereignisse, die im Detail untersucht werden, sind Wallensteins Aufstieg und Fall, die Göllersdorfer Abmachungen, die beiden Pilsener Rezesse, die kaiserlichen Absetzungspatente und die Ereignisse um Wallensteins Ermordung in Eger.
Wie wird die rechtliche Seite des Geschehens behandelt?
Die Arbeit untersucht die Versuche des Kaisers, sein Vorgehen gegen Wallenstein juristisch zu rechtfertigen. Sie analysiert die rechtlichen Argumente und die Schwierigkeiten, das Vorgehen eindeutig juristisch zu klassifizieren.
Welche Rolle spielt die Geschichtsschreibung?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse in der Geschichtsschreibung, von der Darstellung Wallensteins als Verräter bis hin zu Interpretationen, die das kaiserliche Vorgehen als unrechtmäßiges Attentat betrachten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wallenstein, Dreißigjähriger Krieg, Kaiser Ferdinand II., Göllersdorfer Abmachungen, Pilsener Revers, politischer Prozess, rechtliche Legitimität, Verrat, Historiographie, Reichsfürsten, kaiserliche Strafjustiz.
Welche Zusammenfassung der Kapitel gibt es?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die behandelten Themen und die wichtigsten Erkenntnisse jedes Kapitels. Sie beinhaltet eine kurze Einleitung, die die Bedeutung des Themas und die Forschungsfrage hervorhebt. Anschließend werden die einzelnen Kapitel inhaltlich knapp zusammengefasst.
- Quote paper
- Florian Greiner (Author), 2006, Das Verfahren gegen Albrecht von Wallenstein (1634), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119928