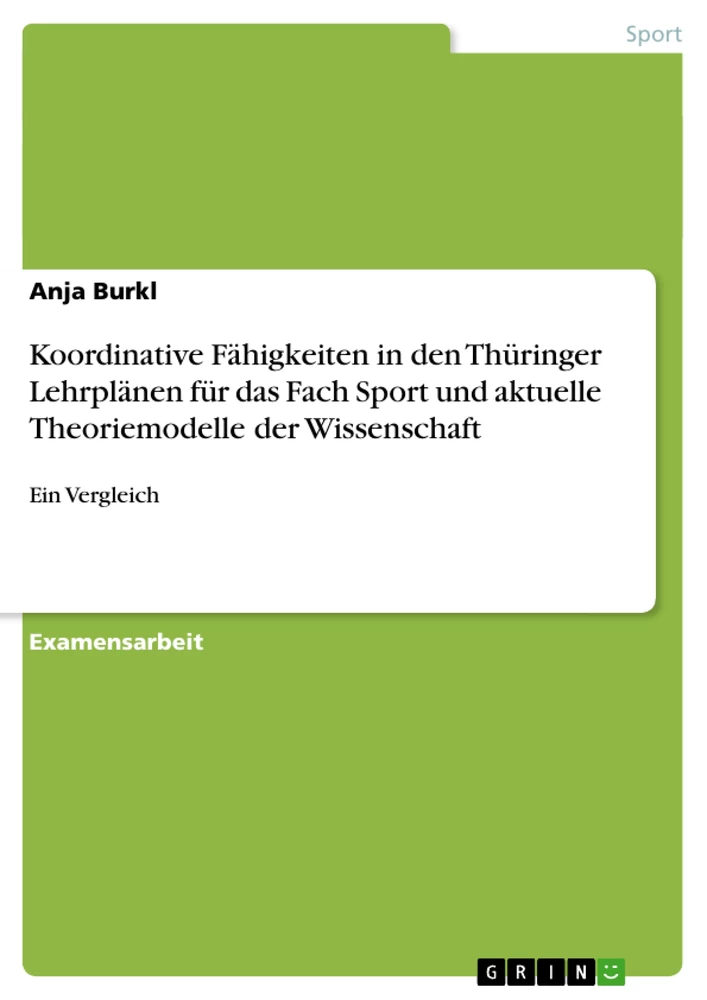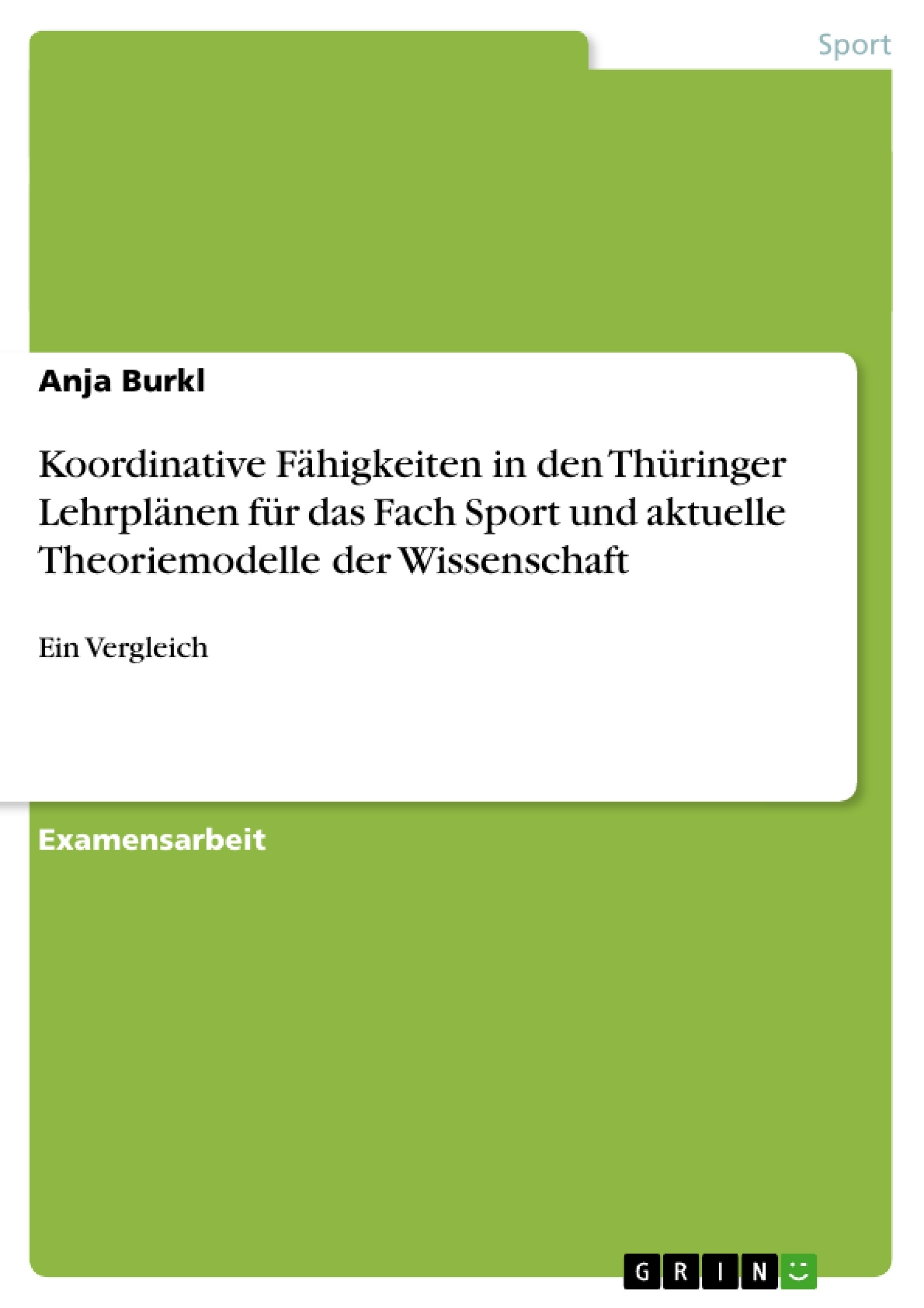Beobachtet man Hochleistungssportler, wie Turniertänzer, Eiskunstläufer oder
Skisportler ist es fast unvorstellbar, was der menschliche Körper zu leisten vermag. Nur durch das perfekte Zusammenspiel von Muskulatur und Nervensystem, ist es dem Menschen möglich Hochleistungen zu erbringen. Allein das Gehen oder benutzen der Hände, welches bereits im frühen Kindesalter erlernt wird, birgt höchste Anforderungen an koordinative Fähigkeiten. Jede Alltagsbewegung und auch sonst alle motorischen Bewegungen müssen erst gelernt, stabilisiert und automatisiert werden, damit der Mensch diese „Bewegungsschablonen“ im Gehirn abrufen kann. Koordinative Fähigkeiten sind folglich unabdingbar für die Prozesse der Bewegungssteuerung. Die menschliche Bewegungskoordination ist beispielsweise unabdingbar für eine gute Unfallprophylaxe. Vorhersehbare sowie nicht vorhersehbare Bewegungssituationen können bewältigt und komplexe Alltagsaufgaben verrichtet werden. Einen hohen Stellenwert haben koordinative Fähigkeiten besonders im Sport, in Bezug auf das Erlernen und Verbessern von taktischen und technischen Fertigkeiten. Situationsbedingte Bewegungen können, auch unter Zeitdruck mühelos angepasst werden.
Im Kapitel 2 werden alle für das Thema erforderlichen, theoretischen Grundlagen im Bereich Sportmotorik und menschlicher Ontogenese vorgestellt. Ebenso beinhaltet es die Auseinandersetzung mit aktuellen Theoriemodellen der koordinativen Fähigkeiten. Die einzelnen Fähigkeiten werden vorgestellt. Das Kapitel 3 beschäftigt sich darauffolgend mit der Erfassbarkeit von koordinativen Fähigkeiten. Verschiedene Motorik‐Testreihen und anwendbare Testverfahren für den Schulsport werden vorgestellt und kritisch betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Sportmotorische Fähigkeiten
- 2.1.1 Konditionelle Fähigkeiten
- 2.1.2 Koordinative Fähigkeiten
- 2.1.2.1 Definition nach dem Sportwissenschaftlichen Lexikon (Röthig/PROHL)
- 2.1.2.2 Allgemein
- 2.1.2.3 Begriffserklärungen „Fähigkeiten“ und „Fertigkeiten“
- 2.2 Überblick über einzelne koordinative Fähigkeiten
- 2.2.1 Motorische Differenzierungsfähigkeit
- 2.2.2 Kopplungsfähigkeit
- 2.2.3 Reaktionsfähigkeit
- 2.2.4 Orientierungsfähigkeit
- 2.2.5 Gleichgewichtsfähigkeit
- 2.2.5.1 Definition nach MEINEL & SCHNABEL
- 2.2.5.2 Definition nach dem Sportwissenschaftlichen Lexikon (RÖTHIg & Prohl)
- 2.2.5.3 Allgemein
- 2.2.6 Umstellungsfähigkeit
- 2.2.7 Rhythmisierungsfähigkeit
- 2.3 Strukturierungs- und Differenzierungsansätze koordinativer Fähigkeiten
- 2.3.1 Fähigkeitssystem von PÖHLMANN & KIRCHNER
- 2.3.2 Hierarchisches Fähigkeitssystem nach Roth
- 2.3.3 Fähigkeitssystem nach LJACH
- 2.3.4 Strukturmodell koordinativer Fähigkeiten nach ZIMMER
- 2.3.5 „Greifswalder Modell für den Schulsport“ nach HIRTZ
- 2.3.6 Modell nach BLUME
- 2.4 Schulung von koordinativen Fähigkeiten im Schulsport
- 2.4.1 Schulung der motorischen Differenzierungsfähigkeit
- 2.4.2 Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit
- 2.4.3 Schulung der Reaktionsfähigkeit
- 2.4.4 Schulung der Orientierungsfähigkeit
- 2.4.5 Schulung der Rhythmisierungsfähigkeit
- 2.5 Motorische Ontogenese und Entwicklung koordinativer Fähigkeiten
- 2.5.1 Mittleres Kindesalter (1. – 3./4. Schuljahr)
- 2.5.2 Spätes Kindesalter (5. - 6. Schuljahr)
- 2.5.3 Frühes Jugendalter (7. - 8. Schuljahr)
- 2.5.4 Spätes Jugendalter (9. – 12. Schuljahr)
- 3 Motorik-Tests zur Erfassung koordinativer Fähigkeiten
- 3.1 Münchner Fitness-Test (MFT)
- 3.2 Körper-Koordinationstest für Kinder (KTK)
- 3.3 Wiener Koordinationsparcours (WKP)
- 3.4 Kinderkoordinationstest (KIKO)
- 4 Lehrplananalyse für das Fach Sport
- 4.1 Aufbau der einzelnen Lehrpläne
- 4.1.1 Grundschule
- 4.1.2 Regelschule
- 4.1.3 Gymnasium
- 4.1.4 Berufsbildende Schule
- 4.2 Auswertungen
- 4.3 Zur Kritik
- 5 Möglichkeiten und Ausblick
- 5.1 Thüringer Lehrpläne
- 5.2 Wissenschaftliche Modelle der Koordinativen Fähigkeiten
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übereinstimmung zwischen den koordinativen Fähigkeiten, wie sie in den Thüringer Lehrplänen für das Fach Sport dargestellt sind, und aktuellen wissenschaftlichen Theoriemodellen. Ziel ist es, Übereinstimmungen und Diskrepanzen aufzuzeigen und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis abzuleiten.
- Koordination im Thüringer Sportunterricht
- Vergleich verschiedener wissenschaftlicher Modelle koordinativer Fähigkeiten
- Analyse der Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten in den Lehrplänen
- Entwicklung koordinativer Fähigkeiten im Kindes- und Jugendalter
- Möglichkeiten zur Optimierung des Sportunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas für die sportpraktische Ausbildung hervorgehoben und die Forschungsfrage formuliert. Die Einleitung bietet einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Thema koordinative Fähigkeiten. Es werden verschiedene Definitionen und Begriffserklärungen erläutert, sowie ein Überblick über die einzelnen koordinativen Fähigkeiten gegeben. Die Kapitel 2.3 und 2.4 präsentieren und vergleichen verschiedene wissenschaftliche Modelle zur Strukturierung und Schulung der koordinativen Fähigkeiten. Der Abschnitt 2.5 befasst sich mit der motorischen Ontogenese und der Entwicklung koordinativer Fähigkeiten während des Kindes- und Jugendalters. Durch die Gegenüberstellung unterschiedlicher Definitionen und Modelle wird ein fundiertes Verständnis des Forschungsgegenstandes geschaffen.
3 Motorik-Tests zur Erfassung koordinativer Fähigkeiten: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Motorik-Tests, die zur Erfassung koordinativer Fähigkeiten bei Kindern eingesetzt werden können. Es werden die Tests Münchner Fitness-Test (MFT), Körper-Koordinationstest für Kinder (KTK), Wiener Koordinationsparcours (WKP) und Kinderkoordinationstest (KIKO) detailliert vorgestellt und deren Anwendung und Aussagekraft erläutert. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der jeweiligen Testverfahren, um dem Leser einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Erfassung koordinativer Fähigkeiten zu geben.
4 Lehrplananalyse für das Fach Sport: Dieses Kapitel analysiert die Thüringer Lehrpläne für das Fach Sport in Bezug auf die Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten. Es werden die verschiedenen Lehrpläne für Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen untersucht und die explizite und implizite Berücksichtigung von Koordinationsfähigkeiten in den jeweiligen Lehrplänen ausgewertet. Die Ergebnisse werden anhand von Abbildungen und Tabellen visualisiert, um die Analyse transparent und nachvollziehbar zu gestalten.
5 Möglichkeiten und Ausblick: Das Kapitel "Möglichkeiten und Ausblick" präsentiert Schlussfolgerungen aus der durchgeführten Analyse und bietet konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten im Thüringer Sportunterricht. Es werden mögliche Ansatzpunkte für eine optimierte Lehrplangestaltung und den Praxiseinsatz der erarbeiteten Erkenntnisse diskutiert. Der Ausblick skizziert zukünftige Forschungsfragen und weitere Forschungsansätze im Bereich der koordinativen Fähigkeiten.
Schlüsselwörter
Koordinative Fähigkeiten, Thüringer Lehrpläne, Sportunterricht, Sportmotorik, Motoriktests, Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit, Lehrplananalyse, Wissenschaftliche Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse Thüringer Sportlehrpläne im Hinblick auf koordinative Fähigkeiten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Übereinstimmung zwischen der Darstellung koordinativer Fähigkeiten in den Thüringer Lehrplänen für Sport und aktuellen wissenschaftlichen Modellen. Sie untersucht Übereinstimmungen und Diskrepanzen und leitet daraus Schlussfolgerungen für die Praxis ab.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Analyse der Koordinationsfähigkeiten im Thüringer Sportunterricht, den Vergleich verschiedener wissenschaftlicher Modelle, die Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten in den Lehrplänen, deren Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und Möglichkeiten zur Optimierung des Sportunterrichts.
Welche Lehrpläne werden untersucht?
Die Analyse betrachtet die Lehrpläne für Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen in Thüringen.
Welche wissenschaftlichen Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene wissenschaftliche Modelle zur Strukturierung und Schulung koordinativer Fähigkeiten, darunter die Modelle von Pöhlmann & Kirchner, Roth, Ljach, Zimmer, Hirtz und Blume.
Welche koordinativen Fähigkeiten werden betrachtet?
Die Arbeit befasst sich mit den koordinativen Fähigkeiten: Motorische Differenzierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit und Rhythmisierungsfähigkeit.
Welche Motoriktests werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Motoriktests: Münchner Fitness-Test (MFT), Körper-Koordinationstest für Kinder (KTK), Wiener Koordinationsparcours (WKP) und Kinderkoordinationstest (KIKO).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit theoretischen Grundlagen zu koordinativen Fähigkeiten, ein Kapitel zu Motoriktests, eine Lehrplananalyse, ein Kapitel mit Möglichkeiten und Ausblick sowie eine Zusammenfassung. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse der Thüringer Lehrpläne und den wissenschaftlichen Modellen und gibt konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Berücksichtigung koordinativer Fähigkeiten im Sportunterricht. Sie identifiziert Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis und skizziert zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Koordinative Fähigkeiten, Thüringer Lehrpläne, Sportunterricht, Sportmotorik, Motoriktests, Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit, Lehrplananalyse, Wissenschaftliche Modelle.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im HTML-Dokument liefert einen ausführlichen Überblick über den Inhalt der einzelnen Abschnitte. Das detaillierte Inhaltsverzeichnis erlaubt eine präzise Navigation durch die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
- Citar trabajo
- Anja Burkl (Autor), 2008, Koordinative Fähigkeiten in den Thüringer Lehrplänen für das Fach Sport und aktuelle Theoriemodelle der Wissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119917