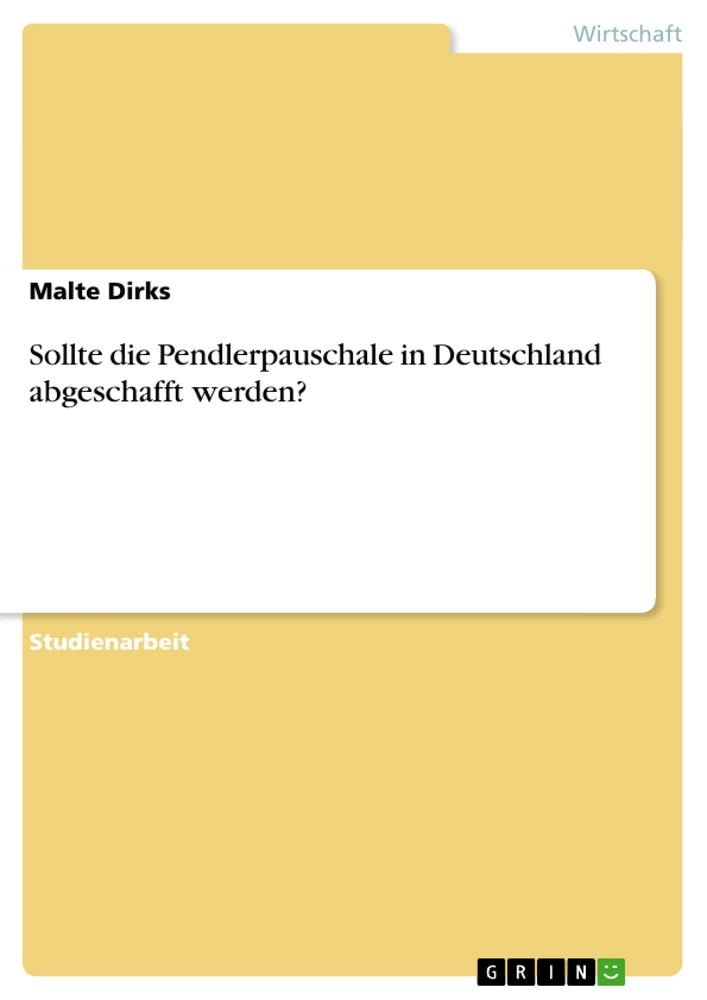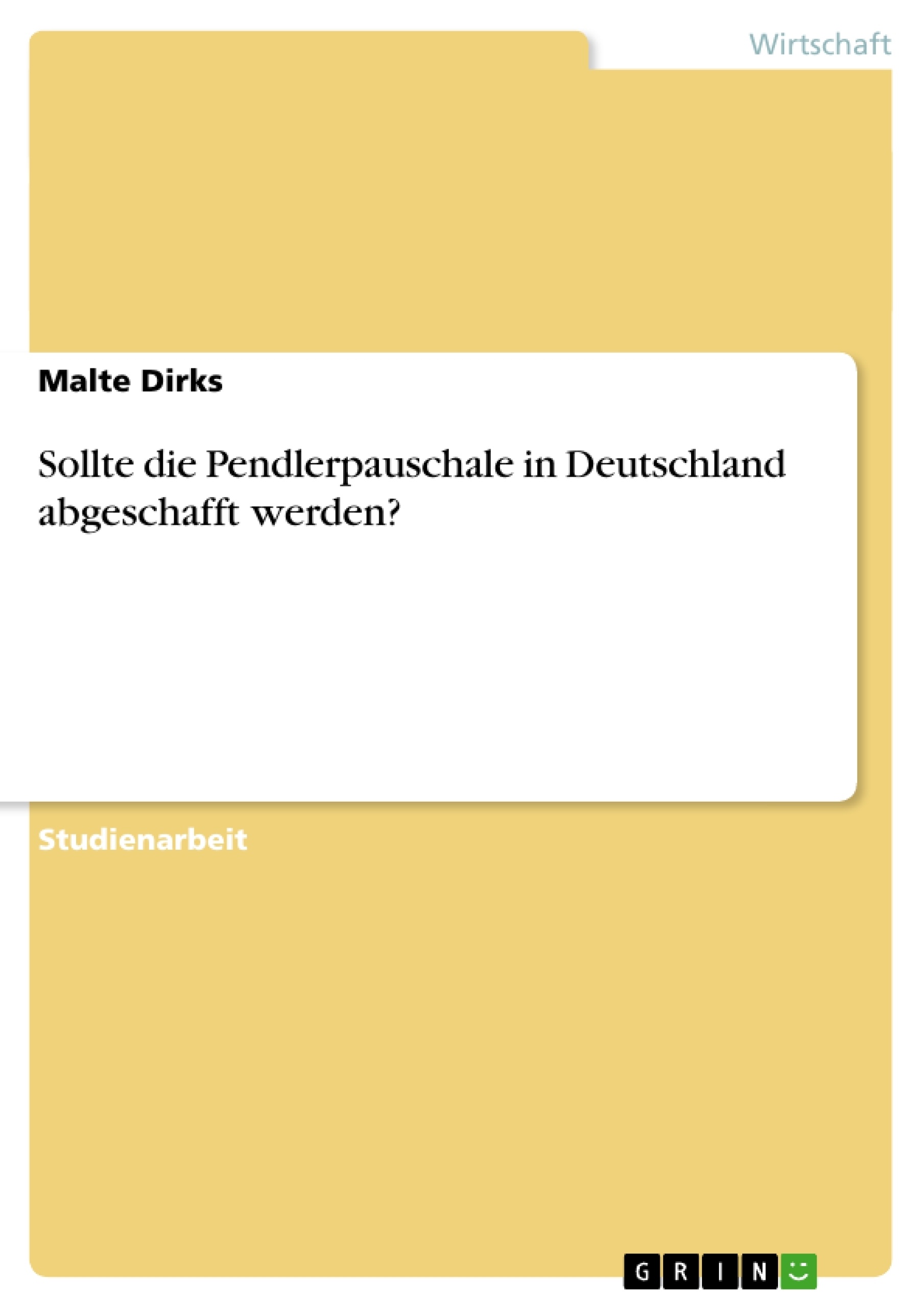Der jährliche Steuerausfall durch die derzeitige Regelung der Pendlerpauschale wird auf sechs Milliarden Euro geschätzt. Vor dem Hintergrund klammer Staatskassen ist es daher nicht verwunderlich, dass zumindest eine Kürzung der Pauschale immer wieder Thema steuerpolitischer Debatten ist. Aus diesem Anlass hat wohl auch die derzeitige Bundesregierung unlängst eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit der Fahrtkosten für Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beschlossen. Künftig werden Distanzen bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern nicht mehr steuerlich berücksichtigt. Das Ausmaß der Beschränkung wird schnell ersichtlich, wenn man bedenkt, dass gut drei Viertel der Pendler zukünftig nicht mehr ihre Fahrtkosten steuerlich geltend machen können (Kloas und Kuhfeld (2003), Tab. 2). Befürworter der Pauschale argumentieren u.a. mit einer steigenden Mobilität der Arbeitnehmer, die zur Entspannung der aktuellen Arbeitsmarktsituation beitrage. Kritiker halten dagegen, dass die Pauschale eine überflüssige Subvention darstelle, die sich der Staat in seiner finanziellen Situation nicht mehr leisten könne. Zudem würde die Zersiedlung der Landschaft unterstützt und die Umweltbelastung durch ein höheres Verkehrsaufkommen gefördert. Ziel dieser Arbeit ist es, losgelöst von der politischen Debatte, die tatsächlichen Auswirkungen der Pendlerpauschale vor einem ökonomischen Hintergrund zu bewerten. Der Fokus der Arbeit richtet sich dabei vor allem auf wohlfahrtstheoretische Aspekte, behandelt werden jedoch auch Fragen der steuerlichen Gerechtigkeit. Im ersten Teil der Arbeit werden dazu Grundlagen der Thematik behandelt. Insbesondere der gesetzliche Hintergrund der Diskussion sowie aktuelle Streitpunkte der Pendlerpauschale sind Bestandteil dieses Kapitels. Im Anschluss erfolgt eine formale
Analyse der Berücksichtigung von Fahrtkosten auf der Basis eines wohlfahrtstheoretischen Modells. Darauf aufbauend werden unterschiedliche ökonomische Bewertungen der Pendlerpauschale diskutiert, wobei zwischen Wohlfahrts- und Gerechtigkeitsaspekten unterschieden wird. Im abschließenden Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Diskussion kritisch bewertet und konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen – Status quo
- 2.1 Systematik der Einkommensbesteuerung
- 2.2 Die aktuelle Gesetzeslage
- 2.3 Streitpunkte im Zusammenhang mit der Pendlerpauschale
- 3 Modelltheoretische Analyse
- 3.1 Abgrenzung des Modells
- 3.2 Privat veranlasstes Pendeln
- 3.3 Beruflich veranlasstes Pendeln
- 4 Diskussion
- 4.1 Private vs. berufliche Veranlassung
- 4.2 Externe Effekte
- 4.3 Die Entfernungspauschale unter dem Gerechtigkeitsaspekt
- 5 Kritische Würdigung / Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ökonomischen Auswirkungen der Pendlerpauschale in Deutschland, losgelöst von der politischen Debatte. Der Schwerpunkt liegt auf wohlfahrtstheoretischen Aspekten und Fragen der steuerlichen Gerechtigkeit. Die Arbeit bewertet die tatsächlichen Auswirkungen der Pauschale und vermeidet eine rein politische Betrachtung.
- Bewertung der Pendlerpauschale unter wohlfahrtstheoretischen Aspekten
- Analyse der steuerlichen Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Pendlerpauschale
- Untersuchung der Auswirkungen der Pauschale auf die Mobilität der Arbeitnehmer
- Diskussion der externen Effekte der Pendlerpauschale (z.B. Zersiedlung, Umweltbelastung)
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Politik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pendlerpauschale ein und benennt den jährlichen Steuerausfall als Anlass für die Diskussion um eine mögliche Abschaffung oder Kürzung. Sie hebt die gegensätzlichen Standpunkte von Befürwortern und Kritikern hervor und definiert das Ziel der Arbeit als eine ökonomische Bewertung der Auswirkungen der Pauschale, mit Fokus auf wohlfahrtstheoretische Aspekte und steuerliche Gerechtigkeit. Die Struktur der Arbeit wird dargelegt, welche die Grundlagen der Thematik, eine modelltheoretische Analyse und eine darauf aufbauende Diskussion mit abschließenden Handlungsempfehlungen umfasst.
2 Grundlagen – Status quo: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Einkommensbesteuerung in Deutschland, insbesondere das objektive Nettoprinzip und dessen Umsetzung im Einkommensteuergesetz. Es beschreibt die aktuelle Gesetzeslage bezüglich der Berücksichtigung von Fahrtkosten bei Arbeitnehmern (Werbungskosten) und Unternehmen (Betriebsausgaben), mit detaillierter Erläuterung der Entfernungspauschale und deren geplanter Begrenzung ab 2007. Schließlich werden die zentralen Streitpunkte im Zusammenhang mit der Pendlerpauschale diskutiert, insbesondere die Frage der privaten vs. beruflichen Veranlassung der Fahrten und die Diskussion um die Höhe und pauschale Anerkennung der Fahrtkosten im Vergleich zu anderen Ländern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Pendlerpauschale
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ökonomischen Auswirkungen der Pendlerpauschale in Deutschland, losgelöst von der politischen Debatte. Der Schwerpunkt liegt auf wohlfahrtstheoretischen Aspekten und Fragen der steuerlichen Gerechtigkeit. Es wird eine Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen der Pauschale vorgenommen, wobei eine rein politische Betrachtung vermieden wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Bewertung der Pendlerpauschale unter wohlfahrtstheoretischen Aspekten, der Analyse der steuerlichen Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Pauschale, der Untersuchung der Auswirkungen auf die Mobilität der Arbeitnehmer, der Diskussion externer Effekte (z.B. Zersiedlung, Umweltbelastung) und der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Politik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Darstellung des jährlichen Steuerausfalls und gegensätzlicher Standpunkte, Definition des Ziels der Arbeit (ökonomische Bewertung mit Fokus auf Wohlfahrtstheorie und Steuergerechtigkeit). Kapitel 2 (Grundlagen – Status quo): Grundlagen der Einkommensbesteuerung in Deutschland, aktuelle Gesetzeslage zur Berücksichtigung von Fahrtkosten, detaillierte Erläuterung der Entfernungspauschale und deren geplante Begrenzung, Diskussion der Streitpunkte (private vs. berufliche Veranlassung, Höhe der Pauschale). Kapitel 3 (Modelltheoretische Analyse): Abgrenzung des Modells, Analyse des privat und beruflich veranlassten Pendelns. Kapitel 4 (Diskussion): Vergleich private vs. berufliche Veranlassung, externe Effekte, Gerechtigkeitsaspekt der Entfernungspauschale. Kapitel 5 (Kritische Würdigung / Handlungsempfehlungen): Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die ökonomischen Auswirkungen der Pendlerpauschale in Deutschland zu analysieren und unter wohlfahrtstheoretischen und gerechtigkeitstheoretischen Aspekten zu bewerten. Sie soll die tatsächlichen Auswirkungen der Pauschale aufzeigen und eine fundierte Grundlage für politische Entscheidungen liefern.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine modelltheoretische Analyse, um die Auswirkungen der Pendlerpauschale zu untersuchen. Sie basiert auf einer gründlichen Analyse des Status quo der Einkommensbesteuerung in Deutschland und berücksichtigt wohlfahrtstheoretische und gerechtigkeitstheoretische Aspekte.
An wen richtet sich diese Arbeit?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich mit den ökonomischen und politischen Aspekten der Pendlerpauschale auseinandersetzen möchten. Sie bietet eine fundierte und umfassende Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Malte Dirks (Author), 2006, Sollte die Pendlerpauschale in Deutschland abgeschafft werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119913