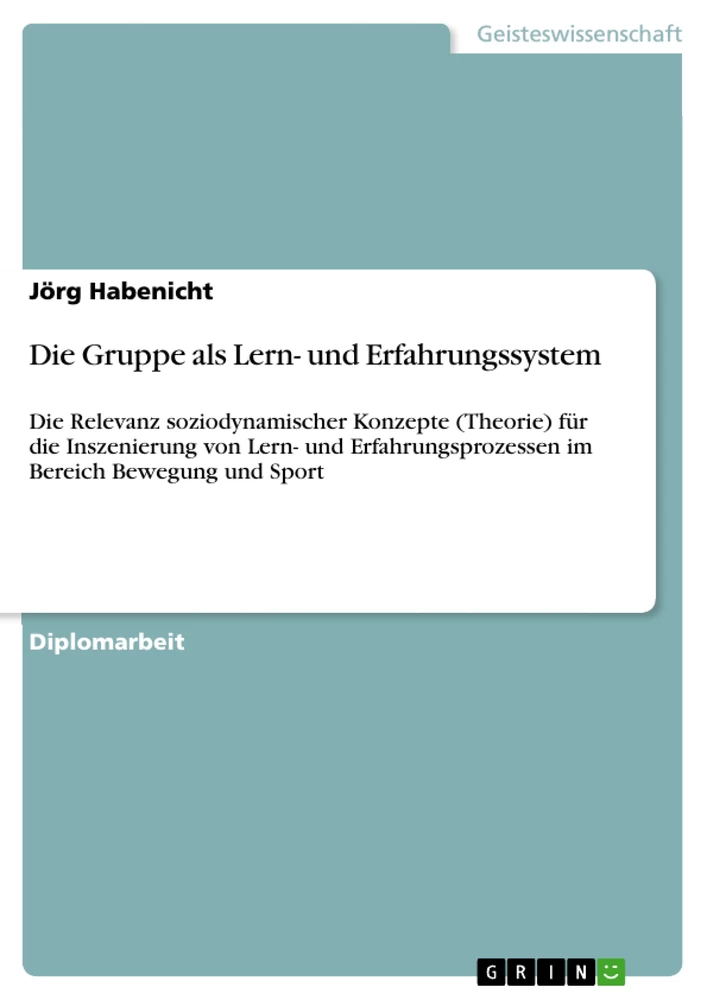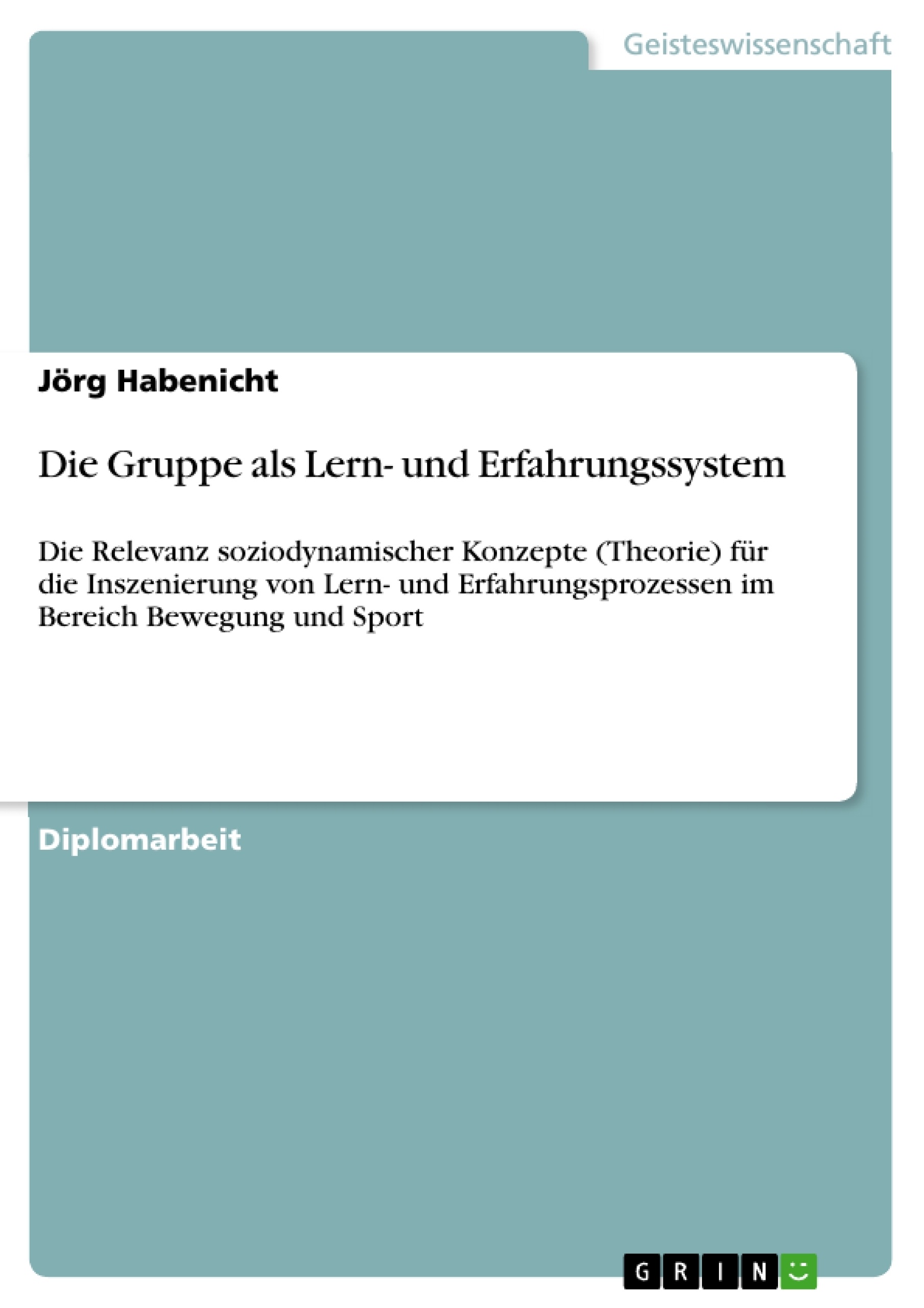Der Gedanke, der letztendlich zur Bearbeitung dieses Themas führte, kam mir auf einem gruppendynamischen Seminar im Dezember 1995. Im Zuge meines Studiums der Sportwissenschaften und der Prävention/Rekreation hatte ich bereits durch einige wenige Lehrveranstaltungen Erfahrungen im Bereich der Psychologie sammeln können. Diese Erlebnisse führten mich zu der Erkenntnis, daß die Anwendungsgebiete der Psychologie im Sport viel zahlreicher sind, als es auf den ersten Blick erscheint.
Während dem oben genannten Seminar, das von Dr. Kleiner geleitet wurde, wurde mir klar, daß nur wenige Bereiche der Psychologie im Sport sinnvoll angewendet werden können.
Die Gruppendynamik hinterließ durch dieses Seminar tiefen Eindruck auf mich, und ich beschloß, mögliche Anwendungsgebiete der angewandten Gruppendynamik im Sport zu erkunden.
Besonderes Interesse galt dabei dem Bereich des Leistungssports, da mir bereits in der Zeit während meines Studiums die wachsende Professionalität aufgefallen war. Die Geldmittel wurden für die Optimierung möglichst vieler leistungsbeeinflußender Bereiche verwendet und so interessierte es mich, welche Bedeutung den Konzepten der Gruppendynamik hier beigemessen wurde. Aber auch im Freizeitsport vermutete ich viele Möglichkeiten, gruppendynamische Anwendungen sinnvoll einzusetzen.
Ich hatte im Laufe meines Studiums gelernt, wie man sportliche Leistung optimiert, Trainingspläne anpaßt und geeignete Umweltbedingungen zum Erbringen einer sportlichen Leistung schafft. Mit der Zeit entwickelte sich jedoch eine zweite Sicht der Dinge, die den Freizeitsport als Vermittler von Spass und Lebensfreude darstellte. Diese verschiedenen Sichtweisen stellten sich letztendlich als gleichbedeutend heraus. So beschäftigt sich die vorliegende Arbeit auch mit beiden Sichtweisen, denn der Zwiespalt, der bei der Literatursuche und der Interpretation von Texten, entstand, ließ mich bald einen Weg der Mitte einschlagen.
Inhaltsverzeichnis
1. PROBLEMAUFRISS
1.1. AUSGANGSPUNKT
1.2. PROBLEMSTELLUNG ( ARBEITSHYPOTHESEN )
1.3. WISSENSCHAFTLICHE METHODE DER ARBEIT
1.3.1. METHODE
1.3.1.1. HERMENEUTIK
1.4. GLIEDERUNG DER ARBEIT
2. DER FORSCHUNGSGEGENSTAND „GRUPPE“
2.1 DEFINITIONEN zum Begriff Gruppe
2.1.1. MITGLIEDERZAHL
2.1.2. INTERAKTION
2.1.3. STRUKTURIERUNG
2.1.4. GEMEINSAME NORMEN
2.1.5. GRUPPENBEWUSSTSEIN ( „Wir-Gefühl“ )
2.1.6. DAUER der Interaktion
2.1.7. ALLGEMEINE BETRACHTUNG der Bestimmungskriterien
2.2. GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN und deren Interpretation
2.3 ABGRENZUNGEN zu anderen sozialen Phänomenen
2.4. TYPOLOGIE sozialer Gebilde: Die „Gruppe“ und andere Formen
2.4.1. EXISTENZFORMEN von Gruppen
2.5. PRIMÄRGRUPPEN - SEKUNDÄRGRUPPEN
2.6. FORMELLE - INFORMELLE GRUPPEN
2.7 DIE SPORTGRUPPE
2.8 GRUPPE ALS SYSTEMTYP : Interaktion <--> Organisation
2.9. STUFEN DER GRUPPENENTWICKLUNG
2.10. EXKURS ÜBER MACHT ( in Kleingruppen )
3. DIE GRUPPENDYNAMIK und ihre Anwendungen
3.1. DEFINITIONEN zum Begriff der Gruppendynamik
3.1.1. AUTORENVERGLEICH und graphische Darstellung
3.2. BEGRÜNDER der Gruppendynamik ( Rückblick )
3.2.1. JACOB LEVI MORENO
3.2.2. KURT LEWIN
3.2.3. TRAUGOTT LINDNER
3.3. GESCHICHTE der Gruppendynamik: Schwerpunkt USA
3.4. GESCHICHTE der Gruppendynamik: Schwerpunkt Europa
3.5. GRUPPENDYNAMISCHE METHODEN
3.5.1. ARBEITSPRINZIPIEN der Trainingsgruppe
3.5.1.1. DAS PRINZIP der „Relativen Unstrukturiertheit“
3.5.1.2. AUFTAUEN-VERÄNDERN-STABILISIEREN
3.5.1.3. DAS PRINZIP des HIER und JETZT
3.5.1.4. FEEDBACK
3.5.2. DAS GRUPPENDYNAMISCHE LABORATORIUM ( GDL )
3.5.3. SENSITIVITY TRAINING ( Selbsterfahrungsgruppe )
3.5.4. ENCOUNTER
3.5.5. MARATHON TRAINING
3.5.6. THEMENZENZRIERTE INTERAKTION ( TZI )
3.5.7. SKILL - TRAINING ( Soziale Fähigkeiten )
3.5.8. KOMMUNIKATIONSTRAINING
3.5.9. TEAMENTWICKLUNG
3.6. ANWENDUNG DER GRUPPENDYNAMIK IM SPORT
4. FALLBEISPIELE: TIEFENINTERVIEWS ZWEIER MANNSCHAFTEN
4.1. ERLÄUTERUNGEN ZUR TECHNIK DER INTERVIEWS
4.1.1 INTERVIEWLEITFADEN
4.2. AUSWERTUNG DER INTERVIEWS
4.2.1 ERLÄUTERUNGEN ZUR AUSWERTUNG DER INTERVIEWS
4.2.2. AUSWERTUNG: SCHWIMMANNSCHAFT
4.2.3. AUSWERTUNG: EISHOCKEYMANNSCHAFT
5. ZUSAMMENFASSUNG
5.1. ABSICHT DER ARBEIT
5.2. BEANTWORTUNG DER ARBEITSHYPOTHESEN
6. ANHANG
6.1. LITERATURVERZEICHNIS
6.2. VERZEICHNIS DER TABELLEN UND ABBILDUNGEN
6.3. ABSCHRIFT DES INTERVIEWS
6.3.1. SCHWIMMANNSCHAFT
6.3.2. EISHOCKEYMANNSCHAFT
6.4. LEBENSLAUF
6.5. ERKLÄRUNG
1. PROBLEMAUFRISS
Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist, die Bedeutung gruppendynamischer Konzepte im Bereich des Freizeit- und Leistungssports näher zu beleuchten.
In einer Zeit, in der Sport eine Hochkonjunktur erlebt und viele der leistungssteigernden Methoden, die im Spitzensport für den kleinen und entscheidenden Vorsprung sorgen, auch im Breitensport angewendet werden, möchte ich gerne im Abseits von Computern, Telemetrie und Medizin der Frage nachgehen, welche Rolle die Gruppendynamik im Kampf gegen die Uhr oder beim Vermitteln von Spass an der Bewegung spielt. In getrennten Theorieteilen sollen sowohl die verschiedenen Formen von Gruppen vorgestellt, als auch die zulässigen soziodynamischen Konzepte herausgearbeitet und auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden.
Den Abschluß sollen zwei Fallbeispiele bilden. In einer Schwimmannschaft und in einem Eishockeyteam werden Tiefeninterviews durchgeführt. Diese Interviews sollen zeigen, wie sehr die vorangegangene Theorie in der Praxis anwendbar ist. Ein Interview-Leitfaden wird zuvor erstellt und in fünf Kategorien unterteilt. Die Interviews werden aufgezeichnet, danach schriftlich übertragen und anhand der bearbeiteten Theorie ausgewertet. Die Ergebnisse aus den Fallbeispielen sollen zeigen, wie Erkenntnisse für den sinnvollen Einsatz gruppendynamischer Konzepte gewonnen werden.
Die Verbindungen der drei Themengebiete, nämlich Soziologie ( Gruppen ),
Psychologie ( gruppendynamische Konzepte ) und Sport ( Mannschaftssportarten ) sollen anhand der Relevanz gruppendynamischer Konzepte dargestellt werden. Im Bereich der Wirtschaft ist man sich über die Steigerung der Leistung durch Gruppendynamik ( Selbsterfahrung ) einig. Die Situation im Sport ist der in der Wirtschaft oft sehr ähnlich, denn auch hier versuchen Gruppen ihre Teamleistung zu verbessern.
So wird in dieser Arbeit der Einfluß der Psychologie und Soziologie auf die Leistungsfähigkeit im Sport näher untersucht.
1.1. AUSGANGSPUNKT
In diesem Kapitel möchte ich auf den momentanen Zustand des Sports näher eingehen und die Relevanz gruppendynamischer Konzepte untersuchen. Um herauszufinden, welche Rolle die Gruppendynamik im Sport spielt, oder spielen kann, muß man sich die Teilbereiche des Sports und deren Entstehungsgeschichte näher ansehen. Leistungssport und Breitensport können klar unterschieden werden. Welcher dieser beiden Bereiche des Sports eher für den Einsatz gruppendynamischer Konzepte geeignet ist, läßt sich nicht so leicht beurteilen.
Auf die Fragen, die diese Problematik hier aufwirft, gibt es keine schlüssigen Antworten. So hätten Zuordnungen zu einem bestimmten Bereich im gesamten Sport bestenfalls Versuchscharakter.
Die Formulierung von Arbeitshypothesen scheint die logische Konsequenz zu sein. Ich möchte in diesem Kapitel mit einer Reihe von Hypothesen konkrete Fragestellungen aufwerfen, die zunächst unbeantwortet bleiben. Erst am Ende der Arbeit sollen Antworten auf die Fragen in den Arbeitshypothesen gesucht werden. Die Erkenntnisse, die während der Erstellung der vorliegenden Arbeit gewonnen wurden, sollen in die Beantwortung der Arbeitshypothesen einfließen. Gerade durch die Erarbeitung und späteren Bearbeitung dieser Hypothesen soll es zu möglichst konkreten Antworten auf konkrete Fragestellungen kommen.
1.2. PROBLEMSTELLUNG ( ARBEITSHYPOTHESEN ).
"Im Zuge der immer stärkeren Differenzierung der Gesellschaft werden auch hinsichtlich des Sports und der sportlichen körperlichen Betätigung verschiedene Paradigmen und Modelle wirksam. Als Mikrokosmos der Gesellschaft spiegelt der Sport zahlreiche brisante Probleme und krisenhafte Tendenzen wider " ( HANSEN 1986. S 43 ).
HEINEMANN ( 1993. S 86 - 88 ) beleuchtet die Entwicklungen voran sehr eingehend und ruft die Situation des Sports vor fünfzehn Jahren in Erinnerung, in der Sport, für ihn, nur eine Randerscheinung unserer Kultur war. In der Schule nur zweitrangig, stellte Sport damals eine schweißtreibende, unterbewertete Aktivität dar, die nur für die Zielgruppe der männlichen Jugendlichen aus der Mittelschicht interessant war. Dieser Zustand ist jedoch in einem Wandel begriffen, der dadurch erklärbar ist, daß immer mehr neue Personengruppen den Sport für sich entdecken. Erwachsene, Senioren, im zunehmenden Maße Frauen aber auch immer öfter Familien, wollen gemeinsam Sport ausüben.
Aber auch der Behinderten- und Rehabilitationssport entwickelt sich in dieser Zeit und sorgt auch mit dafür, daß sich der Sport breit auffächert, um den verschiedenen Ansprüchen der Sporttreibenden in Bezug auf Motivation, Kompetenz und Leistungsorientierung gerecht werden zu können.
Den damit verbundenen Anstieg der Zahl an Aktiven im Sportbereich beschreibt HEINEMANN ( 1993. S 85 ) als ein vorwiegend quantitatives Phänomen:
„Die enorme Entwicklung des Sports läßt sich an den Wachstumsraten der in den deutschen Sportvereinen organisierten Mitglieder ablesen: 1960 waren es 5,3 Millionen, 1970 10 Millionen, 1980 17 Millionen, 1990 wird in Westdeutschland eine Zahl von 23 Millionen Mitgliedern erreicht. Entsprechend stieg die Zahl der Vereine von ca. 29500 im Jahr 1960 auf gegenwärtig ca. 65000 Vereine. Es gibt -- mit Ausnahme des kulturellen Sektors -- keinen anderen Freizeitbereich der eine vergleichbare expansive Entwicklung genommen hat“ HEINEMANN ( 1993. S 85 - 86 ).
Durch die steigende Zahl der Aktiven steigt nicht nur die Zahl der Vereine, sondern der Sportverein sieht sich plötzlich völlig neuen Organisationen, die sportlich Interessierte anlocken wollen, gegenüber.
HEINEMANN ( 1993. S 90 - 91 ) faßt die Organisationen in drei unterschiedlichen Gruppen zusammen:
- staatlich, halb-staatliche Einrichtungen
Volkshochschulen
Bildungswerke
Gewerkschaften
kirchliche Organisationen
Sie benutzen den Sport um neue Mitglieder zu werben. Das Sportangebot soll Leute anlocken, die in weiterer Folge nicht nur am Sportprogramm, sondern auch am „Kernprogramm“ Gefallen finden.
- kommerzielle Sportanbieter
Fitneßcenter
Skischulen
Skiliftgesellschaften
Golf - Tennisplätze, etc.
HEINEMANN spricht von einer „Ware“ Sport, die von den kommerziellen Sportanbietern verkauft wird. Diese Sportanbieter sind rein erwerbswirtschaftlich orientiert und versuchen unter den Gesetzmäßigkeiten des Marktes mit ihrem Sportangebot Gewinne zu erzielen.
- Formen des „informellen“ Sports
Tourismus ( Animation )
Urlaubsgestaltung
Wochenend- und Freizeitgestaltung, etc.
Der Sport als „Hobby“ gewinnt an Bedeutung. Man beginnt selbständig Sport zu treiben und verzichtet auf Mitgliedschaften in Vereinen. Diese Entwicklung ist die Grundlage für den enormen Aufschwung spezieller Trendsportarten, ( Snowboarden, Mountainbiken, Roller - Skaten, etc. ) die „formell“ so gut wie gar nicht existierten.
Eine auch sehr bedeutende Entwicklung, die sich für den Sport im nächsten Jahrtausend absehen läßt, ist die "Überalterung" der Gesellschaft. Durch die Verbesserung der Lebensqualität und die enormen Möglichkeiten der Medizin ist es zu einer höheren Lebenserwartung in den Nationen der ersten Welt gekommen. Daraus ergibt sich automatisch auch eine neue Gruppe von Sportlern, die Pensionisten ( vgl. HEINEMANN 1990. S 78 ).
Der Sport verliert seine Eigenständigkeit aber nicht nur durch die Konkurrenz der Mitstreiter, sondern auch unter dem Druck jener Organisationen, die am Sport an sich Interesse haben. Dazu zählen die Massenmedien, die Wirtschaft ( Sport als Werbeträger ) und die passiven Sportkonsumenten ( Zuseher ) ( vgl. WEISS 1990, S.66 ).
In den letzten Jahren wurde das Interesse der breiten Masse, am Sport aktiv teilzunehmen, geweckt. Als Folge stieg die Zahl an aktiven Vereinsmitgliedern weltweit an. Vor allem die Trendsportarten, wie Snowboarden, Mountainbiken und Inline-Skaten, organisieren sich zunehmend in Vereinen und dadurch können diese Entwicklungen erstmals statistisch erfaßt und in Zahlen ausgedrückt werden.
Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur haben auf den Sportbereich auch deutliche Auswirkungen. Die niedrigen Geburtenraten unserer Zeit stehen einer immmer noch steigenden Lebenserwartung gegenüber. Die Abnahme der Bevölkerung durch den Geburtenrückgang, wird durch die steigende Mobilität der Gesellschaft mehr als ausgeglichen. So kann zum Beispiel ein vermehrter Zuzug von EG- Ausländern und Asylbewerbern beobachtet werden. Die Folgen der steigenden Lebenserwartung sind in der Entstehung einer Fünf-Generationen-Gesellschaft zu erwarten. Ebenso nimmt die Zahl der Personen mit höherer Bildung weiter zu, wodurch sich auf lange Sicht gesehen die Relation von Angstellten und Arbeitern im Arbeitsbereich stark verändern wird (vgl. HEINEMANN 1993. S 92-93 ).
Im Jugendalter werden die Voraussetzungen für ein langandauerndes Verhältnis zum Sport gelegt. Die Tatsache, daß heute noch vergleichsweise wenige Erwachsene und Ältere Sport treiben, ist auf die schlechteren Voraussetzungen für die Hinführung zum Sport in früheren Jahren zu erklären. Eine lebenslange Beziehung zum Sport und eine aktive Ausübung werden aufgrund veränderter Bedingungen immer mehr zur Selbstverständlichkeit.
Die vormals hauptsächlich leistungsorientierten Zielsetzungen werden durch die Entstehung von neuen Zielen im Sport komplettiert. Körperformung und Fitneß, Entspannung und Erleben rücken immer mehr in den Vordergrund. Es entwickelt sich eine neue Gruppe im Freizeitsport;die der „ junggebliebenen Erwachsenen“. Sportliche Bewegung ist für sie bereits ein fixer Bestandteil des Lebens geworden. Auch im zunehmenden Alter ist diese Gruppe bereit, Zeit und Geld aufzuwenden, um jung, fit und somit leistungsfähig zu bleiben. Ein nettes äußeres Erscheinungsbild, gestärktes Selbstbewußtsein und ein Mehr an sozialer Aktzeptanz, sind für diese Personengruppe Motiv und Belohnung zugleich.
An dieser Stelle möchte ich folgende Fragestellung, durch die Formulierung der ersten Arbeitshypothese, aufwerfen.
THESE 1 : Bewegung und Sport sind Grundbedürfnisse des Menschen.
THESE 1.1: Der Bereich des Freizeitsports vermittelt diese Grundbedürfnisse ohne Leistungsdruck.
THESE 1. 2: Die Anwendung von soziodynamischen Konzepten ist zur Erfüllung von Grundbedürfnissen nicht vorteilhaft.
Zwei weitere Punkte, die HEINEMANN ( 1993. S 94-95 ) in seinem Artikel besonders herausstreicht, sind die Erweiterung des Dispositionsraumes des Einzelnen und die zunehmende Individualisierung. Er spricht damit den Wandel des Verhältnisses von Arbeitszeit und Freizeit an. Die Lebenserwartung steigt und die Arbeitszeit, auch im Bezug auf Wochenarbeits-, Jahresarbeits- und Lebensarbeitszeit, nimmt immer weiter ab. Der Einzelne sieht sich immer mehr freier Zeit gegenüber, die er aktiv gestalten kann.
Gleichzeitig verlieren Merkmale der Zugehörigkeit, zu einer Altersgruppe, zum gleichen Geschlecht, zur beruflichen Gruppe oder zu einer sozialen Schicht, ihre bindende Kraft. Der Sportbereich reagiert ebenfalls darauf und verbreitert sein Spektrum des Angebots. die Vielgestaltigkeit der Freizeitkultur reicht vom Angebot der Vereine bis hin zu kommerziell geführten Sporteinrichtungen. läßt sich eine viel größere Vielseitigkeit in der Betätigung des Sportinteressierten beobachten. Der Freizeitsportler sucht sich nicht mehr eine Sportart aus, um nach dem traditionellen Muster in dieser Sportart sein Glück zu versuchen, sondern plant seinen sportlichen Alltag gleich einem Menüplan. Der sogenannte Do-it-yourself-Bewegung stellt die Spitze der Eigenständigkeit im Freizeitsport dar.
BETTE ( 1993. S 44-45 ) unterscheidet in diesem Bereich den „ modernen Sportnomaden, die zwischen den diversen Praktiken hin und her vagbundieren“ und „ Außenstehende, die noch traditionell im Sport sozialisiert wurden, und alten Bindungs- und Treueidealen Folge leisten.“
Folgendes Zitat soll ein Beispiel für die Ansichten des Autors geben:
„Wie ein Bastler/Pfuscher ( bricoleur ), der sich seine Weltanschauung und sein Erlebnis- und Handlungsrepertoire selbst zusammensteltt, oszilliert der individualisierte Sportler zwischen den verschiedenen Sportarten hin und her und klopft das Angebot auf schnelle und durchaus kontroverse Sinngebung ab - vergleichbar mit einem Fernsehzuschauer, der auf der Suche nach spannungsgenerierenden Ereignissen mit Hilfe seiner elektronischen Fernbedienung gelangweilt zwischen den diversen Sendern flaniert: montags Tai Chi, dienstags Jogging im Wald, mittwochs Fußball und am Wochenende Bauchtanz in der Männergruppe“ ( BETTE 1993. S 44 ).
BETTE ( 1993. S 45 ) zieht eine viel schärfere Trennungslinie zwischen alt und neu als HEINEMANN ( 1993 ) und reiht den modernen Freizeitsportler unter einem klaren Motto ein:
„Ich nehme mein Schicksal in die eigenen Hände.“
Der Sportinteressierte sucht sich seine eigene Mischung an verschiedenen Sportarten und kreiert so seinen eigenen Menüplän. So kann sich der Einzelne von den Massen abheben und sein eigenes Profil schaffen. Aber selbst hier ist er von Kopien und Konkurrenz gefährdet. Dieses Streben nach Einzigartigkeit unterliegt natürlich auch gewissen Grenzen und sich auf diese Grenzen zubewegen zu können, scheint einen besonderen Reiz am Sportbereich auszumachen.
Aber gerade in dem Versuch sich abzugrenzen, liegt auch die Gefahr sich in Bereichen aufzuhalten, die nur mehr von Gleichgesinnten besucht werden. So trifft sich durch Entwicklung von Individualität die ausgesiebte Gleichheit. BETTE ( 1993. S 45 ) nennt dieses Phänomen „Paradoxie der Individualität“ und führt als Extrembeispiel die Gleichheit der Körper im Bodybuilding an.
Der Sportler kann sich nun dadurch von anderen absetzen, indem er sich durch Leistungen profiliert, die andere zu erbringen nicht in der Lage sind. Der Bereich des Sports ist dazu ein sehr gut geeignetes Handlungsfeld ( vgl. BETTE 1993. S 46 -54 ).
GEBAUER beschreibt dieses Phänomen im Sport so: „Der Sport vereinigt Individuen ohne Unterschiede, aber er trennt sie auch scharf voneinander. Er öffnet sich gegenüber Minderheiten, hebt aber ihre körperliche Andersheit deutlicher hervor als jedes andere Handlungssystem“ ( HORTLEDER / GEBAUER 1986. S. 114 )
In diesem Streben nach Einzigartigkeit benötigt der Einzelne natürlich die Menge, von der er sich absetzen kann. Auch in Sportgruppen werden Unterschiede der Gruppenmitglieder schnell ermittelt. Dieses Bestreben sich von den anderen zu unterscheiden, kann entweder leistungsorientiert oder im menschlichen Bereich erfolgen.
Zu dieser Problematik möchte ich eine weitere Arbeitshypothese formulieren.
THESE 2: Das Erkennen und Akzeptieren von Leistungsunterschieden ist Grundvoraussetzung für die Gleichberechtigung von Gruppenmitgliedern.
THESE 2.1: Durch den Einsatz gruppendynamischer Konzepte sind Gruppenmitgliedern eher bereit, die Stärken und Schwächen anderer zu respektieren.
Es stellt sich nun die Frage, ob im Rahmen gemeinsamer körperlicher Betätigung, die Bedeutung von Leistungsfähigkeit über die soziale Wertigkeit der einzelnen Gruppenmitglieder zu stellen ist ?
Während im Leistungssport Klarheit herrscht, ist es im Freizeit- und Breitensport unterschiedlich, wohin die Entwicklungen führen. Gerade der Bezugsperson der Gruppe, dem Trainer, Übungsleiter oder Betreuer kommt hier enorme Bedeutung zu.
Er kann entscheidend auf das Klima innerhalb der Gruppe Einfluß nehmen. Aus dieser Sichtweise heraus möchte ich eine weitere Arbeitshypothese formulieren:
THESE 3 : Bei der Auswahl von Betreuern für Sportgruppen im Freizeitsport ist dem fachspezifischen Trainer, mit kaum gruppendynamischer Erfahrung, der Vorzug vor dem sportlich versierten, aber nur gruppendynamisch ausgebildeten Betreuer zu geben.
Abgesehen von einem pädagogischen Geschick, über das ein Trainer verfügen sollte, sollte er auch von der Gruppenpsychologie ein gewisses Maß an Wissen vorzeigen können. Gerade die Trainer von Sportspielmannschaften und Trainingsteams sind mit einer Mehrzahl von Personen konfrontiert, unter denen es zu mehr oder weniger ausgeprägten Interaktionen kommen kann. DAMM (1991) berichtet von einer gruppendynamischen Intervention, die er als Trainer bei einer Gruppe von 13jährigen Sportlern angewendet hat. Der Autor hat diese Trainingsgruppe von einem Trainer übernommen, der die Gruppe autoritär und individuumsbezogen betreut hat. Der von DAMM favorisierte demokratische Führungsstil führte jedoch dazu, daß die Gruppe diesen Umstand ausnutzte und das eigentliche Unterrichtsziel (das Leichtathletiktraining) zugunsten von Fußballspielen aus den Augen verlor. In der Folge dieser Entwicklungen hat sich der Trainer mit einem Motivations- und Autoritätsproblem konfrontiert gesehen. Aufgrund der persönlichen gruppendynamischen Erfahrungen des Autors, gelang es die Gruppe neu zu motivieren und dadurch die Fachkompetenz unter Beweis zu stellen. Der Autor führt das Gelingen dieses "Feldexperiments" auf seine gruppendynamische Erfahrung und sein pädagogisches Geschick zurück ( vgl. DAMM 1991. S. 295-302 ).
Die Tatsache, daß Gruppen meist Gegenstand "trainerischen Wirkens" sind, wäre es nur allzu selbstverständlich Übungsleiter in das Wesen der Gruppendynamik einzuführen
Ich möchte diese Fragestellung aus der Sicht der betreuenden Person und den zur Betreuung notwendigen Fähigkeiten mit einer weiteren Arbeitshypothese beleuchten.
THESE 4 : Bezugspersonen einer Gruppe im Sport sollten über theoretische und praktische Erfahrungen der Gruppendynamik verfügen.
Im Bereich des Leistungssports hat der Professionalismus auf ganzer Linie Einzug gefeiert. In seinem Fahrtwind sind enorme Geldbeträge in den Sportbereich eingeflossen, die rasch für Veränderungen gesorgt haben.
So hat der Leistungsgedanke eine Lawine der Rekordjagd losgetreten, die die sogenannten „alten“ Werte des Sports ( Fairneß, Sportlichkeit, Kameradschaft, Olympischer Gedanke ) stark in den Hintergrund gedrängt hat.
Im Vergleich zum heutigen Standard, im „Egoistensport“ Skifahren, stellt Franz KLAMMER die Situation beim ÖSV ( Österreichischer Skiverband ) im Sommer 1972, am Beginn seiner Weltcupkarriere, im Rückblick so dar:
„ Es geht sofort mit frischem Wind los. Ein total neuer Geist. Jeder ist für jeden da. Eine harmonische Supertruppe“ ( PRÜLLER 1987. S 114 ).
Die momentane Situation im Spitzensport zeigt jedoch, wie schonungslos um die Gunst der Fans und Preisgelder, um Prestige und Werbewirksamkeit gekämpft wird. Der Zweck heiligt die Mittel und so leisten sich zum Beispiel die Stars im alpinen und nordischen Skisport bereits persönliche Trainer oder Manager.
Sport-Idole, wie Günther Mader mit seinem Trainer Trenkwalder, Alberto Tomba mit Trainer und Manager Brunner und Andreas Goldberger mit Manager Federer zeigen vor, wie man Fans und Sponsoren bei Laune hält.
Milliardensummen an US-Dollars werden pro Jahr an Investitionen und Sponsoring ausgegeben und in Form von Werbeeinnahmen und Erträgen aus Merchandising wieder eingebracht.
Die Zahl der professionellen Athleten wächst nur geringfügig, die Leistungen dieser Sportler heben sich aber immer weiter vom Breitensport ab. Die Veränderungen in finanzieller Hinsicht haben zu ganzjährigen Trainingsmöglichkeiten, perfekten Trainingsbedingungen und zu pausenloser medizinischer und psychologischer Betreuung geführt.
Die Athleten werden auf Höchstleistungen getrimmt und so werden auch Höchstleistungen von ihnen erwartet, für die man jetzt auch bereit ist, Höchstsummen zu bezahlen.
Auf die Frage, ob es ihm leid tue nicht das ganz große Geld mit dem Skifahren gemacht zu haben, antwortet Franz Klammer, der als der erfolgreichste Abfahrer aller Zeiten, im Jahre 1985 seine Karriere mit 25 Abfahrts- Weltcupsiegen beendete, folgendes:
„Nein, Skifahren hat mir Spaß gemacht , mich so bereichert, weniger materiell, mehr ideell und kameradschaftlich, mir soviel Lebenserfahrung gegeben - was soll´s ? Ich war in einer besseren Zeit als Sailer, in einer schlechteren als die jetzigen Stars - was will ich ?“
( PRÜLLER 1987. S 129 ).
Derzeitiger Spitzenverdiener des Sports ist Profi - Basketballer Michael Jordan, der für seinen Spielvertrag bei den Chicago Bulls ( zuzüglich Werbeeinnahmen ) in der letzten Saison über 400 Millionen ÖS auf seinem Konto verbuchen durfte.
Mit solchen Verdiensten steigt natürlich auch der Druck, der auf den Sportlern lastet. Er kann von den Einzelsportarten zu den Mannschaftssportarten noch weiter zunehmen. Der Konkurrenzkampf und die Rivalität untereinander können zu Neid und Mißgunst führen, Kameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl können ins Abseits gedrängt werden, und die Motivation des Sportlers, für seine Mannschaft das Beste zu geben, kann sinken.
Den Athleten wird bei solchen Belastungen Hilfestellung geboten, indem sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet wird. Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Bereich im Spitzensport genügend abgedeckt ist, oder ob man hier erst am Beginn der Möglichkeiten steht. Aus diesem Gedanken heraus wird eine Arbeitshypothese formuliert:
THESE 5: Soziodynamische Konzepte tragen dazu bei, die Handlungen, der im Bereich des Leistungssports
( Mannschaftssports ) agierenden Menschen, zu begründen und
zu erklären.
THESE 5.1: So können zwischenmenschliche Defizite sichtbar gemacht und eventuell abgebaut werden.
THESE 5. 2: Die Zufriedenheit der Mannschaftsmitglieder steigt, und gleichzeitig steigt auch die Motivation der Mitglieder, sich für das Ziel der Gruppe einzusetzen.
Man findet also heute im Spitzensport Gruppen mit einer Aufgabe; nämlich Leistungen zu erbringen, die dann in Siege münden sollen. Der einzelne Leistungssportler wird dabei mit einer Vielzahl von Faktoren beeinflußt. So trainiert er das ganze Jahr über mit seinem Trainer und seiner Manschaft oder Trainingsgemeinschaft. Er erlebt die Konkurrenzsituation zu einigen Teammitgliedern und die Rivaltiät seines Teams mit anderen Teams. Auch wird er konfrontiert mit Eigenheiten seines Trainers, des Geschäftführers und auch mit den Besonderheiten seines Klubpräsidenten und der Öffentlichket. Diese Mixtur an Personen ergeben eine große Gruppe mit Untergruppen, in der sich der Sportler bewegt. Diese Gruppen sind aber auch dauernd in Bewegung. Der Trainer wird gekündigt, und eine Interimslösung überbrückt die Zeit bis der Neue kommt. In Mannschaftssportarten werden die Legionäre ständig getauscht, geholt, gewechselt und zurückgeschickt.
Der Leistungssportler in diesem Beispiel wird wegen seiner Spielstärke auch noch in das Nationalteam einberufen. Hier entsteht eine gänzliche neue Gruppe aus Vereinskollegen, fremden und bekannten Spielern, verhaßten und beliebten Kollegen und einem neuen Trainer.
Die Konkurrenzsituation erfährt ebenfalls eine neue Dimension, da der Leistungsdruck noch stärker ist. Gruppenprozesse, Intergruppenprozesse finden sich in großer Zahl und beeinflussen den Leistungssportler nachhaltig.
Hier gäbe es mehrere Möglichkeiten mit gruppendynamischen Methoden zu arbeiten.
Eine Anwendung der gruppendynamischen Konzepte in jedem möglichen Teilbereich würde alle Beteiligten überfordern und so muß das Einsatzgebiet sorgfältig ausgewählt werden.
THESE 6: Eine Analyse nach dem dringendsten Bedarf muß einer gruppendynamischen Intervention vorausgehen.
Eine weitere Gefahr im Bereich des Leistungssports, besteht darin, die Gruppendynamik gleichberechtigt mit anderen Trainingsinhalten in den Trainingsplan aufzunehmen.
Im negativsten Fall würde die Anwendung von gruppendynamischen Konzepten als inhaltlicher Programmpunkt irgendwann in der Vorbereitungsphase am Terminkalender stehen. Nach der, im Leistungssport noch immer tief verwurzelten, „Hopp und Zack“- Methode würden Seminare besucht, Konzepte angewendet und die leistungsfördernde Maßnahme Gruppendynamik, wie ein Höhentrainingslager absolviert werden.
DORST ( 1977 ) beschreibt diese Problematik so: „Guppendynamik beschäftigt sich damit, das Miteinander von Menschen als einen dynamischen Prozeß zu analysieren, zu beschreiben, zu begreifen und zu verändern. Diese Prozesse durchlaufen regelhaft bestimmte Phasen, bilden Strukturmuster und funktionale Rollen aus. Die gruppendynamischen Phänomene sind jedoch aufgrund der Komplexität der menschlichen Interaktion nicht eindeutig vorhersagbar und nicht in einfachen Modellen abbildbar“ ( DORST 1977. S. 271 )
Gruppendynamik ist eine methodische Anleitung zur Überprüfung von Erfahrungszusammenhängen in sozialen Situationen. Das bestimmt den Selbsterfahrungsanteil der angewandten Gruppendynamik ( vgl. DORST 1977. S. 271 ).
Dorst zeigt hier die Problematik der angewandten Gruppendynamik auf. Der Sport wendet sich solchen ungewöhnlichen Hilfsmitteln, wie der angewandten Gruppendynamik, meist erst dann zu, wenn dies eine Krisensituation erfordert. Schnelle, rasche Hilfe, gleich einer Auffrischungsimpfung, ist angesagt.
Die angewandte Gruppendynamik kann auch sofort eingesetzt werden, nur ihre Resultate und Auswirkungen zeigen sich erst verzögert. So wird eine Tatsache immer klarer:
THESE 7 : Die angewandte Gruppendynamik muß über längere Zeit angewendet werden, um ihren Ansprüchen gerecht werden zu können.
Eine weitere Frage die sich mit der Anwendung von soziodynamischen Konzepten stellt, ist die Frage der Qualifikation und Kompetenz im Bereich der Gruppendynamik.
Die Gruppendynamik hat sich aus Theorien und Formen der Anwendung herausgebildet. Ihre Grundsätze können nicht in Zahlen ausgedrückt oder durch Fakten bewiesen werden. Die Schwierigkeiten beim verdeutlichen ihrer Auswirkungen und Nichtwirkungen haben selbstverständlich Kritik wach werden lassen ( vgl. DORST 1977. S. 272 ).
Eine Vernachlässigung dieses Problembereiches kann folgende Auswirkungen haben:
„ -- Die Diskreditierung der Gruppendynamik durch ihre Kommerzialisierung
-- Das Problem der Schädigung von Teilnehmern an gruppendynamischen Veranstaltungen“
( DORST 1995. S. 272 ).
Auch BRADFORD, GIBB und BENNE ( 1972 ) lassen eine Warnung ergehen:
„daß Personen, die fachlich unzureichend ausgebildet oder von ihrer Persönlichkeitsstruktur her oder Motivation her ungeeignet sind, dieser Nachfrage zu entsprechen. Ohne die Supervision kompetenter und ethisch verantwortlicher Trainer können T-Gruppenerfahrungen für die Teilnehmer schädigend sein. Und die T-Gruppenmethoden werden diskreditiert, wenn die, die sie anwenden, vernünftigen methodischen und ethischen Normen nicht gerecht werden“ ( BRADFORD/ GIBB/ BENNE 1972. S. 429 ).
Der Begriff der angewandten Gruppendynamik bezieht sich auf die Tätigkeit des Anwendens. Die Funktion des GD-Trainers ( GD-Trainerin ) ähnelt stark einer Lehrtätigkeit. Er vermittelt jedoch nicht den herkömmlichen Stoff, den man auswendig lernen und so beherrschen kann. Wenn der GD-Trainer gruppendynamische Konzepte anwendet, so bringt er sich selbst ein und animiert die Teilnehmer zum Mitmachen. Gleichzeitig beobachtet und analysiert er die Geschehnisse in der Gruppe.
Er erfüllt seine Funktion als Organisator und Gestalter individueller und kollektiver Lern- und Erfahrungsprozesse. Seine Fähigkeiten, die Reaktion auf Geschehnisse und das Umsetzen in Verhalten, sind sehr eng mit seiner Persönlichkeit verknüpft ( vgl. DORST 1995. S. 277 ).
So möchte ich eine Fragestellung aufwerfen, die dieses Kapitel, mit der Formulierung der letzten Arbeitshypothese, beschließt.
THESE 8 : Wieviel vom Job eines Gruppendynamik-Trainers kann man erlernen ? oder anders gefragt: Wer hat das Talent zum GD-Trainer ?
1.3. WISSENSCHAFTLICHE METHODE DER ARBEIT
1.3.1 METHODE
Das Wort „Methode“ kommt aus dem Griechischen. Das Wort „methodos“ ( Methode ) setzt sich zusammen aus den Wörtern „metà“ ( -entlang- ) und „hodòs“ ( -Weg- ).
„Methode bedeutet also soviel wie das „Entlanggehen eines Weges“.
DANNER ( 1994 ) bezeichnet die Methode als „ das Verfahren, das einen bestimmten Weg aufzeigt, um ein vorgesetztes Ziel zu erreichen“ ( DANNER 1994. S. 12 ).
Methodisches Arbeiten ist gekennzeichnet durch planvolles Vorgehen und durch die Einhaltung bestimmter Regeln. Innerhalb einer Wissenschaft kann es mehrere taugliche Methoden zur Erreichung eines Forschungsziels geben. Jede Wissenschaft ersucht, die Methoden, die ihr am angemessensten sind, herauszufinden, zu begründen und abzugrenzen.
Die Bemühungen einer Wissenschaft um ihre Methoden können unter dem Begriff „Wissenschaftstheorie“ zusammengefasst werden ( vgl. DANNER 1994. S. 12 )
Die bekanntesten Vorgangsweisen im Bereich der Sportwissenschaften sind die „hermeneutische Methode“ und die „empirische Methode“.
In weiterer Folge möchte ich die „hermeneutische Vorgangsweise“, Hermeneutik, die auch als alleinige Methode zur Durchführung dieser Arbeit gewählt wurde, genauer beschreiben.
1.3.1.1 HERMENEUTIK
Die Hermeneutik ist eine geisteswissenschaftliche Methode zur sinngemäßen Auslegung
( Interpretation ) von geistigen Produkten ( Texte, Musik, Kunst, Handlungen .. ) mit dem Ziel der Sinneserfassung oder des Verstehens ( vgl. RÖTHIG 1992. S 133 ).
„ Es ist der Inhalt der Hermeneutik, den Verstehensvorgang zu untersuchen und ihn uzu strukturieren“ ( DANNER 1994. S. 31 ).
Diese beiden Definitionen der „ Hermeneutik“ möchte ich bewußt vorausschicken, um damit näher auf die Inhalte dieser Methode eingehen zu können. In beiden Definitionen taucht der Begriff des „Verstehens“ auf.
Auch SOBOTKA ( 1992 ) hält fest, daß man den Inhalt eines Textes verstanden haben muß, um ihn interpretieren zu können.Den Sinn einer Aussage verstanden zu haben, beschreibt er so: „Erkennen von etwas als etwas ( Menschliches ) und gleichzeitig das Erfassen seiner Bedeutung“ ( SOBOTKA 1992. S.85 ).
Das Wort der Interpretationslehre „Hermeneutik“ entwickelte sich bereits in der altgriechischen Zeit. Das zugehörige Verb heißt „hermeneùein“ und bedeutet:
aussagen ( ausdrücken ), auslegen ( erklären ) und übersetzen ( interpretieren ).
Das lateinische „interpretare“ entspricht dem griechischen „hermeneùein“.
Ähnlich einem Übersetzer, im Englischen „ interpreter“, muß der Autor einen Sachverhalt richtig verstehen und deuten, um ihn für seine Sache entsprechend weiterverwenden zu können. Eine Interpretation ist hier ebenso vonnöten, wie bei Übersetzungen von Fremdsprachen, da auch hier eine wörtliche Übersetzung meist schlecht oder falsch ist.
So bezeichnet man die Hermeneutik auch als die „Kunst der Auslegung“
( vgl. DANNER 1994. S. 31 ).
DANNER ( 1994 ) teilt in weiterer Folge die Entwicklung der Hermeneutik in drei Strömungen ein:
1. die philologisch-historische Hermeneutik (z.B: Wie ist Homers „Odyssee“ zu verstehen ? ).
2. die theologische Hermeneutik (Wie interpretiert man Altes und Neues Testament ? ).
3. die juristische Hermeneutik ( Auslegung und Anwendung vorgegebener Gesetze ).
Aus diesen drei Einzeldisziplinen entwickelte F. SCHLEIERMACHER ( 1768 - 1834 ) eine
allgemeine Hermeneutik, die er als „Kunstlehre des Verstehens“ etablierte
( vgl. DANNER 1994. S.33 ).
DANNER ( 1994 ) weist auch auf Grundbegriffe der Hermeneutik hin. „Das Verstehen“ ist ein zentraler Begriff der Hermeneutik. Eine Fortsetzung davon wäre „die Verbindlichkeit des Verstehens“. Aus diesen beiden Grundbegriffen entwickelte sich ein Modell, das zur Erlangung von übergreifendem Verständnis unerläßlich ist: Der hermeneutische Zirkel
Er geht auf F. SCHLEIERMACHER ( 1768 - 1834 ) zurück und gilt seitdem als Modell dafür, wie übergreifendes Wissen entsteht. Das Grundprinzip dieses Modells läßt sich so beschreiben: Eine Erkenntnis vervollständigt bestehendes Wissen und führt so zu einer neuen Erkenntnis, die weitere Zusammenhänge offenbart und so .( vgl. DANNER 1994. S. 57 ) .
Auf der nächsten Seite möchte ich mit der graphischen Darstellung zweier Modelle von „Hermeneutischen Zirkeln“ ( ABBILDUNG 1;2 ), sowie deren anschließender Beschreibung, ein noch einfacheres Verständnis ermöglichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ERKLÄRUNG: V = Vorverständnis; T = Textverständnis; V1 = erweitertes Vorverständnis; T1 = erweitertes Textverständnis usw.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ABBILDUNG 2: Hermeneutischer Zirkel II
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ERKLÄRUNG: T = Teil, z.B. Wort; G = Ganzes, z.B. Satz; T1 = vom Ganzen her interpretierter Teil; G1 = vom Teil her interpretiertes Ganzes usw.
„Höheres Verstehen“ verläuft nicht geradlinig ( von Erkenntnis zu Erkenntnis ) sondern kreisförmig. Gewonnene Erkenntnisse lassen sich nicht addieren, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Ein gutes Beispiel eines hermeneutischen Zirkels stellt das Verhältnis von Theorie zu Praxis dar. Die verschiedenen Einflüsse kreisen zwischen den beiden Seiten hin und hinterlassen überall ihre Spuren..So entsteht eine Bewegung des „Verstehens“ die als hermeneutischer Zirkel betrachtet wird.
1.4. GLIEDERUNG DER ARBEIT
Das Kapitel „Problemaufriss“ als Einleitung beschäftigt sich mit dem momentanen Zustand des Sports. Die Entwicklungen im Laufe der Geschichte des Sports werden beleuchtet und es wird so eine Trennung zwischen Leistungs- und Breitensport vollzogen. Im weiteren Verlauf werden Arbeitshypothesen formuliert, die konkrete Fragestellungen aufwerfen. Diese Fragestellungen zielen darauf ab, die Relevanz gruppendynamischer Konzepte sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport herauszufinden. Die Notwendigkeit einer gruppendynamischen Ausbildung für Trainer - auch die Qualität der Ausbildung und die Kompetenz der Trainer betreffend - wird ebenfalls hinterfragt.
Die Methode, die bei der Ausarbeitung der Arbeit verwendet wurde, wird in einem Unterkapitel gesondert vorgestellt.
Um eine bessere Orientierung in der Arbeit zu ermöglichen, werden in einem weiteren Unterkapitel die Inhalte der einzelnen Abschnitte der Arbeit vorgestellt.
Das Kapitel „Der Forschungsgegenstand Gruppe" stellt die Gruppe - der zentrale Bestandteil angewandter Gruppendynamik - vor. Anhand der Ausführungen ausgewählter Autoren soll der Begriff „Gruppe“ konstruktiv definiert werden, um mit diesem zentralen Gegenstand der Arbeit hermeneutisch korrekt umgehen zu können.
Die in der Literatur vorhandenen Definitionen zu diesem Begriff werden mit den Kriterien in der Definition von SCHNEIDER ( 1985 ) verglichen. Die Gemeinsamkeiten und Abweichungen der acht Autoren werden anhand von Tabellen und einer Gesamtansicht veranschaulicht und schriftlich interpretiert.
Das folgende Kapitel soll jenen IST-Zustand offenlegen, der für das weitere Verständnis von Gruppendynamik und ihrer unterschiedlichen Konzepte nötig ist. In einer Übersicht soll die Gruppe gegenüber anderen sozialen Phänomenen abgegrenzt werden.
Jene Faktoren, die die Gruppe definieren und die zu ihrer Bestimmung dienen, werden im Anschluß daran erklärt. Die verschiedenen Definitionen, die es von zahlreichen Autoren für Gruppen gibt, sollen in einer Übersicht auf Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen beleuchtet werden. Ein weiteres Unterkapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Formen der Gruppe und erläutert auch, wie es zu deren Bildung kommt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf den Typ der "Kleingruppe" gelegt. Auch die Merkmale einer „Sportgruppe“ sollen in diesem Kapitel näher beleuchtet werden. Ein Exkurs über „Macht“, wie sie gerade in Gruppen vorkommen kann, soll diesen theoretischen Teil der Arbeit komplettieren.
.
Im nächsten Kapitel wird auf die Gruppendynamik genauer eingegangen. In diesem zentralen Teil der Arbeit geht es vor allem um die Beleuchtung der Hintergründe, die zur Entwicklung der Gruppendynamik geführt haben. Ein einleitender Teil stellt verschiedene Definitionen in der Literatur dar. Es erfolgt ein Autorenvergleich, der auch graphisch veranschaulicht wird..
In einem Rückblick werden die Protagonisten der Gruppendynamik mit ihren Lebensgeschichten vorgestellt. MORENO und LEWIN, die beiden Europäer, die erst in Amerika den Durchbruch schaffen, werden hier dem Leser näher vorgestellt. Ebenso reist man durch die Geschichte und kann die Stufen der Geburt der Gruppendynamik nachvollziehen.
Eine Biographie ist auch Traugott LINDNER gewidmet, der dafür Verantwortung zeichnet, daß die Gruppendynamik in Österreich sehr früh Fuß fassen konnte. Auf seine Initiative hin, erfolgte das erste gruppendynamische Seminar Europas in Linz im Februar 1954.
Die Entwicklungen der Gruppendynamik in den Vereinigten Staaten von Amerika werden in einem weiteren Kapitel behandelt. Da sich die beiden Kontinente nicht immer in die gleiche Richtung bewegten, wird die europäische Geschichte ebenfalls gesondert vorgestellt.
In weiterer Folge werden die verschiedenen Anwendungsformen der Gruppendynamik inhaltlich und methodisch vorgestellt. Auch die Grundprinzipien gruppendynamischen Arbeitens, die noch auf LEWIN zurückgehen, werden hier genauer bearbeitet. Abschließend werden die Anwendungsformen in einem gesonderten Kapitel auf ihre Anwendung im Sport untersucht.
Im vierten Kapitel sollen mit der Hilfe zweier Mannschaften Fallbeispiele untersucht werden. Die Durchführung sog. Tiefeninterviews und deren Auswertung, soll zeigen, wo ein möglicher Einsatzbereich für Gruppendynamik in der Praxis ist.
Ein Interviewleitfaden, der eine Richtlinie zur Durchführung der Interviews sein soll, wird noch vor dem Treffen mit den Teams ausgearbeitet. ( Kapitel 4.1. ).
Die Interviews werden auf Band aufgezeichnet und zur Auswertung zu Papier gebracht.
Im abschließenden Teil der Arbeit, Kapitel fünf „Zusammenfassung“ werden die in Kapitel 1.2. formulierten Arbeitshypothesen beantwortet. Dieser Versuch einer Beantwortung wird auf den Erkenntnissen der vorangegangenen theoretischen Kapitel basieren. Das Kapitel „Ausblick“ beschließt die Arbeit.
2. DER FORSCHUNGSGEGENSTAND „GRUPPE“
Das folgende Kapitel soll jenen IST-Zustand offenlegen, der für das weitere Verständnis von Gruppendynamik und ihrer unterschiedlichen Konzepte nötig ist. Anhand der Ausführungen ausgewählter Autoren soll der Begriff „Gruppe“ konstruktiv definiert werden, um mit diesem zentralen Gegenstand der Arbeit hermeneutisch korrekt umgehen zu können. In einer Übersicht soll die Gruppe gegenüber anderen sozialen Phänomenen abgegrenzt werden.
Jene Faktoren, die die Gruppe definieren und die zu ihrer Bestimmung dienen, werden im Anschluß daran erklärt. Die verschiedenen Definitionen, die es von zahlreichen Autoren für Gruppen gibt, sollen in einer Übersicht auf Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Überschneidungegn beleuchtet werden. Ein weiteres Unterkapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Formen der Gruppe und erläutert auch, wie es zu deren Bildung kommt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf den Typ der "Kleingruppe" gelegt. Auch die Merkmale einer „Sportgruppe“ sollen in diesem Kapitel näher beleuchtet werden. Ein Exkurs über „Macht“, wie sie gerade in Gruppen vorkommen kann, soll diesen theoretischen Teil der Arbeit komplettieren.
Mit einer Übersicht von SCHNEIDER ( 1985. S 12 ) soll auf die Entwicklung der Gruppenforschung hingewiesen machen. Die Zahl der Publikationen, Untersuchungen und Forschungsreihen nimmt jährlich zu, und so läßt sich erahnen, welche Bedeutung der Forschungsbereich der „Gruppe“ bzw „Gruppendynamik“ erlangt hat.
ABBILDUNG 3: Zahl der Publikationen mit dem Stichwort „Gruppe“ im Titel seit 1967.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ANZAHL Projektion aufgrund der Daten von:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
SCHNEIDER ( 1985. S 12 )
SCHNEIDER empfindet die steigende Anzahl von Veröffentlichungen als sehr positiv, räumt aber auch gleichzeitig ein, daß die sozialwissenschaftliche Forschung oft von Voreingenommenheit aufgrund spezifischer Menschenbilder beeinflußt ist.
Um der Notwendigkeit der Unparteilichkeit in der Forschung gerecht zu werden, tritt er auch für einen „Theorienpluralismus“ ein. Was dieser Begriff bedeutet, soll anhand der zahlreichen Definitionen und Begriffsbestimmungen, die im nächsten Kapitel angeführt sind, gezeigt werden.
2.1. DEFINITIONEN zum Begriff „Gruppe“
In SCHÄFERS ( 1994. S 19 ) findet sich folgende Definition der " sozialen Gruppe ":
„Gruppe ist einer der wichtigsten Begriffe der Alltagssprache wie der Wissenschaftssprache zur Bezeichnung bestimmter Merkmale und Formen der Realität. Gruppe ist ein Ordnungs- und Klassifikationsbegriff, der die Gemeinsamkeit einer Reihe von gleichen bzw. ähnlichen Elementen hervorhebt: Menschengruppe ( erst im 18. Jahrhundert) , Baumgruppe, Sternengruppe usw. Wortgeschichtlich ( etymologisch ) ist interessant darauf hinzuweisen, daß Gruppe ursprünglich einen germanischen Wortstamm hat und etwa " Klumpen " bedeutet. Es erfolgt dann eine Entlehnung ins Romanische; italienisch " gruppo ", Französisch " groupe " bedeutet soviel wie " ein Haufen Figuren ", " ein Pack Geld ", Ansammlung, Schar etc.“
Der Gruppen- Begriff wird im deutschen Sprachraum ab 1830 auch zur Bezeichnung sozialer Beziehungen verwendet, jedoch gab es noch keine Eingrenzungen, was Größe sowie Struktur einer Gruppe betraf.
Der Gruppen-Begriff wird im Jahre 1844 neu interpretiert und systematisch ausgearbeitet. STRÜMPELL ( 1844 ) in SCHÄFERS ( 1994. S 20. ) bezieht sich auf das Vorliegen von drei Momenten:
" 1. ein gemeinsames Denken, Wollen oder Thun als solches, an dessen Objekte oder Zwecke alle Teil haben können;
2. der Umstand, daß sich kein Privatdenken oder -Wollen oder -Thun eben als solche, bloß individuelles an die Stelle des allgemeinen setzt;
3. der Umstand, daß im Falle eines von innen oder außen kommenden Angriffs auf einen Koefficienten des allgemeinen Denkens, Wollens oder Thuns, diesen denselben so auffaßt, als ob es ihm selbst widerfahren wäre"
Die Verwendung des Gruppenbegriffs entwickelte sich noch bis zur Jahrhundertwende weiter. Eine in den Sozial- und Humanwissenschaften weitgehend akzeptierte und seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts gültige Definition (= Def. für Kleingruppen ) liest sich in
SCHÄFERS ( 1994. S 20 ) so:
" Eine soziale Gruppe umfaßt eine bestimmte Zahl von Mitgliedern ( Gruppenmitglieder ) , die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels ( Gruppenziel) über längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozeß stehen und ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit ( Wir- Gefühl ) entwickeln. Zur Erreichung des Gruppenziels und zur Stabilisierung der Gruppenidentität ist ein System gemeinsamer Normen und eine Verteilung der Aufgaben über ein gruppenspezifisches Rollendifferential erforderlich. "
Im Vergleich dazu betont GOFFMAN ( 1971. S 13 ), in seiner Definition das soziale Moment und bezieht sogar spezielle Gruppenphänomene ein:
" Eine soziale Gruppe läßt sich als eine spezielle soziale Organisation verstehen. Ihre Elemente sind Individuen, welche diese Organisation als eine distinkte kollektive Einheit , eine soziale Entität sehen, die abgehoben werden kann von den spezifischen Beziehungen, die zwischen den Teilnehmern bestehen; sie nehmen sich selbst als Mitglieder wahr, empfinden Zugehörigkeitsgefühl und eine gewisse Identifikation mit der Organisation und fühlen sich hierdurch gestützt; eine eher feindliche Einstellung gegenüber Außengruppen ist ziemlich konstant vorhanden. Ein symbolhaftes Bild von der Realität der Gruppe und der eigenen Beziehung zu ihr gehören ebenfalls dazu."
Im allgemeinen Wortverständnis ist die Gruppe identisch mit der Mehrzahl von Menschen, oder anders gesagt mit dem "Mensch im Plural". Diese Interpretation ist jedoch zu allgemein gehalten und kann zu Verwirrungen führen. Entscheidend für eine nähere Begriffsbestimmung ist aber das Faktum, daß die Möglichkeit zur unmittelbaren Interaktion besteht, wie bereits HOMANS ( 1960, S.29 ) feststellte: "Unter einer Gruppe verstehen wir eine Reihe von Personen, die in einer Zeitspanne häufig miteinander Umgang haben und deren Anzahl so gering ist, daß jede Person mit allen anderen Personen in Verbindung treten kann, und zwar nicht über andere Menschen, sondern von Angesicht zu Angesicht."
In dieser Definition werden allerdings nötige Gemeinsamkeiten dieser Personen nicht näher bestimmt. Menschen, die vor einem verschlossenem Geschäft auf den Einlaß warten und sich dabei unterhalten, fielen auch unter diese Bestimmung, wie ROSENSTIEL ( 1992. S. 259 ) anhand diese Beispiels erläutert. Daher bietet er "wesentliche Definitionsbestandteile" an:
Mehrzahl von Personen in
- direkter Interaktion über eine
- längere Zeitspanne bei
- Rollendifferenzierung und
- gemeinsamen Normen, verbunden durch
- ein Wir-Gefühl.
ROSENSTIEL (1992. S.261) weist darauf hin, daß weitere Definitionen möglich seien, oder andere Definitionsbestandteile aufgenommen werden könnten; aber "von der Möglichkeit zur unmittelbaren Interaktion über eine längere Zeit hinweg wird man allerdings nicht absehen können, da hier erst ein spezifisch von der Gruppe gefärbtes Erleben und Verhalten beim Gruppenmitglied analysierbar wird."
In Gablers Wirtschaftslexikon ( ARENTZEN/WINTER 1992. S 234 ) wird der Begriff Gruppe durch folgende charakteristische Merkmale festgelegt:
- Bestimmte Anzahl von Mitgliedern, die
- über längere Zeit miteinander ein gemeinsames Ziel verfolgen und
- in einem kontinuierlichen Kommunikations- und
Interaktionszusammenhang gruppenspezifische Rollen,
Werte und Normen ausbilden.
Demnach handelt es sich bei der Gruppe um ein soziales Gebilde wie Familie, Horde oder Sippe, welche den Ursprung menschlichen Gruppenlebens darstellen. Gegenüber früheren Abgrenzungen verstehen die Autoren den Begriff in der gegenwärtigen soziologischen Auffassung als Kleingruppe, d.h. ein Gebilde von drei bis 25 Mitgliedern, wobei die Zweiergruppe eine Sonderstellung einnimmt.
HEINEMANN ( 1990. S 122 ) zum Beispiel schreibt keine genauen Mitgliederzahlen vor, macht aber die Existenz einer „sozialen Gruppe“ von folgenden vier Merkmalen abhängig:
a) Das Vorhandensein eines „Wir-gefühls“: Er sieht darin eine wechselseitige Orientierung, Identifikation, Verantwortungsbereitschaft und psychische Verbundenheit der Gruppenmitglieder untereinander. Einen wichtigen Punkt stellt auch die bewußtseinsmäßige Abgrenzung der Eigengruppe von der Fremdgruppe dar.
b) Die Abgrenzung nach außen : Die Gruppe sollte sich als eigenständiges soziales Gebilde von der sozialen Umwelt und von anderen sozialen Gebilden abgrenzen. Diese Abgrenzung ist für Gruppenmitglieder als auch Außenstehende von gleicher Bedeutung.
c) Gemeinsame Ziele und Probleme : Es wächst die Anerkennung für gemeinsame Verhaltensmotive und so steigt die Solidarität und Kohäsion nach außen und die Kooperation innen.
d) Gemeinsam Normen und Regeln : Positionen , Rollen und Status der Gruppenmitglieder sind vorgegeben. Dadurch wird ein einheitliches Verhaltensschema vorgezeichnet.
In den verschiedenen Definitionen sieht SCHÄFERS einige Parallelen. Diese Parallelen
( Definitions - Elemente ) faßt er in „fünf Definitions-Elementen der sozialen Gruppe“ zusammen:
-- eine jeweils bestimmte Zahl von Mitgliedern, die bei Kleingruppen zwischen drei und 25
Personen liegt;
-- ein gemeinsames Gruppenziel und ein Verhaltensmotiv für die Gruppe insgesamt wie für
jedes einzelne Mitglied;
-- ein "Wir - Gefühl" der Gruppenzugehörigkeit und des Gruppenzusammenhalts
( dies führt zur Unterscheidung der " Eigengruppe " von der "Fremdgruppe");
-- ein System gemeinsamer Normen und Werte als Grundlage der Kommunikations- und
Interaktionsprozesse;
-- ein Geflecht aufeinander bezogener sozialer Rollen ( Rollendifferential ), das auf das
Gruppenziel bezogen ist und unter anderem sowohl die Zielerreichung wie die Lösung von
Konflikten gewährleistet ( SCHÄFERS 1994. S 21 ).
Eine Zusammenfassung ähnlich den „fünf Definitions Elementen der sozialen Gruppe, wurde auch von SCHNEIDER ( 1985. S 18-24 ) veröffentlicht. Er entwickelte sechs „Bestimmungskriterien für die Gruppe“:
- Mitgliederzahl ( Dyade und mehr .. )
- Interaktion ( „face-to-face Kontakt“ )
- Strukturierung ( Rollen- Aufgabenverteilung )
- Gemeinsame Normen ( Vorschriften, Richtlinien )
- Gruppenbewußtsein ( Zusammengehörigkeitsgefühl, Wir-Gefühl )
- Dauer ( längere Kontakte sind für Gruppenprozesse notwendig )
Eine Vielfalt an Möglichkeiten, die Eigenschaften einer Gruppe festzulegen, macht es notwendig die große Zahl an möglichen Klassifikationsmerkmalen einzugrenzen.
In den folgenden Übersichten ( ABBILDUNG 2-4 und TABELLE 1 ) sollen die inhaltlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Definitionen der verschiedenen Autoren graphisch dargestellt und interpretiert werden. Die sechs „Bestimmungskriterien der Gruppe“ nach SCHNEIDER ( 1985. S 18-24 ) werden in dieser graphischen und tabellarischen Aufbereitung zum Vergleich herangezogen.
Zuvor sollen die einzelnen „Bestimmungskriterien“ noch näher erläutert werden:
2.1.1. MITGLIEDERZAHL
HOMANS ( 1960. S 29 ) zeigt, stellvertretend für seine Kollegen, die Bedeutung der minimalen oder maximalen Mitlgiederzahl. Für ihn ist eine Gruppe eine Reihe von Personen:
„deren Anzahl so gering ist, daß jede Person mit allen anderen Personen in Verbindung treten kann und zwar nicht nur mittelbar über andere Menschen, sondern von Angesicht zu Angesicht“
In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, daß eine Person allein noch keine Gruppe darstellt.
SCHÄFERS ( 1994. S 21 ) spricht von „ einer jeweils bestimmten Zahl von Mitgliedern, die bei Kleingruppen zwischen 3-25 Personen liegt“, HOFSTÄTTER ( 1971. S 24 ) vom
„Mensch im Plural“ und ENGELS ( 1981. S 62 ) von einer Gruppe „wenn zwei oder mehr Personen in direkter Interaktion miteinander stehen“.
Die einzelnen Autoren sind sich nicht ganz einig, wo die Minimalgrenze bezüglich der Mitgliederzahl anzusetzen ist. Einige schließen die Dyade ( siehe SCHÄFERS 1994. S 21 ) aus, weil sie bereits beim Ausscheiden nur eines Mitgliedes nicht mehr einer Gruppe entsprechen würde. Diese Argumentation ist ebenfalls nicht unumstritten, da die Triade beim Ausscheiden eines Mitgliedes wieder zur Dyade wird und so ebenfalls abzulehnen ist.
Grob vereinfacht läßt sich diese Argumentation auch auf größere Gruppen anwenden. Einfacher und sinnvoller wäre es, sofern die Merkmale einer Gruppe gegeben sind, die Dyade als Sonderform der Gruppe anzuerkennen ( vgl. SCHNEIDER 1985. S 19 ).
2.1.2. INTERAKTION
Schon 1939 beschreib Kurt LEWIN die Interdependenz als eine Folge der Interaktion von Gruppenmitgliedern ( vgl. SCHNEIDER 1985. S 21 ).
HOFSTÄTTER ( 1966. S 21 ) beschreibt treffend dazu:
„Als Gruppe bezeichnet man eine Anzahl von Organismen, deren Verhalten einer wechselseitigen Steuerung unterliegt. Was ein Mitglied einer Gruppe tut, beeinflusst das Tun aller oder einzelner anderer und ist seinerseits auf Aktionen dieser anderen abgestimmt.“
Interaktion innerhalb einer Gruppe kann verschieden intensive Formen annehmen. Der Empfang von oder die Verteilung von Informationen an Unbekannte, ohne persönliche Anwesenheit, zählen zur minimalen Stufe. Die bewußte Kommunikation mit einer anderen Person, mit oder ohne Reaktion, stellt bereits die gesteigerte Stufe der Interaktion dar. Diese Art der Kommunikation kann verbal oder non-verbal erfolgen.
Eine weiter gesteigerte Form der Interaktion läßt sich nur mehr durch körperlichen Kontakt erreichen ( vgl. SCHNEIDER 1985. S 20-21 ).
2.1.3. STRUKTURIERUNG
Dieser Begriff kann auch als Rollendifferenzierung oder Rollendifferential bezeichnet werden. SCHÄFERS ( 1980. S 21 ) bezeichnet das Rollendifferential als „ein Geflecht aufeinander bezogener sozialer Rollen.“ Beim Aufbau einer Gruppe kann zwischen der funktionellen und der zwischenmenschlichen Struktur unterschieden werden. Bei dieser Unterscheidung kommt es zu einer Beurteilung der Aufgaben eines Mitgliedes innerhalb der Gruppe und der Sympathie bzw. Akzeptanz, die es bei den anderen Mitgliedern genießt. Der „formelle“ Führer einer Gruppe bekleidet zwar eine hohe Aufgabe, muß aber deshalb innerhalb der Gruppe nicht einen hohen Sympathiewert innehaben. Zum Beispiel übernimmt jemand die Führerrolle, mit dem Einverständnis der restlichen Gruppenmitglieder, entweder wegen seiner Tüchtigkeit oder seiner Beliebtheit.
Die Rangordnung, die durch das Rollendifferential entstehen kann, ist aber nicht gefestigt und unterliegt so permanenten Schwankungen. Die Anforderungen an die Gruppe verändern sich ständig und so verändern sich auch die Aufgaben und damit verbundenes Prestige der Gruppenmitglieder ständig.
2.1.4. GEMEINSAME NORMEN
Ein praktisches Beispiel soll hier für Klarheit sorgen. Ein Fußballspieler hält sich an eine Norm, wenn er darauf verzichtet einen Gegenspieler am Trikot zurückzuhalten. Die Norm besagt ein Verbot beziehungsweise verlangt eine Bestrafung bei Nichteinhaltung. Die Bestrafung wäre in diesem Fall der Foulpfiff des Schiedsrichters. Der Spieler kann sich so am erwarteten Verhalten des Schiedsrichters orientieren und hält sich deshalb an die Norm, wie sich seine Gegenspieler ebenfalls daran zu halten haben.
HEINEMANN ( 1990. S 51 ) beschreibt die Bedeutung von Normen so:
„Soziale Normen stellen grundsätzlich zwei Anforderungen an den einzelnen: Anpassung an Verhaltenserwartungen und individuelle Interpretation, also Gestaltung und Ausfüllung im jeweiligen situativen Kontext.“
Kommt es zu Abweichungen von der Norm, so werden Sanktionen ( Prestigeverlust, Privilegienabbau ) verhängt; im Extremfall ( Betrug, Verrat ) kann es auch zum Ausschluß aus der Gruppe kommen.
Speziell im Sport haben Normen die Aufgabe das Verhalten der Sportler während der körperlichen Tätigkeit zu regeln. HEINEMANN ( 1990. S 53 ) kennzeichnet drei Merkmale der „ institutionalisierten Struktur des Sports“:
„1. die Tatsache, daß soziale Regeln im Sport häufig den Charakter von Ritualen haben, 2. die Tatsache, daß Sport wertlos im Ergebnis, aber wertvoll in der Art der Erstellung der Ergebnisse ist, 3. die Tatsache, daß die Offenheit des Ausgangs gesichert wird.“
2.1.5. GRUPPENBEWUSSTSEIN ( „Wir-Gefühl“)
Der Indikator eines vorhandenen Gruppenbewußtseins wird als das „Wir-Gefühl bezeichnet.
Das „Wir-Gefühl“ gilt als Anzeige für den Grad der Kohäsion in einer Gruppe. Die Wertschätzung der Gruppenmitgliedschaft sowie die Bereitschaft sich zum Wohle der Gruppe und deren Ziele einzusetzen, machen die Gruppenkohäsion aus. SYER ( 1991. S 24 ) bezeichnet die Gruppenkohäsion als „die Summe aller Kräfte, die die Mitglieder einer Gruppe zusammenhält“. Er unterteilt diese Kräfte in positive und negative Faktoren.
Die „Aufgabenmotivation“, die sich im Streben nach Erfolg äußert und die Befriedigung sozialer Bedürfnisse ( Erlangen von Beliebtheit und Sympathie ) zählen zu den positiven Faktoren. Als negativen Faktor führt er die Schwierigkeit an, sich von einer Mannschaft zu lösen. Trägheit, Furcht vor der Enttäuschung der Kameraden und Fans sowie ein bindender Vertrag können zu diesen Schwierigkeiten führen.
Kohäsion bedeutet für SYER ( 1991. S 25 ) den inneren Zusammenhalt einer Mannschaft und so wird vermutet, „daß diese Art von Zusammenhalt, die im wesentlichen darauf beruhte, daß die einzelnen Mitglieder sich mochten, automatisch die Kommunikation und Koordination des Teams verbesserte und damit natürlich seine Leistung.“
Um die Kohäsion objektiv zu beurteilen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder durch erarbeitete Beobachtungsschemata oder mittels Fragebogen; wie zum Beispiel der Gruppenklimafragebogen ( GCQ-S ), welcher von TSCHUSCHKE/HESS/MAC.KENZIE
( 1991. S 340-360 ) entwickelt wurde. Darin werden Fragen wie „Mit welchen Gruppenmitgliedern sind sie gut befreundet ?" bzw. „Welche Gruppenmitglieder machen oft Vorschläge, die gut zu gebrauchen sind ?" gestellt.
Die positiven und negativen Faktoren nach SYER können als gutes Beispiel zur Unterscheidung von Kohäsion und Dependenz herangezogen werden. Dependenz bedeutet die Schwierigkeit sich von einer Mannschaft zu lösen, da mit dem Austritt die Vorteile der Gruppe ( Geld, Prestige, Anerkennung ) verloren gehen. Kohäsion hingegen besteht dann, wenn der Sportler gern in der Gruppe bleibt, weil er sich wohl fühlt und mit dem Team seine Erwartungen und Ziele erreichen kann ( vgl. MUELLER /THOMAS 1976. S 352 ).
2.1.6. DAUER der Interaktion
Die Zeitdauer in der eine Anzahl von Personen miteinander kommunizieren, ist sehr variabel.
Sie kann sich von einem kurzen Moment bis über Jahrzehnte erstrecken. In der Literatur finden sich keine genauen Angaben über eine Minimaldauer.
So schreibt HOMANS ( 1960. S 29 ), der als Beispiel für die sehr allgemeinen Formulierungen stehen soll, von „einer bestimmten Zeitspanne“.
SCHNEIDER ( 1985. S 25 ) führt zwar die Dauer der Interaktion als Gruppenmerkmal an, schränkt aber selbst ein :
„ Es ist daher überflüssig, die Zeitdimension als weiteres Kriterium aufzunehmen. Sie wird jedoch eine Rolle spielen, sobald der Allgemeinbegriff Gruppe in verschiedene Arten von Gruppen differenziert werden soll.“
2.1.7 ALLGEMEINE BETRACHTUNG der Bestimmungskriterien
Die Anführung dieser ausgewählten Merkmale kann keinen Anspruch auf Vollständikeit haben. Eine feste Grenzlinie zu definieren, bis zu der nicht von einer Gruppe gesprochen werden kann und ab der die Bezeichnung Gruppe sehr wohl gerechtfertigt ist, ist nicht möglich. HARE
( 1963. S 27 ) zeigt sich skeptisch indem er schreibt:
„There is no definite cutting point in the continuum between a collection of individuals, such as one might find waiting for abus on a corner, and a fully organized „group“.“
2.2. GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN und deren Interpretation
ABBILDUNG 4 : Übersicht von „Bestimmungskriterien für Gruppen“:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
GOFFMAN STRÜMPELL
HEINEMANN SCHNEIDER
HOMANS SCHÄFERS
Nur etwa die Hälfte der Autoren nahm Rücksicht auf die Mitgliederzahl in einer Gruppe. Hier zeigt sich, wie komplex eine exakte Definition einer Gruppe gestaltet sein muß.
Die meisten Autoren knüpfen ihre Bedingungen für die Existenz einer Gruppe an Merkmale, wie Interaktion, Kommunikation, Rollenstruktur und vergessen dabei anscheinend auf die Limitierungen, die eine zu hohe (¥) oder zu niedrige Mitgliederzahl (1) verursachen würden.
Die Definition von STRÜMPELL scheint für eine Erwähnung der Interaktion, bezogen auf das Veröffentlichungsdatum, etwas zu weit zurückzuliegen. Der Großteil der anderen Autoren hält, die Interaktion für ein wichtiges Gruppenmerkmal.
ABBILDUNG 5 :Übersicht von „Bestimmungskriterien für Gruppen“:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
GOFFMAN STRÜMPELL
HEINEMANN SCHNEIDER
HOMANS SCHÄFERS
Auch hier zeigt sich, daß alle Definitionen die ein jüngeres Datum aufweisen, das Rollendifferential als ein sehr wichtiges Kriterium ansehen. Die Strukturierung unterliegt natürlich auch Schwankungen, die zwischen einer minimalen Gliederung und einer sehr differenzierten Ausfächerung liegen können.
Die Entwicklung von normativen Erwartungen innerhalb von Gruppen ist beinahe unerläßlich. Die gemeinsamen Verhaltensrichtlinien sind Orientierungspunkte für ein gemeinsames Zusammensein. Daher sind auch „gemeinsame Normen“ in fast jeder Definition enthalten.
ABBILDUNG 6 : Übersicht von „Bestimmungskriterien für Gruppen“:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
GOFFMAN
STRÜMPELL
HEINEMANN SCHNEIDER
HOMANS SCHÄFERS
Der Großteil der Autoren ist sich darüber einig, daß für die Entwicklung von Gruppenprozessen ein längerer Zeitraum benötigt wird. Um die Gruppenmitglieder kennenzulernen, um gemeinsame Normen zu entwickeln und um eine Rollenstruktur innerhalb der Gruppe zu entwickeln, muß die Interaktion beziehungsweise der gemeinschaftliche Kontakt der Mitglieder über einen längeren Zeitraum anhalten.
Auffallend ist auch, daß alle angeführten Autoren, bis auf HOMANS ( 1960 ), die Entstehung eines „Wir - Gefühls“ als Hauptmerkmal ansehen. Dieser Punkt kann jedoch angezweifelt werden, wenn man bedenkt, wie oft es gerade im Sportbereich dazu kommt, daß Gruppenbildungen oft auf reiner Profitgier ( Sportliche Entwicklung, Geld oder Prestige ) oder Abhängigkeit ( Sponsor, Trainingsmöglichkeiten, Kostenteilung ) basieren.
Nach den übersichtlichen graphischen Darstellungen soll die abschließende TABELLE 1 noch einmal alle Inhalte der Definitionen auf einen Blick geben:
TABELLE 1: „BESTIMMUNGSKRITERIEN ( GESAMTANSICHT )
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Anführung der Autoren und die Auswahl der Kriterien erfolgte rein nach dem Häufigkeitsprinzip. Daher kann weder von der Autorenliste noch vom Kriterienkatalog her gesehen ein Anspruch auf Vollständigkeit gegeben sein. Es ist nur möglich den Begriff der Gruppe mit ausreichenden, aber nicht zu umfangreichen Mitteln einzukreisen und grob abzugrenzen.
SCHNEIDER ( 1985. S 27 ) beschreibt diese Problematik treffend:
„Wenn man an Hand dieser Listen eine soziale Einheit danach überprüft, ob sie als Gruppe gelten kann, wird man selten zu einem negativen Ergebnis gelangen.“
2.3. ABGRENZUNGEN zu anderen sozialen Phänomenen
Aus einer Übersicht von HOFSTÄTTER ( 1986. S 24 ) läßt sich ersehen, daß es neben der Gruppe noch einige andere Formen von „menschlichem Miteinander“ gibt. Er geht bei seiner Übersicht von einem „Mensch im Plural“ aus:
ABBILDUNG 7 : „Der Mensch im Plural“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
MASSE GRUPPE VERBAND
( HOFSTÄTTER 1986, S. 24. )
Die Familie muß hier gesondert behandelt werden, da sie Grundvoraussetzung für die Entstehung sozialer Gebilde ist.
„Der Familie kommt dabei insofern eine Sonderstellung zu, als sie die Keimzelle jeder sozialen Existenz ist“ ( EBERSPÄRCHER 1982. S 131 ).
Eine Klasse stellt eine Anzahl von Personen dar, die mindestens eine Gemeinsamkeit aufweisen. So kann zum Beispiel zwischen einem Arbeitnehmerverhältnis als Angestellter oder Arbeiter klassifiziert werden. Auch Gleichaltrige oder Brillenträger können in Klassen zusammengefaßt werden.
Eine Klasse kann sich auch zu einem Verband weiterentwickeln. Der österreichische Tennisverband ( ÖTV ) zum Beispiel stellt die Interessensvertretung aller österreichischen Tennisspieler dar. Um sich von einer Klasse zu einem Verband zu entwickeln, bedarf es also der Zusammenschließung und Organisation seiner Klassenmitglieder. Die Vertretung, die Probleme zu lösen versucht und gemeinsame Interessen nach außen hin zu wahren hat, wird allgemein als Verband bezeichnet ( vgl. EBERSPÄRCHER 1982. S 132 ).
[...]
- Arbeit zitieren
- Dr. Jörg Habenicht (Autor:in), 1997, Die Gruppe als Lern- und Erfahrungssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119774