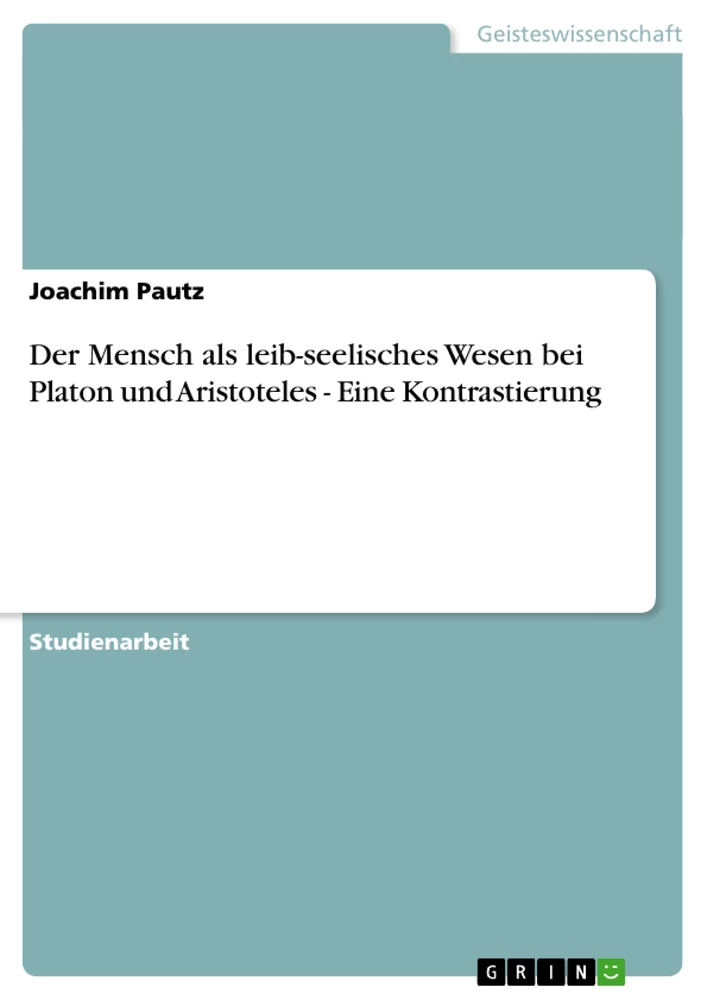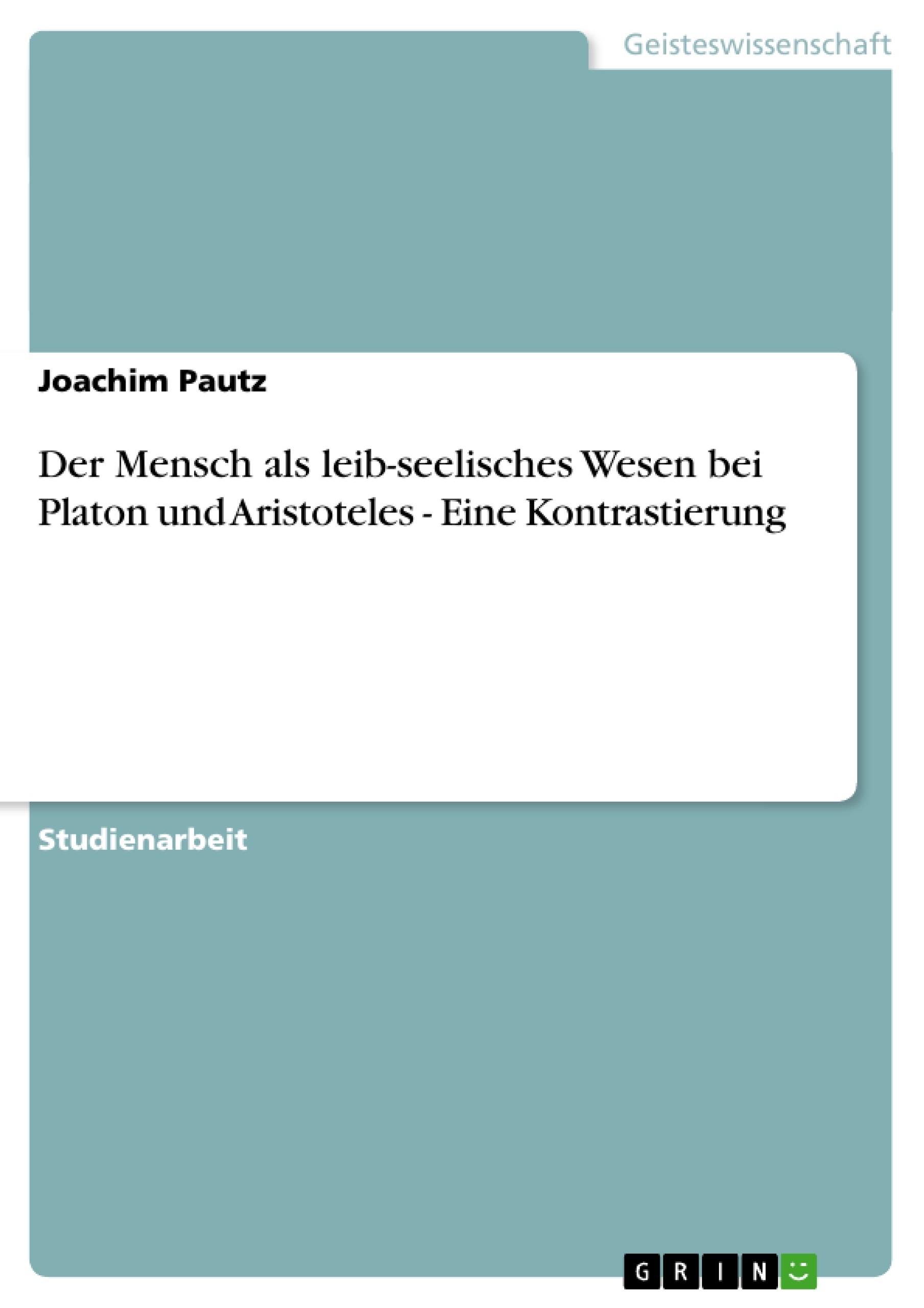In der Diskussion um Psyche, Psychologie, Selbstbewusstsein und Individualität, allesamt Worte, die unsere Zeit gerne gebraucht, taucht der Begriff Seele, obwohl die direkte Übersetzung des griechischen Wortes psyche, in wissenschaftlichen Zusammenhängen kaum auf. Die Vorstellung einer selbständigen Geistseele, die mit dem lebendigen Körper eine wie auch immer geartete Verbindung eingeht, erscheint der Wissenschaft kaum mehr erörterungswürdig. Vielmehr scheinen Vorstellungen von Seele restlos in den Bereich der persönlichen Religiosität zu gehören. Platon und Aristoteles erheben jedoch den Anspruch, dem Problem der Seele mit den Mitteln der Wissenschaft näher zu kommen. Beide entwerfen unterschiedliche Modelle und Erklärungen der Seele. In Platons Psychologie begegnet uns ein strenger Dualismus von Seele und Leib, den er in mythischen Gleichnissen veranschaulicht. Die Herangehensweise des Aristoteles unterscheidet sich grundlegend. Als Biologe und Naturwissenschaftler lehnt er einen Leib-Seele Dualismus ab und entwirft als Gegenmodell den Hylemorphismus.
In dieser Arbeit sollen beide Ansätze genauer betrachtet werden. Die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele steht dabei im Vordergrund. In einer Kontrastierung sollen die Unterschiede und Eigenheiten der beiden Psychologien besonders herausgearbeitet werden. Zwei Fragestellungen werden hierbei besonders berücksichtigt: Was ist der Mensch bei Platon, was bei Aristoteles und wie stehen die Begriffe Mensch und Seele in Beziehung? Welche Bedeutung hat das logistikon bei Platon und welche der nous bei Aristoteles für die Identität des Menschen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Argumentation Platons im Dialog „Alkibiades“
- Zusammenfassung der Kernaussagen
- Der Begriff der Seele bei Aristoteles in Texten des Werkes „de anima“
- Die Beziehung zwischen den Begriffen Mensch und Seele bei Platon und Aristoteles
- Die Bedeutung des nous für die menschliche Identität bei Aristoteles im Vergleich zum logistikon bei Platon
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit kontrastiert die Konzepte des Menschen als leib-seelisches Wesen bei Platon und Aristoteles. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer psychologischen Modelle herauszuarbeiten, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Leib und Seele. Die Arbeit konzentriert sich auf zwei zentrale Fragestellungen: die Beziehung zwischen Mensch und Seele in beiden Philosophien und die Bedeutung des logistikon bei Platon und des nous bei Aristoteles für die menschliche Identität.
- Platons Dualismus von Leib und Seele
- Aristoteles' Hylemorphismus als Gegenmodell
- Die Rolle von Sprache und Werkzeuggebrauch in Platons Argumentation
- Der Vergleich des logistikon (Platon) und des nous (Aristoteles)
- Die Beziehung zwischen Mensch und Seele bei Platon und Aristoteles
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Leib und Seele bei Platon und Aristoteles. Sie betont den Unterschied zwischen der heutigen wissenschaftlichen Betrachtungsweise und den philosophischen Ansätzen der Antike. Die Arbeit kündigt eine Kontrastierung der beiden Philosophen an und benennt die beiden zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf bearbeitet werden sollen: die Definition des Menschen bei Platon und Aristoteles sowie die Bedeutung des logistikon und des nous für die menschliche Identität.
Analyse der Argumentation Platons im Dialog „Alkibiades“: Dieser Abschnitt analysiert Platons Argumentation im Dialog „Alkibiades I“. Der Fokus liegt auf Sokrates' dialektischer Methode, die durch Fragen und Antworten zu einer Definition des Selbst führt. Die Analyse zeigt, wie Platon durch den Vergleich von Werkzeug und Benutzer (z.B. Schuster und Werkzeug, Leierspieler und Leier) eine Trennung zwischen dem Subjekt (dem benutzenden Selbst) und dem Objekt (dem benutzten Leib) etabliert. Dieser Vergleich legt den Grundstein für Platons Dualismus von Leib und Seele, indem der Leib als „Gebrauchtes“ und die Seele als „Benutzendes“ dargestellt wird. Die expositorische Frage Sokrates nach dem Selbst steht am Anfang des Dialogs und strukturiert den argumentativen Verlauf.
Der Begriff der Seele bei Aristoteles in Texten des Werkes „de anima“: Dieser Kapitelteil befasst sich mit Aristoteles' Verständnis von Seele. Im Gegensatz zu Platons Dualismus präsentiert Aristoteles den Hylemorphismus als Gegenmodell. Der Abschnitt erörtert Aristoteles' naturwissenschaftliche Perspektive und seine Ablehnung eines strikten Leib-Seele-Dualismus. Die Analyse konzentriert sich auf die Definition der Seele innerhalb des hylemorphistischen Kontextes, welcher den Zusammenhang zwischen Materie und Form hervorhebt. Es wird genauer auf die verschiedenen Aspekte der Seele bei Aristoteles eingegangen, unter Berücksichtigung seiner biologischen und naturwissenschaftlichen Ansätze.
Die Beziehung zwischen den Begriffen Mensch und Seele bei Platon und Aristoteles: Dieses Kapitel vergleicht die Konzepte von Mensch und Seele bei Platon und Aristoteles. Es wird die unterschiedliche Beziehung zwischen beiden Begriffen in beiden Philosophien analysiert, wobei der Fokus auf den Kontrast zwischen Platons strengem Dualismus und Aristoteles' hylemorphistischer Sichtweise liegt. Konkret wird der Unterschied in der Definition des Menschen herausgearbeitet, mit besonderer Berücksichtigung der Frage, ob und wie der Mensch definiert wird durch die Seele. Es wird detailliert auf die jeweiligen Argumentationslinien eingegangen, um ein genaues Bild der Unterschiede zwischen den beiden Denkweisen zu vermitteln.
Die Bedeutung des nous für die menschliche Identität bei Aristoteles im Vergleich zum logistikon bei Platon: Dieser Abschnitt vergleicht die Rolle des nous bei Aristoteles und des logistikon bei Platon für die menschliche Identität. Er analysiert die jeweiligen Funktionen dieser Konzepte und ihre Bedeutung für das Verständnis des menschlichen Selbst. Der Vergleich soll die Unterschiede in der philosophischen Begründung der menschlichen Identität bei Platon und Aristoteles aufzeigen und die spezifischen Bedeutungen der verwendeten Begriffe beleuchten. Es wird untersucht, inwieweit diese Konzepte zur Definition der individuellen menschlichen Identität beitragen und wie sie sich in den jeweiligen Gesamtphilosophien einordnen.
Schlüsselwörter
Platon, Aristoteles, Leib-Seele-Problem, Dualismus, Hylemorphismus, „Alkibiades“, „de anima“, logistikon, nous, menschliche Identität, griechische Philosophie, Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Platon und Aristoteles – Leib und Seele
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und kontrastiert die Konzepte des Menschen als leib-seelisches Wesen bei Platon und Aristoteles. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten ihrer psychologischen Modelle, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Leib und Seele.
Welche zentralen Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei zentrale Fragestellungen: 1) Die Beziehung zwischen Mensch und Seele in beiden Philosophien und 2) Die Bedeutung des logistikon bei Platon und des nous bei Aristoteles für die menschliche Identität.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Platons Dialog „Alkibiades I“ und Aristoteles' Werk „de anima“. Die Analyse konzentriert sich auf die Argumentationslinien beider Philosophen bezüglich Leib und Seele.
Wie wird Platons Position dargestellt?
Platons Position wird als ein strenger Dualismus dargestellt, der durch die Analyse des „Alkibiades I“ erläutert wird. Der Vergleich von Werkzeug und Benutzer (z.B. Schuster und Werkzeug) verdeutlicht die Trennung zwischen dem benutzenden Selbst (Seele) und dem benutzten Leib. Das „logistikon“ spielt eine wichtige Rolle in Platons Verständnis der menschlichen Identität.
Wie wird Aristoteles' Position dargestellt?
Im Gegensatz zu Platon vertritt Aristoteles einen Hylemorphismus. Dieser Ansatz lehnt einen strikten Leib-Seele-Dualismus ab und betont den Zusammenhang zwischen Materie und Form. Die Seele wird hier nicht als getrennt vom Körper, sondern als dessen Form verstanden. Der „nous“ ist zentral für Aristoteles' Verständnis der menschlichen Identität.
Wie werden Platon und Aristoteles verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte von Mensch und Seele bei Platon und Aristoteles, wobei der Kontrast zwischen Platons Dualismus und Aristoteles' Hylemorphismus im Mittelpunkt steht. Es wird analysiert, wie beide Philosophen den Menschen definieren und welche Rolle die Seele bzw. das logistikon (Platon) und der nous (Aristoteles) für die menschliche Identität spielen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Platon, Aristoteles, Leib-Seele-Problem, Dualismus, Hylemorphismus, „Alkibiades“, „de anima“, logistikon, nous, menschliche Identität, griechische Philosophie, Anthropologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Analyse von Platons „Alkibiades I“, eine Auseinandersetzung mit Aristoteles' „de anima“, einen Vergleich der Konzepte von Mensch und Seele bei beiden Philosophen, einen Vergleich von logistikon und nous, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der psychologischen Modelle von Platon und Aristoteles herauszuarbeiten und ein tieferes Verständnis für ihr jeweiliges Verständnis von Mensch und Seele zu vermitteln.
- Quote paper
- Joachim Pautz (Author), 2002, Der Mensch als leib-seelisches Wesen bei Platon und Aristoteles - Eine Kontrastierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11975