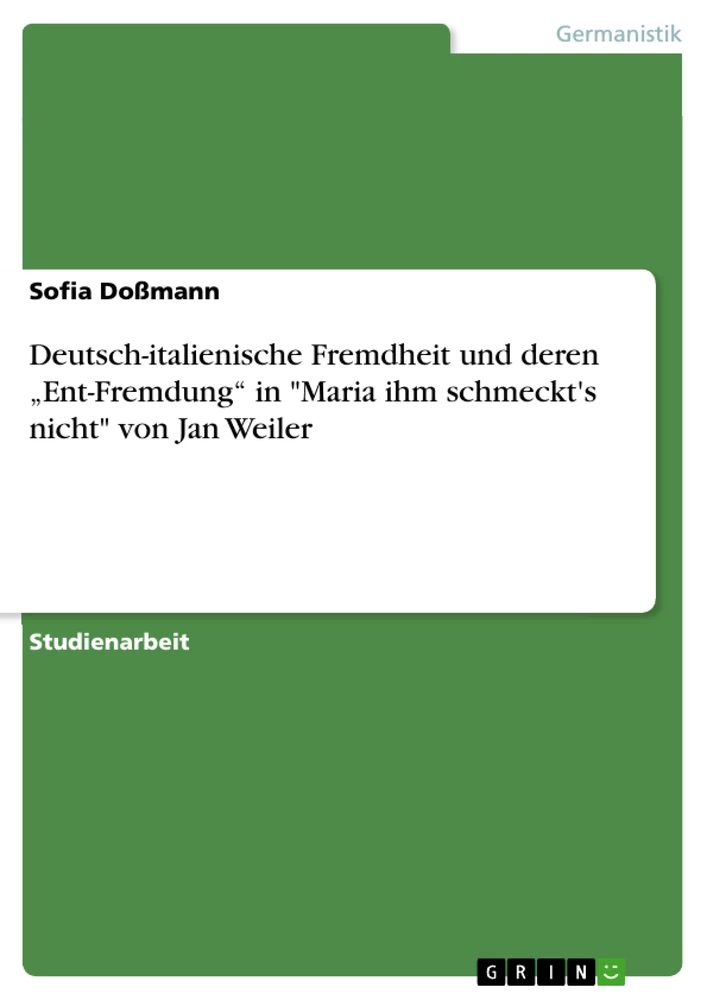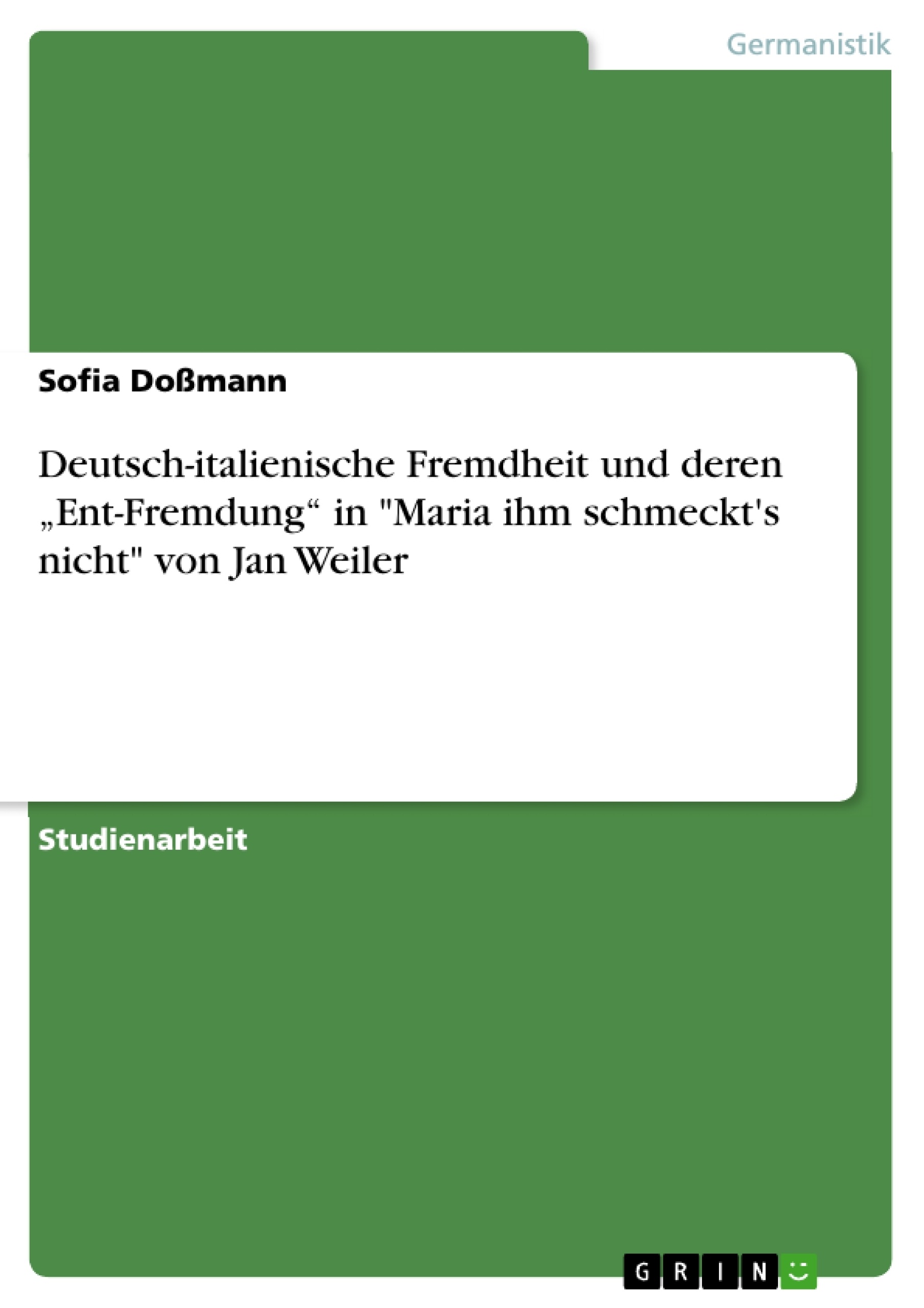Jan Weilers Debütroman „Maria ihm schmeckt’s nicht“ beinhaltet „Geschichten von meiner italienischen Sippe“ (so der Untertitel). „Die meisten Geschichten davon sind wahr, andere sind erfunden, wieder andere lassen sich beim besten Willen nicht nachprüfen.“ (S.276), meint Weiler am Schluss in seinen Danksagungen. Es handelt sich also um einen „autobiofiktionalen“ Roman, der die Begegnung zweier Männer schildert, die in kürzester Zeit von Fremden zu engen Vertrauten werden. Das Besondere daran ist: der eine ist Deutscher und der andere Italiener. Florian, der Deutsche, ist Ich-Erzähler und erlebt die Begegnung mit Antonio, dem Vater seiner Verlobten, aus einer fast durchgängigen Gedankenrede heraus. Dabei bekommt der Leser eine besonders eindrückliche Vorstellung seiner Empfindungen diese Begegnung betreffend, seiner Erwartungen und seiner Reaktionen. Das ist deshalb besonders interessant, weil der Austausch der beiden Männer durch ihre kulturelle Verschiedenheit und ihre charakterliche Gegensätzlichkeit eine starke Dynamik erhält. In der Betrachtung der Fremdbegegnung des deutschen Protagonisten Florian in dem Roman „Maria ihm schmeckt’s nicht“ mit der italienischen Verwandtschaft seiner Verlobten Sara können bestimmte Charakteristika für dessen eigene Kultur und sein Verhältnis zu ihr sowie seine Auffassung von der fremden Kultur abgelesen werden. Wenn Weilers Roman dann beginnt mit „Ein Fremder steht vor der Tür. Das bin ich.“ (S.7), dann lässt das auf eine nicht unproblematische Beziehung zu sich selbst schließen, die unweigerlich die Entwicklung der kurz bevorstehenden Begegnung mit seinem italienischen Schwiegervater in Spe beeinflussen muss.Bei der ersten Lektüre des Romans „Maria ihm schmeckt’s nicht“ hatte ich bereits den Eindruck, dass das Urteil des Protagonisten über die italienische Kultur und auch Antonio gegenüber tendenziell abwertend
gefärbt war, auch wenn er mehrfach seine Sympathie für diese beteuerte. Prekär ist diese Beobachtung gerade auch wegen des zumindest teilweisen autobiographischen Anspruchs, den der Roman hat, weshalb davon auszugehen ist, dass die Perspektive Florians die Perspektive Weilers repräsentiert. In dieser Arbeit sollen also die Aspekte untersucht werden, die bei der Begegnung zweier verschiedener Kulturen relevant werden, besonders derer, die für die Kulturbegegnung förderlich bzw. hinderlich sind.Der Fokus liegt dabei auf der Perspektive Florians, da der Leser durch deren Färbung hindurch die Fremdbegegnung erlebt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Erleben des Fremden
- 2 Die Begegnung mit dem Fremden
- 2.1 Florian trifft Antonio: der anankastische Charakter
- 2.2 Antonio trifft Florian: Der histrionische Charakter
- 3 Annäherung an das Fremde
- 3.1 Maßnahmen zur Fremdheitsreduzierung
- 3.2 Maßnahmen zum Fremdheitsabbau
- 3.3 Maßnahmen zur Fremdheitsüberwindung
- 4 Schlussbetrachtung
- 4.1 Das Stereotyp in der literarischen Kulturbegegnung
- 4.2 Subjektiv konnotierte Sprache
- 4.3 Negative Effekte
- 4.4 Positive Effekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der deutsch-italienischen Fremdheit und deren Überwindung im Roman „Maria ihm schmeckt's nicht“ von Jan Weiler. Der Fokus liegt auf der Analyse der Begegnung zwischen dem deutschen Protagonisten Florian und seinem italienischen Schwiegervater in spe, Antonio. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten interkultureller Begegnung, die Rolle von Stereotypen und die Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehung.
- Das Erleben von Fremdheit und die damit verbundenen Emotionen und Vorurteile.
- Die Rolle von kulturellen Unterschieden und individuellen Charaktereigenschaften in der Begegnung.
- Strategien zur Überwindung von Fremdheit und der Aufbau interkultureller Beziehungen.
- Die Bedeutung der Selbstreflexion im interkulturellen Kontext.
- Die Darstellung von Stereotypen in der Literatur und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Fremden.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Das Erleben des Fremden: Jan Weilers Roman „Maria ihm schmeckt's nicht“ schildert die Begegnung zwischen dem deutschen Florian und seinem italienischen zukünftigen Schwiegervater Antonio. Der Roman, der autobiografische Elemente enthält, zeigt die anfängliche Fremdheit und die damit verbundenen Unsicherheiten und Vorurteile Florians. Der Text analysiert Florians anfängliche negative Wahrnehmung der italienischen Kultur, verbunden mit einem stereotypisierten Bild, und setzt dies in Beziehung zu allgemeineren Studien über fremdenfeindliche Einstellungen in Europa. Die Einführung beleuchtet die wachsende Bedeutung interkultureller Kompetenz im Kontext von Globalisierung und Migration und stellt die zentrale Frage nach den Faktoren, die interkulturelle Begegnungen fördern oder behindern.
2 Die Begegnung mit dem Fremden: Dieses Kapitel analysiert die erste Begegnung zwischen Florian und Antonio. Es werden die unterschiedlichen Charaktere der beiden Männer beleuchtet, wobei Florian als anankastisch und Antonio als histrionisch beschrieben wird. Die Analyse fokussiert auf die initiale Fremdheit und die jeweiligen Erwartungen und Reaktionen beider Protagonisten. Die symbolische Handlung des „Um-die-Hand-Bitten“ wird als bedeutender Wendepunkt dargestellt, der eine tiefgreifende Veränderung der Beziehung zwischen den beiden Männern einleitet, von völliger Fremdheit hin zu einer angestrebten Verwandtschaftsbeziehung. Der Text zieht Parallelen zu Simmels Theorie des Fremden, um die komplexe Dynamik dieser Begegnung zu verdeutlichen.
3 Annäherung an das Fremde: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Maßnahmen, die zur Reduzierung und zum Abbau von Fremdheit zwischen Florian und Antonio beitragen. Es werden Strategien wie Kontaktaufnahme, Integrationsansätze und die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur beleuchtet. Der Konflikt zwischen beiden Männern wird als ein wichtiger Aspekt der Annäherung betrachtet, der die Notwendigkeit einer tieferen Auseinandersetzung mit den kulturellen Unterschieden und den jeweiligen Lebensphilosophien hervorhebt. Die Kapitel analysiert den Prozess der Fremdheitsüberwindung und die Entwicklung der Beziehung zwischen Florian und Antonio anhand der Analyse der jeweiligen Lebensgeschichten und -wirklichkeiten der Protagonisten.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Fremdheit, deutsch-italienische Kulturbegegnung, Stereotype, Charakteranalyse (anankastisch, histrionisch), Identitätsentwicklung, Globalisierung, Migration, Selbstreflexion, interkulturelle Kommunikation, Jan Weiler, „Maria ihm schmeckt’s nicht“.
Häufig gestellte Fragen zu "Maria ihm schmeckt's nicht": Eine Analyse der deutsch-italienischen Kulturbegegnung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von deutsch-italienischer Fremdheit und deren Überwindung im Roman "Maria ihm schmeckt's nicht" von Jan Weiler. Der Fokus liegt auf der Begegnung zwischen dem deutschen Protagonisten Florian und seinem italienischen Schwiegervater in spe, Antonio, und untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten interkultureller Begegnungen.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das Erleben von Fremdheit und die damit verbundenen Emotionen und Vorurteile, die Rolle kultureller Unterschiede und individueller Charaktereigenschaften, Strategien zur Überwindung von Fremdheit und den Aufbau interkultureller Beziehungen, die Bedeutung von Selbstreflexion im interkulturellen Kontext sowie die Darstellung von Stereotypen in der Literatur und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Fremden.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in vier Kapitel: "Das Erleben des Fremden", "Die Begegnung mit dem Fremden" (inklusive der Charakteranalysen Florians als anankastisch und Antonios als histrionisch), "Annäherung an das Fremde" (mit Maßnahmen zur Fremdheitsreduzierung, -abbau und -überwindung) und "Schlussbetrachtung" (mit Fokus auf Stereotype, Sprache und den positiven/negativen Effekten der Begegnung).
Wie werden die Charaktere Florian und Antonio dargestellt?
Florian wird als anankastischer Charakter beschrieben, während Antonio als histrionisch dargestellt wird. Die Analyse untersucht, wie diese unterschiedlichen Charaktereigenschaften die interkulturelle Begegnung beeinflussen und die anfängliche Fremdheit prägen.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Analyse?
Die Rolle von Stereotypen in der literarischen Kulturbegegnung wird ausführlich untersucht. Die Arbeit analysiert, wie stereotype Vorstellungen die Wahrnehmung des Fremden beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Florian und Antonio hat.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die positiven und negativen Effekte der deutsch-italienischen Kulturbegegnung im Roman. Sie betont die Bedeutung von Selbstreflexion und interkultureller Kompetenz für gelingende interkulturelle Beziehungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kompetenz, Fremdheit, deutsch-italienische Kulturbegegnung, Stereotype, Charakteranalyse (anankastisch, histrionisch), Identitätsentwicklung, Globalisierung, Migration, Selbstreflexion, interkulturelle Kommunikation, Jan Weiler, "Maria ihm schmeckt’s nicht".
- Quote paper
- Sofia Doßmann (Author), 2008, Deutsch-italienische Fremdheit und deren „Ent-Fremdung“ in "Maria ihm schmeckt's nicht" von Jan Weiler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119717