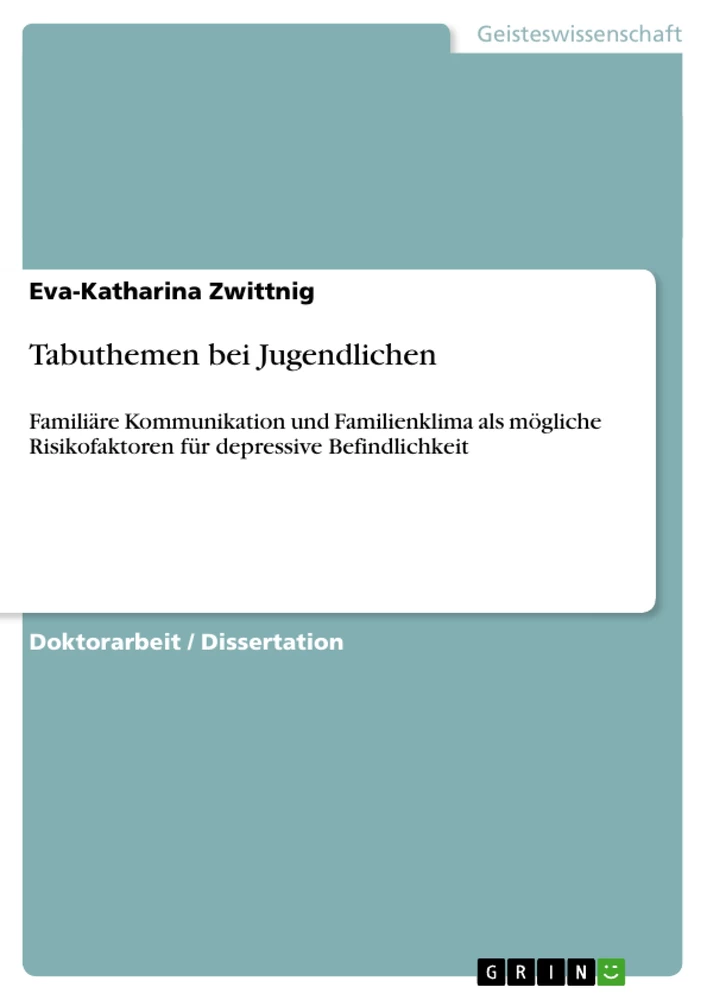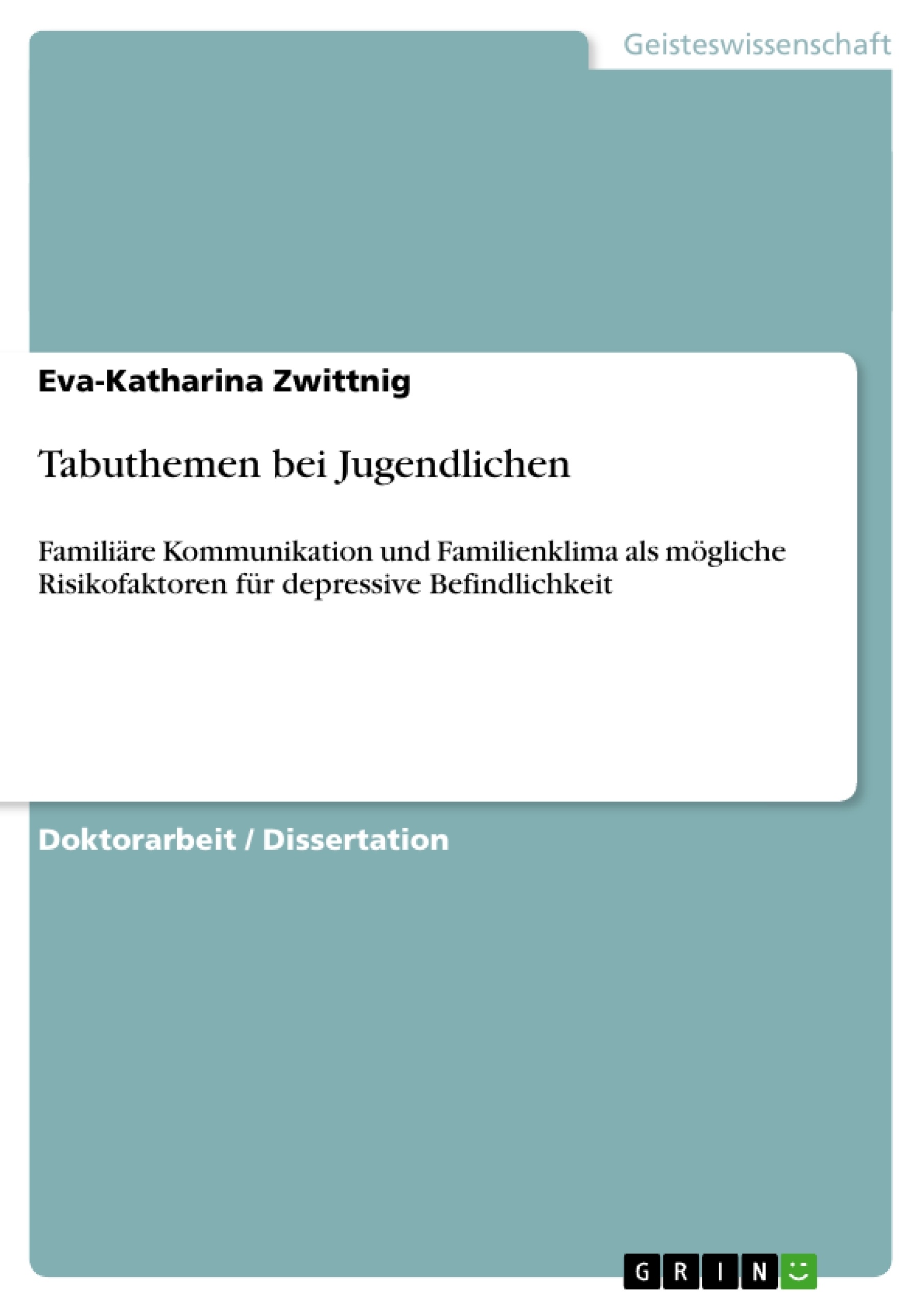In Form einer Querschnittuntersuchung wurde die Bedeutung von familiären Tabuthemen und problematischen Familienfunktionen als potentielle Risikofaktoren für depressive Befindlichkeit in der Adoleszenz studiert. Als Stichprobe diente eine Zufallsauswahl von 934 12- bis 18Jährigen kärntnerischen SchülerInnen. Folgende Variablen wurden erhoben: familiäre Tabu- und Reizthemen, Familienfunktionen, psychosoziale Risikobelastung sowie selbst- und fremdberichtete Depressivität. Die Ergebnisse zeigen, dass dysfunktionale Familienkommunikation in Form einer höheren Anzahl angegebener familiärer Tabuthemen und Reizthemen sehr signifikant in Zusammenhang mit erhöhter selbst- und fremdberichteter depressiver Befindlichkeit steht. Problematische Familienfunktionen im Sinne von ungenügendem Informationsaustausch, dysfunktionalen Familienbeziehungen, ungünstigen Problemlösestrategien, schlechter Rollenanpassung, unzulänglichem Ausdruck von Gefühlen sowie mangelnder Übereinstimmung in familiären Wert- und Normvorstellungen sind ebenfalls mit depressiver Befindlichkeit wie auch mit tabubehafteter familiärer Kommunikation verknüpft. Dies trifft sowohl für Burschen als auch für Mädchen zu. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass einige relevante Variablen im familiären Bereich, die möglicherweise zur Depressionsentwicklung im Jugendalter beitragen, identifiziert werden konnten. Sie bieten vielfältige Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten und eröffnen zugleich auch Perspektiven in präventiver und therapeutischer Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzzusammenfassung
- Abstract
- Einleitung
- 1 Tabu
- 1.1 Begriffsbestimmung und Definition
- 1.2 Die Entdeckung und Etablierung des polynesischen Wortes Tabu in Europa
- 1.2.1 Die Entdeckung des polynesischen Tabu durch den Protestanten Cook
- 1.2.2 Tabu und der viktorianische Zeitgeist
- 1.2.3 Die semantische Konnotation von Tabu
- 1.2.4 Abgrenzung Tabu - Verbot
- 1.2.5 Abgrenzung Tabu – Norm
- 1.2.6 Abgrenzung Tabu - Geheimnis
- 1.3 Tabuforschung
- 1.3.1 Wissenschaftshistorische Ausgangspunkte
- 1.3.2 Der Tabubegriff bei Freud - Das Tabu und die Ambivalenz der Gefühlsregungen
- 1.3.3 Der Tabubegriff der interkulturellen Tabuforschung
- 1.3.4 Tabubereiche und Motivierungen von Tabus
- 1.3.5 Gruppen von Tabus
- 1.3.6 Methodologische Probleme der Tabuforschung
- 1.4 Empirische Tabuforschung
- 1.4.1 Tabuforschung als Aufgabe interkultureller Germanistik (Schröder, 1995)
- 1.4.2 Zu Tabus in unserer Gesellschaft – Eine empirische Untersuchung (Seibel, 1990)
- 1.4.3 Gesundheitliche Beschwerden und Tabuthemen bei Jugendlichen (Kropiunigg, Madu & Weckenmann, 1998)
- 1.4.4 Tabuthemen im internationalen Vergleich (Gasch, 1986/87)
- 2 Depressionen im Kindes- und Jugendalter
- 2.1 Störungsformen und Symptomatik
- 2.1.1 Begriffsbestimmung
- 2.1.2 Klassifikation: Störungsformen
- 2.1.3 Diagnostische Kriterien: Symptomatik
- 2.1.4 Symptomprofil der Depression im Jugendalter
- 2.1.5 Komorbidität
- 2.2 Auftretenshäufigkeit und Verlauf
- 2.2.1 Häufigkeit depressiver Störungen im Jugendalter
- 2.2.2 Alterseffekte
- 2.2.3 Geschlechtseffekte
- 2.2.4 Effekte des Schultyps
- 2.2.5 Zunahme depressiver Störungen in jüngeren Geburtskohorten
- 2.2.6 Verlaufsstudien
- 2.3 Diagnostische Zugänge - Die Erfassung depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen
- 2.3.1 Selbsteinschätzungsverfahren
- 2.3.2 Fremdbeurteilungsverfahren
- 2.3.3 Vorteile und Nachteile der Fremdbeurteilung
- 2.4 Erklärungsansätze depressiver Störungen
- 2.4.1 Biologische Faktoren
- 2.4.2 Psychologische und psychosoziale Risikofaktoren bei Depressionen
- 2.1 Störungsformen und Symptomatik
- 3 Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.1 Begriffsbestimmung und theoretische Ansätze
- 3.2 Die Familie als Risiko- und Schutzfaktor
- 3.2.1 Die Familie als Umwelt der Jugendlichen
- 3.2.2 Sozialisation in der Familie mit Jugendlichen
- 3.2.3 Das Familienmodell (Cierpka & Frevert, 1995)
- 3.2.4 Entwicklungsaufgaben von Familien mit Jugendlichen
- 3.2.5 Familiäre Risiko- und Schutzfaktoren
- 3.3 Familien- und Freundschaftsbeziehungen bei Depression
- 3.3.1 Familienbeziehungen depressiver Kinder und Jugendlicher
- 3.3.2 Peerbeziehungen depressiver Kinder und Jugendlicher
- 3.4 Protektive Faktoren bei Depression
- II Empirischer Teil
- 4 Fragestellung der Untersuchung
- 4.1 Ziele der Untersuchung
- 4.2 Fragestellungen und Hypothesen
- 5 Methode der Untersuchung
- 5.1 Stichprobenauswahl und Stichprobencharakteristika
- 5.1.1 Stichprobenauswahl für die Voruntersuchung
- 5.1.2 Stichprobencharakteristika der Voruntersuchung
- 5.1.3 Stichprobenauswahl für die Hauptuntersuchung
- 5.1.4 Stichprobencharakteristika der Hauptuntersuchung
- 5.2 Ablauf der empirischen Untersuchung
- 5.2.1 Versuchsablauf: Voruntersuchung
- 5.2.2 Versuchsablauf: Hauptuntersuchung
- 5.3 Instrumente zur Datenerhebung
- 5.4 Auswertung der empirischen Untersuchung
- 5.4.1 Verwendete statistische Auswertungsverfahren
- 5.1 Stichprobenauswahl und Stichprobencharakteristika
- 6 Ergebnisse der Untersuchung
- 7 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht den Zusammenhang zwischen Tabuthemen in der familiären Kommunikation, dem Familienklima und der depressiven Befindlichkeit bei Jugendlichen. Die Arbeit zielt darauf ab, Risiko- und Schutzfaktoren für depressive Entwicklungen im Jugendalter zu identifizieren und zu analysieren.
- Einfluss familiärer Tabus auf die psychische Gesundheit Jugendlicher
- Zusammenhang zwischen Kommunikationsmustern in der Familie und depressiven Symptomen
- Analyse von Risiko- und Schutzfaktoren im familiären Kontext
- Empirische Untersuchung von Tabuthemen bei Jugendlichen und deren Auswirkungen
- Methodische Ansätze zur Erfassung von Tabuthemen und depressiver Befindlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und definiert den Begriff „Tabu“ im historischen und wissenschaftlichen Kontext. Kapitel 1 beleuchtet die Tabuforschung, einschließlich methodologischer Herausforderungen. Kapitel 2 beschreibt Depressionen im Jugendalter, ihre Erscheinungsformen, Häufigkeit und Erklärungsansätze. Kapitel 3 diskutiert Risiko- und Schutzfaktoren, mit Fokus auf die Familie als entscheidender Einflussgröße. Der empirische Teil (Kapitel 4-6) beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Stichprobenauswahl und die Ergebnisse. Die Ergebnisse der Voruntersuchung sowie die teststatistische Auswertung verschiedener Fragebögen werden detailliert dargestellt. Die Hauptuntersuchung analysiert den Zusammenhang zwischen Tabuthemen, familiären Funktionen und depressiver Befindlichkeit bei den Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Tabuthemen, Familiäre Kommunikation, Familienklima, Depressive Befindlichkeit, Jugendliche, Risiko- und Schutzfaktoren, Empirische Forschung, Depression im Jugendalter, Qualitative und quantitative Methoden.
- Quote paper
- Dr. Mag. Eva-Katharina Zwittnig (Author), 2003, Tabuthemen bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119712