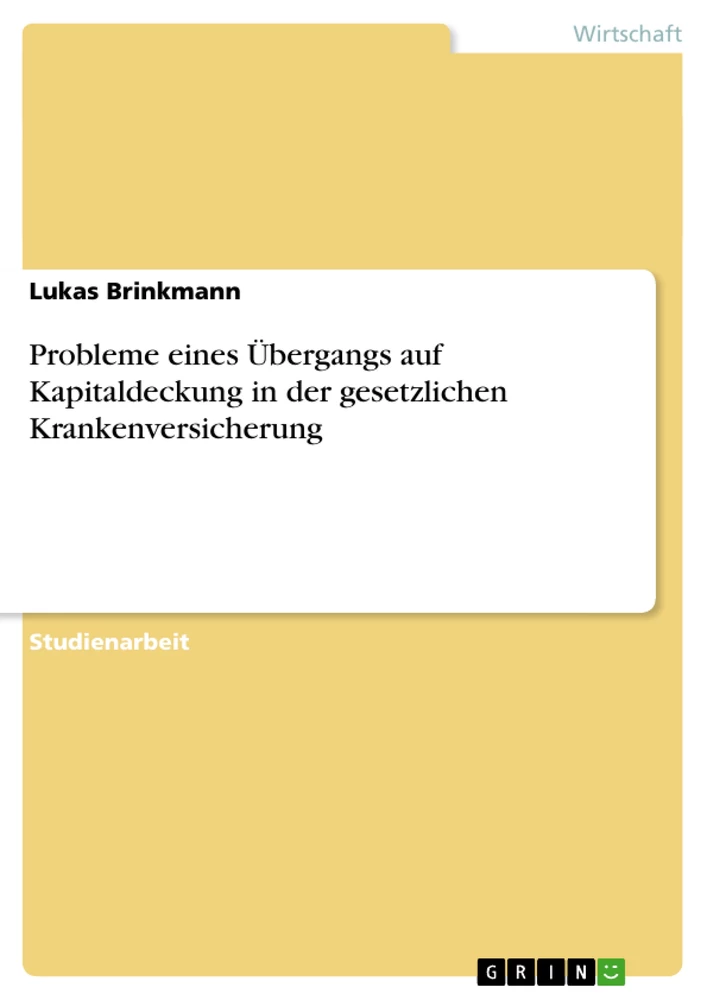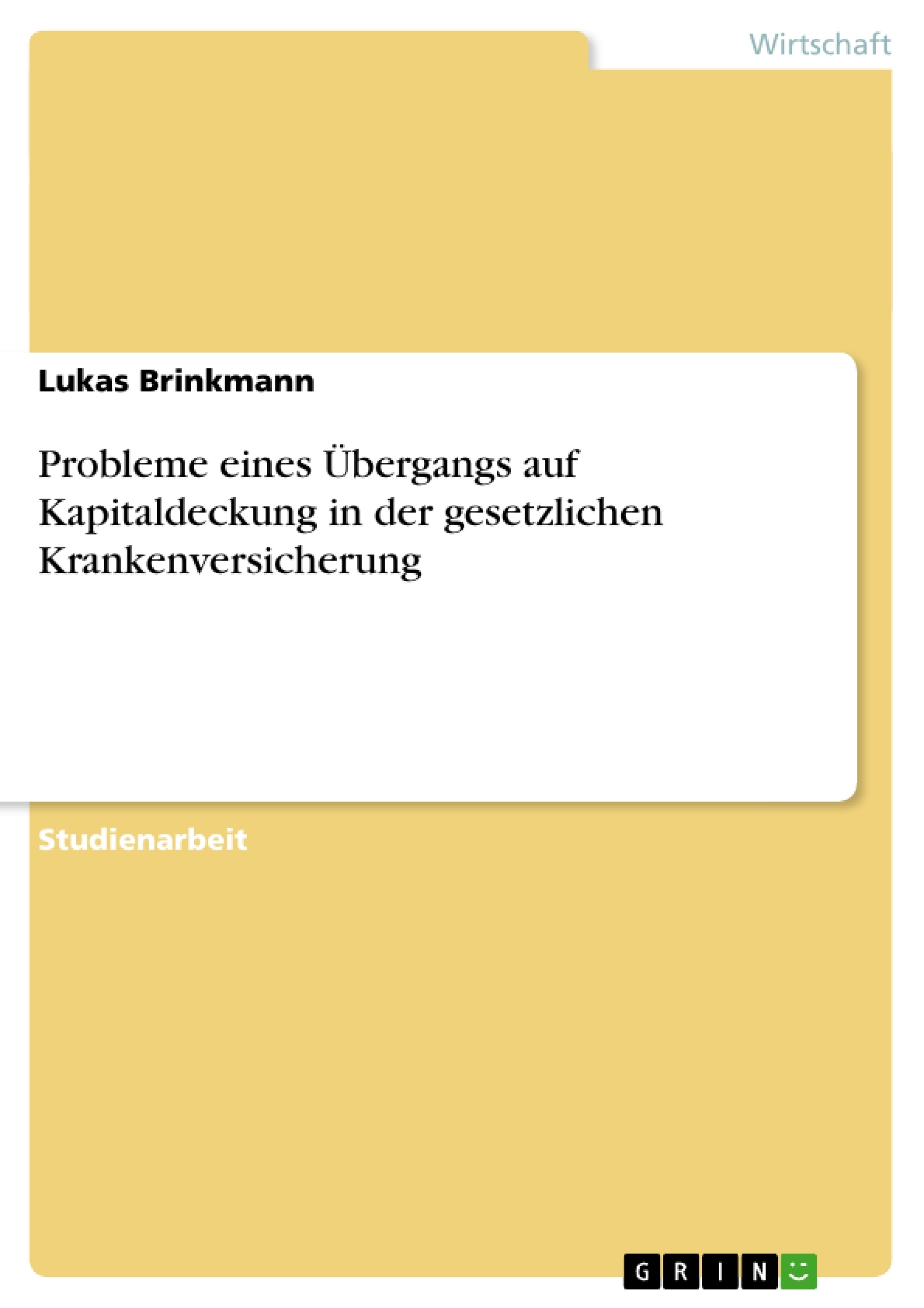In Deutschland werden pro Frau durchschnittlich 1,3 Kinder geboren. Dem größten Teil
der Bevölkerung ist die Konsequenz dieser Zahl unbekannt. Um nämlich die aktuelle
Bevölkerungszahl zu halten, müssten pro Frau 2,1 Kinder geboren werden.1 Diese Zahl ist
mittlerweile seit Jahrzehnten nicht mehr eingehalten worden, so dass die Bevölkerung in
der Bundesrepublik Deutschland sinkt. Diesen Trend kann auch nicht die Zuwanderung,
die traditionell höher ist als das Auswandern Deutscher, stoppen.
Dies ist nicht der einzige strukturelle Wandel unserer Bevölkerung. Sie wird durch den
medizinisch-technischen Fortschritt auch immer älter. Durch diese sich ändernde Struktur
ergibt sich eine Vielzahl an Problemen in unseren Sozialsystemen. Bezüglich der
Krankenversorgung in der BRD wird oft von einem notwendigen Systemwechsel vom
Umlage- zum kapitalgedeckten System gesprochen. In dieser wissenschaftlichen Arbeit
werde ich daher Ursachen, Probleme und Szenarien eines Übergangs in die
Kapitaldeckung erörtern, sowie der Frage nachgehen, ob das aktuelle Umlagesystem
zukunftsfähig ist.
In Kapital 2 wird bewusst sehr stark auf die Ursachen und der medizinischen
Veränderungen eingegangen, da der Verfasser es bedeutsam findet, dass sich der Leser der
doch starken Veränderungen unserer Gesellschaft bewusst wird.
Im dritten Teil der Seminararbeit wird das Kapitaldeckungsverfahren vorgestellt, Vor- und
Nachteile ausgeleuchtet, sowie ein Teilübergang (ähnlich der Riester Rente in der
Gesetzlichen Rentenversicherung) vorgestellt.
Bevor der Verfasser zu seinem Resümee kommt, wird er das Umlage- und das
kapitalgedeckte System gegenüberstellen und mögliche Vollübergänge vorstellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland
- 2.1 Geschichte und Funktionsweise
- 2.2 Unsystematische Umverteilungswirkungen
- 2.3 Demographischer Wandel
- 2.4 Mortalität und Morbidität
- 3. Das Kapitaldeckungsverfahren
- 3.1 Funktionsweise
- 3.2 Renditen im Kapitaldeckungsverfahren
- 3.3 Kernpunkte des Reformmodells
- 3.4 Kapitaldeckung als Ergänzung
- 4. Die Umstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren
- 4.1 Gegenüberstellung beider Krankenversicherungsmodelle
- 4.2 Die implizite Schuld
- 4.3 Sofortiger Übergang in das Kapitaldeckungsverfahren
- 4.4 Kontinuierlicher Übergang in das Kapitaldeckungsverfahren
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Herausforderungen eines Übergangs von einem umlagefinanzierten zu einem kapitalgedeckten System in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Arbeit analysiert die Ursachen für die Notwendigkeit eines solchen Übergangs und beleuchtet die damit verbundenen Probleme und Szenarien. Ein zentrales Anliegen ist die Beurteilung der Zukunftsfähigkeit des bestehenden Umlagesystems.
- Zukunftsfähigkeit des Umlagesystems in der GKV
- Probleme des demografischen Wandels und seine Auswirkungen auf die GKV
- Funktionsweise und Vor- und Nachteile des Kapitaldeckungsverfahrens
- Mögliche Übergangsmodelle zur Kapitaldeckung
- Analyse der impliziten Schuld im Kontext eines Systemwechsels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problematik des demografischen Wandels und seine Auswirkungen auf die GKV dar. Sie begründet die Notwendigkeit einer Untersuchung der Zukunftsfähigkeit des Umlagesystems und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit den Ursachen, Problemen und Szenarien eines Übergangs zur Kapitaldeckung befasst.
2. Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte und Funktionsweise der GKV, beleuchtet unsystematische Umverteilungswirkungen und analysiert die Herausforderungen des demografischen Wandels, einschließlich Mortalitäts- und Morbiditätsentwicklungen. Es legt die Grundlage für das Verständnis der aktuellen Situation und der Notwendigkeit von Reformen.
3. Das Kapitaldeckungsverfahren: Dieses Kapitel präsentiert detailliert das Kapitaldeckungsverfahren in der Krankenversicherung. Es erläutert die Funktionsweise, analysiert die mit ihm verbundenen Renditen und beleuchtet die Kernpunkte möglicher Reformmodelle. Zusätzlich wird die Möglichkeit eines Teilübergangs zur Kapitaldeckung als Ergänzung zum bestehenden System diskutiert.
4. Die Umstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren: Dieses Kapitel vergleicht das Umlage- und das Kapitaldeckungsverfahren und analysiert die "implizite Schuld" des Umlagesystems. Es stellt verschiedene Szenarien für einen Übergang zur Kapitaldeckung vor, sowohl einen sofortigen als auch einen kontinuierlichen Übergang, und bewertet deren Vor- und Nachteile.
Schlüsselwörter
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Kapitaldeckung, Umlagesystem, Demografischer Wandel, Mortalität, Morbidität, Reformmodelle, Systemwechsel, Implizite Schuld, Zukunftsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Übergang von der Umlage- zur Kapitaldeckung in der GKV
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Herausforderungen eines Übergangs von einem umlagefinanzierten zu einem kapitalgedeckten System in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland. Sie analysiert die Notwendigkeit eines solchen Übergangs, die damit verbundenen Probleme und verschiedene Szenarien.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Zukunftsfähigkeit des bestehenden Umlagesystems, den Problemen des demografischen Wandels und seinen Auswirkungen auf die GKV, der Funktionsweise und den Vor- und Nachteilen des Kapitaldeckungsverfahrens, möglichen Übergangsmodellen und der Analyse der impliziten Schuld im Kontext eines Systemwechsels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Beschreibung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Erläuterung des Kapitaldeckungsverfahrens, Analyse der Umstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, wie die Geschichte und Funktionsweise der GKV, die Auswirkungen von Mortalität und Morbidität, die Renditen im Kapitaldeckungsverfahren und verschiedene Übergangsmodelle.
Was wird unter der „impliziten Schuld“ verstanden?
Die „implizite Schuld“ wird im Kontext des Übergangs vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren diskutiert und bezieht sich wahrscheinlich auf die bestehenden Verpflichtungen des Umlagesystems, die bei einem Systemwechsel berücksichtigt werden müssen.
Welche Übergangsmodelle werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht sowohl einen sofortigen als auch einen kontinuierlichen Übergang zum Kapitaldeckungsverfahren und bewertet die Vor- und Nachteile beider Szenarien.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Zukunftsfähigkeit der verschiedenen Modelle. Konkrete Schlussfolgerungen lassen sich aus dem vorliegenden Inhaltsverzeichnis und den Kapitelzusammenfassungen nicht detailliert ableiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Kapitaldeckung, Umlagesystem, Demografischer Wandel, Mortalität, Morbidität, Reformmodelle, Systemwechsel, Implizite Schuld, Zukunftsfähigkeit.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Weitere Details finden sich im vollständigen Text der Seminararbeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung, den Auswirkungen des demografischen Wandels und den verschiedenen Reformoptionen auseinandersetzen. Sie ist besonders nützlich für Studierende, Wissenschaftler und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen.
- Quote paper
- Lukas Brinkmann (Author), 2008, Probleme eines Übergangs auf Kapitaldeckung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119591