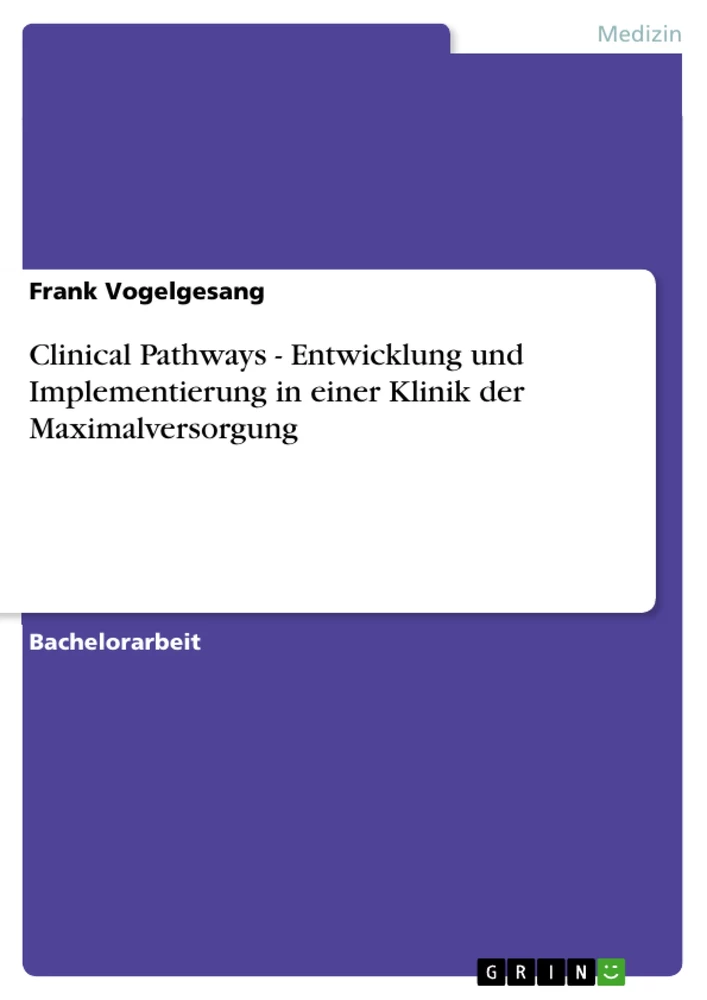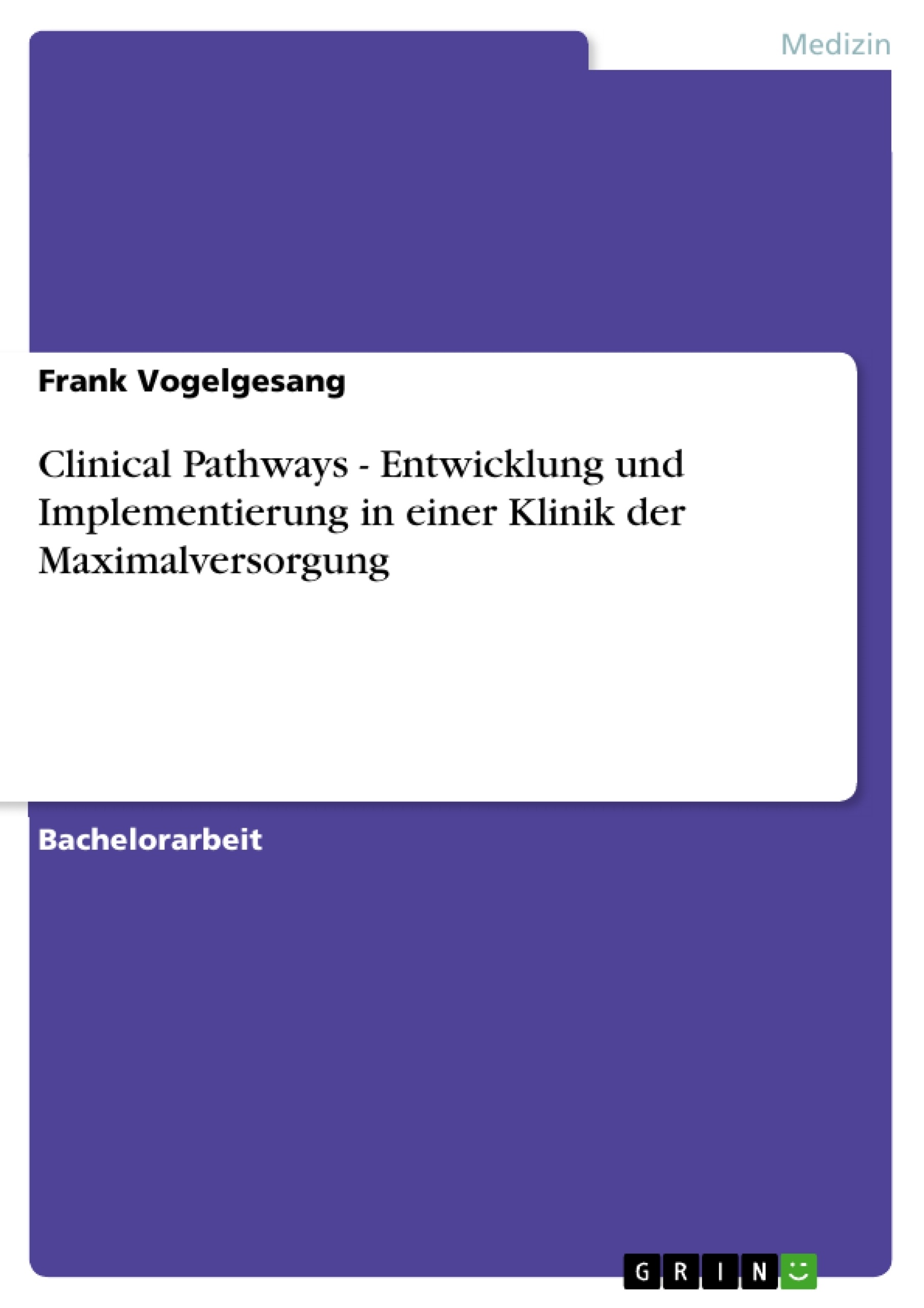Clinical Pathway – Wunderwaffe oder gescheitertes Konzept für Krankenhäuser, die sich dem Strukturwandel im Gesundheitswesen stellen?
Am Beispiel einer Klinik der Maximalversorgung in Deutschland wird ein Pilotprojekt zur Entwicklung und Einführung von Clinical Pathways begleitet und analysiert. Zunächst befasst sich diese Bachelor Thesis mit der Begriffsbestimmung und dem Prinzip der klinischen Behandlungspfade, bevor ein Überblick über das konkrete Projekt bzgl. der Entwicklung der Clinical Pathways im Projektkrankenhaus gegeben wird. Dem Leser wird die inhaltliche und organisatorische Vorgehensweise im Projektkrankenhaus vorgestellt. Damit das Projekt gelingt, müssen über alle Berufsgruppen der Klinik hinweg die Behandlungsteams motivierend begleitet werden. Hierzu gehört das Anstoßen eines Umdenkprozesses, weg von der funktionellen, hin zur prozessorientierten Sichtweise von Behandlungsabläufen. Ein wichtiges Mittel auf dem Weg zu diesem Um-denkprozess ist die Einwandsvorbehandlung, der ein Kapitel dieser Arbeit gewidmet ist.
Zur Qualifizierung der Dokumentationsqualität der Clinical Pathways, incl. der dazugehörigen diagnosebezogenen Verlaufsdokumentationen, wird das Mittel des Dokumenta-tionsaudits vorgestellt und angewandt. Um die Frage zu beantworten, ob sich Clinical Pathways als Wunderwaffen gegen den steigenden Kostendruck auf Kliniken eignen, werden die Auswirkungen der Umstellung von der herkömmlichen Behandlungsmethode auf die strukturierte Behandlungsmethode unter den Aspekten der Veränderungen auf die Verweildauer und der Gewinnoptimierung beleuchtet.
Damit sich der Leser ein Bild von Clinical Pathways machen kann, wird der Clinical Pathway Transurethrale Resektion der Blase auszugsweise vorgestellt und erläutert. Dieser Pfad ist auch Ausgangsbasis zur Errechnung der personellen Entwicklungskosten eines Clinical Pathway.
Die Einbindung der Clinical Pathways in die Krankenhaus – IT - Infrastruktur mit Hilfe der dafür auf dem Markt befindlichen Krankenhausinformationssysteme bildet durch einen Ausblick in die weitere Zukunft der Clinical Pathways den Abschluss der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Problemstellung
- 2. Zielsetzung
- 3. Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 4.
- 4.1 Ziele der Clinical Pathways
- 4.1.1 Übersicht zu verschiedenen Zielen der Clinical Pathways aus der Literatur
- 4.1.2 Zieldefinition für Clinical Pathways im Projektkrankenhaus
- 4.2 Projektorganisation zur Entwicklung des Pfades „Transurethrale Resektion der Blase/Prostata“ (TUR B/P)
- 4.2.1 Ausrichtung an bestehenden Standards und Leitlinien
- 4.2.2 Einwandsvorbehandlung bei der Entwicklung von Clinical Pathways
- 4.2.3 Struktur der Patientenpfade im Pilotkrankenhaus
- 4.2.3 Organisatorische Vorgehensweise zur Erstellung des Clinical Pathway
- 4.2.4 Inhaltliche Vorgehensweise zur Erstellung eines Clinical Pathways
- 4.3 Analyse des benötigten Zeitbudgets zur Entwicklung des TUR B/P-Pathway
- 4.4 Implementierung des Clinical Pathway als Behandlungspfad incl. strukturierter Verlaufsdokumentation
- 4.4.1 Kick-off-Veranstaltung
- 4.4.2 Testlauf des Clinical Pathways
- 4.4.3 Klinikweite Einführung des Clinical Pathways
- 4.4.4 Strukturierte Verlaufsdokumentation
- 4.5 Durchführung von Projekt-Dokumentationsaudits
- 4.6 Analyse der mittleren Verweildauer von Patienten innerhalb und außerhalb der Pfade
- 4.7 Monetäre Auswirkungen durch die Veränderung der Verweildauer als Folge des Einsatzes von Clinical Pathways
- 4.1 Ziele der Clinical Pathways
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Vorstellung des Behandlungspfades Transurethrale Resektion der Harnblase (TUR B)
- 5.1.1 Das Grafikdokument TUR B
- 5.1.2 Diagnosebezogene Verlaufsdokumentation TUR B
- 5.2 Auswertung des Zeitbedarfs zur Erstellung des Clinical Pathway TUR P
- 5.2.1 Darstellung der Zeiterfassung
- 5.2.2 Auswertung des Zeitbedarfs nach Berufsgruppen
- 5.2.3 Personalkostenaufwand zur Entwicklung des Clinical Pathway TUR P
- 5.3 Ergebnisauswertungen der Dokumentationsaudits bzgl. der Dokumentationsqualität
- 5.3.1 Dokumentationsqualität mit der herkömmlichen Dokumentationsweise
- 5.3.2 Dokumentationsqualität mit der strukturierten, diagnosebezogenen Verlaufsdokumentation der Clinical Pathways
- 5.3.3 Gegenüberstellung der Dokumentationsqualität nach der herkömmlichen Dokumentationsmethode und der Dokumentationsqualität nach der diagnosebezogenen, strukturierten Verlaufdokumentation
- 5.4 Darstellung der Verweildauer im Vergleich zwischen Patienten innerhalb und außerhalb der Behandlung nach Clinical Pathways
- 5.4.1 Durchschnittliche Verweildauer von Nicht-Pfad-Patienten bei Choledocholithiasis mit laparoskopischer Cholezystektomie
- 5.4.2 Durchschnittliche Verweildauer von Pfad-Patienten bei Choledocholithiasis mit laparoskopischer Cholezystektomie
- 5.4.3 Direkter Vergleich der beiden Patientengruppen
- 5.4.4 Monetäre Auswirkungen der verkürzten Verweildauer durch den Clinical Pathway
- 5.5 Alternative EDV-gestützte Lösungsmöglichkeiten zur Einführung und Nutzung von Clinical Pathways
- 5.1 Vorstellung des Behandlungspfades Transurethrale Resektion der Harnblase (TUR B)
- 6. Diskussion
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklung und Implementierung von Clinical Pathways in einer Klinik der Maximalversorgung. Ziel ist die Analyse der Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung durch den Einsatz von strukturierten Behandlungspfaden im Kontext des DRG-Systems.
- Entwicklung eines Clinical Pathways für die Transurethrale Resektion der Blase/Prostata (TUR B/P)
- Analyse des Zeit- und Kostenaufwands für die Entwicklung des Pathways
- Bewertung der Auswirkungen auf die Verweildauer der Patienten
- Untersuchung der Verbesserung der Dokumentationsqualität
- Evaluation der Eignung von Clinical Pathways zur Gewinnoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung des steigenden Kostendrucks in deutschen Kliniken im DRG-System. Kapitel 4 erläutert die Projektorganisation und die methodische Vorgehensweise bei der Entwicklung des Clinical Pathways für TUR B/P. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie, einschließlich der Analyse des Zeitaufwands, der Dokumentationsqualität und der Verweildauer von Patienten. Es werden Daten zum Zeitbedarf und den Personalkosten vorgestellt. Ein Vergleich der Dokumentationsqualität mit und ohne Clinical Pathway wird durchgeführt, sowie ein Vergleich der Verweildauer von Patienten innerhalb und außerhalb des Pathways.
Schlüsselwörter
Clinical Pathways, DRG-System, Kostenoptimierung, Effizienzsteigerung, Verweildauer, Dokumentationsqualität, TUR B/P, Maximalversorgung, Gesundheitsmanagement.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Frank Vogelgesang (Author), 2008, Clinical Pathways - Entwicklung und Implementierung in einer Klinik der Maximalversorgung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119588