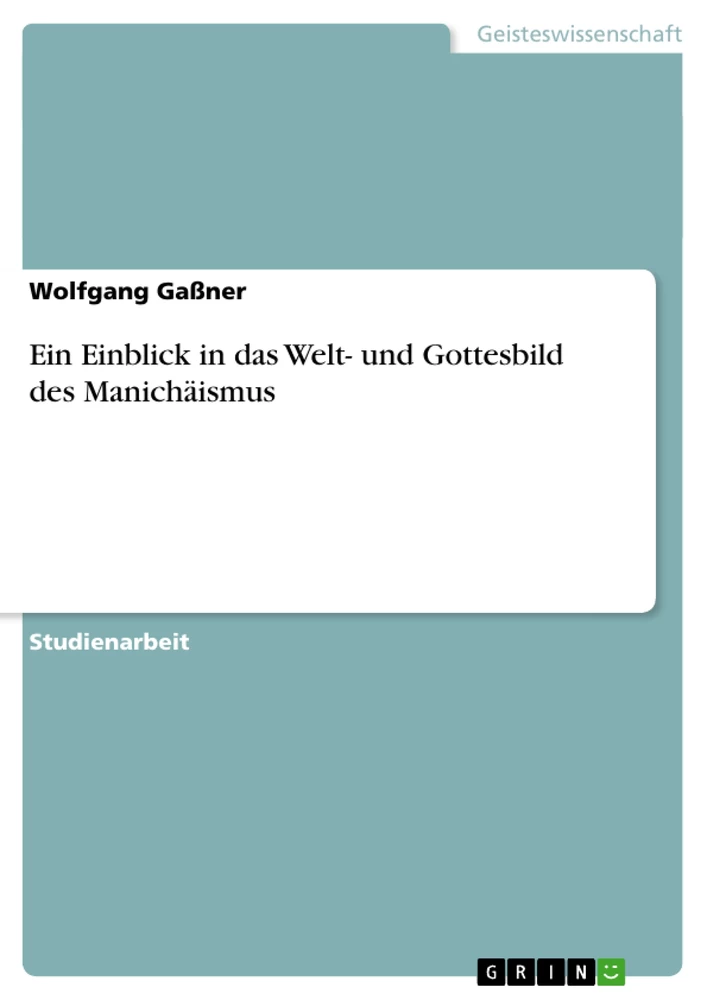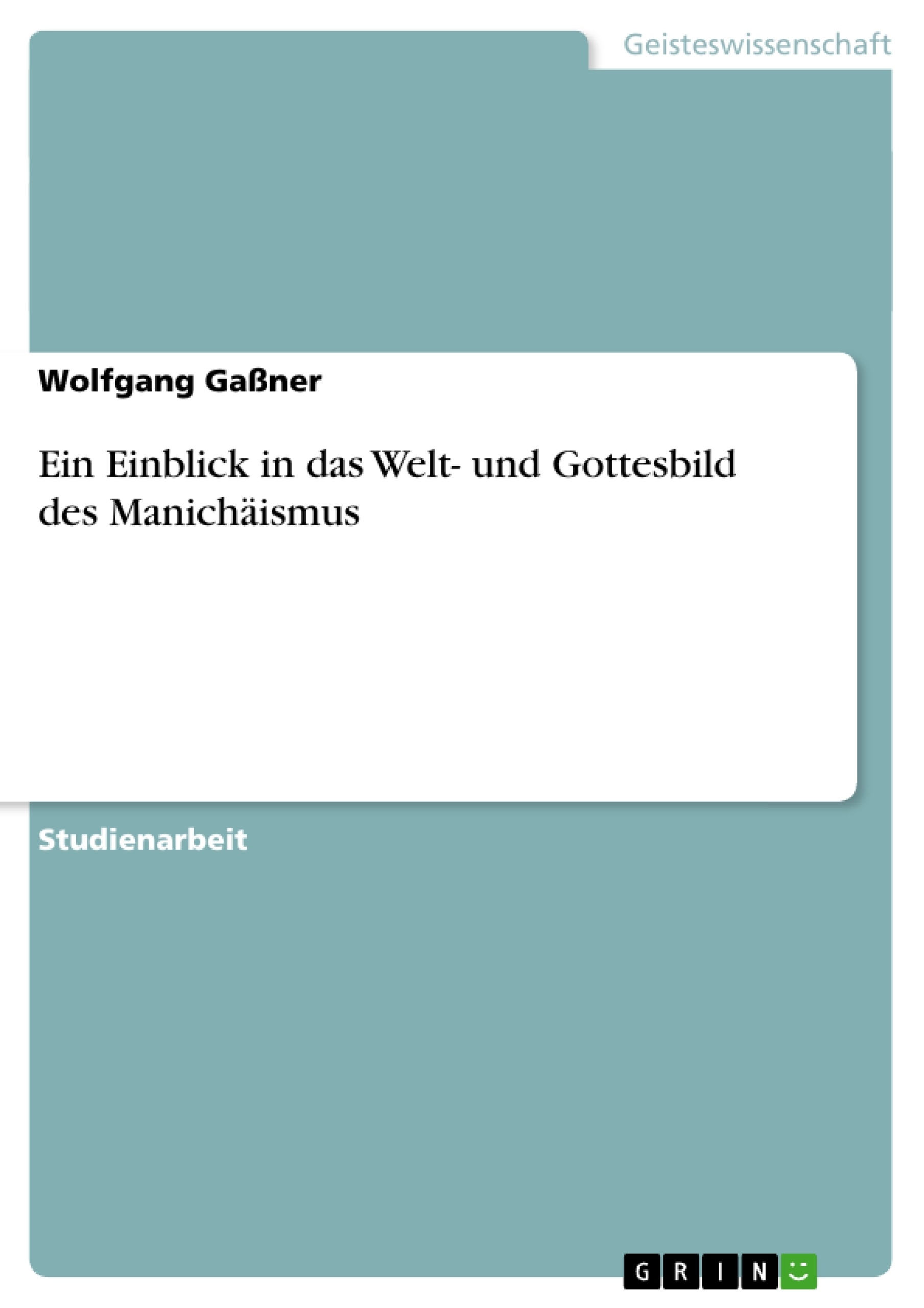Mit dem Beginn seiner Lehrtätigkeit Mitte des dritten Jahrhunderts konnte Mani eine große
Anzahl an Menschen für seine Religion gewinnen. Doch was war so besonders an dieser
Glaubensrichtung, dass sich sogar Augustinus zeitweise zu ihr hingezogen fühlte? Es mag
zum einen daran gelegen haben, dass der Manichäismus eine sehr wandelbare Religion war.
Er konnte sich hervorragend an die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Menschen
anpassen. Beispielsweise wurde im Westen des Römischen Reichs die Person des Dritten
Gesandten nach und nach mit der Person Jesu vereinigt, während im Fernen Osten Jesus als
„Sonne-Mond-Gott“ bezeichnet wurde. Wichtiger ist jedoch, dass diese Religion eine
Antwort auf die damals wie heute aktuelle Frage nach dem Leid in der Welt lieferte. Die
Theodizeeproblematik, auf die das Christentum noch heute zufriedenstellende Antworten
sucht, findet im Manichäismus eine Lösung, die damals für viele Menschen überzeugender als
die des Christentums war. Um diesen Lösungsversuch verstehen zu können muss man aber
erst einen genaueren Blick auf das Welt- und Gottesbild des Manichäismus werfen. In dieser
Arbeit deswegen mit einem Überblick über das Wirken des Religionsgründers, sowie deren
Ausbreitung begonnen. Anschließend wird das Gottesbild beschrieben, wobei aber ein
Schwerpunkt auf den manichäischen Dualismus und die Schöpfungsgeschichte gelegt wird.
Nach einem Antwortversuch auf die Theodizeefrage wird das tägliche Leben eines Anhängers
Manis beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- I Das Leben und Wirken Manis
- a) Aus Sicht seiner christlichen Gegner
- b) Nach den arabischen Schriften
- II Die Verbreitung des Manichäismus
- III Ein Einblick in das Gottesbild des Manichäismus
- a) Die Gnosis
- b) Der manichäische Dualismus
- c) Die manichäische Schöpfungsgeschichte
- IV Die Theodizeefrage im Manichäismus
- V Die Lebensweise der Manichäer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Welt- und Gottesbild des Manichäismus und bietet einen Einblick in die Theodizeefrage innerhalb dieser Religion. Ziel ist es, die Besonderheiten des Manichäismus im Vergleich zum Christentum zu beleuchten und zu verstehen, warum er für viele Menschen eine überzeugendere Antwort auf das Problem des Leidens in der Welt bot.
- Das Leben und Wirken Manis
- Die Verbreitung des Manichäismus
- Das manichäische Gottesbild und der Dualismus
- Die manichäische Schöpfungsgeschichte
- Die Theodizeefrage im Manichäismus
Zusammenfassung der Kapitel
I Das Leben und Wirken Manis: Dieses Kapitel beleuchtet das Leben des Religionsgründers Mani aus zwei Perspektiven: Die Darstellung durch seine christlichen Gegner zeichnet ein Bild Manis als Betrüger und Plagiator, der fremde Lehren aneignete und sich selbst als Mani ausgab. Im Gegensatz dazu präsentieren arabische Quellen eine glaubwürdigere Biografie, die von Manis Geburt im Jahr 216 in Babylon, seiner frühen religiösen Erfahrungen und seiner Berufung als Prophet berichtet. Diese Quellen schildern Manis Begegnung mit dem Engel El Tawan, seinen öffentlichen Auftritt nach einem Indienaufenthalt und seinen Konflikt mit Schahpur I., der zu seiner Verbreitung des Manichäismus führte. Der Vergleich beider Perspektiven unterstreicht die Schwierigkeiten, eine objektive Biografie Manis zu erstellen, und verdeutlicht die unterschiedlichen Interessen der Quellenautoren.
II Die Verbreitung des Manichäismus: (Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
III Ein Einblick in das Gottesbild des Manichäismus: Dieses Kapitel beschreibt das manichäische Gottesbild, mit Fokus auf den Dualismus und die Schöpfungsgeschichte. Der Manichäismus präsentiert ein dualistisches Weltbild, das von einem Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis geprägt ist. Die Schöpfungsgeschichte erklärt die Entstehung der Welt als Ergebnis dieses kosmischen Kampfes. Diese kosmogonische Vorstellung dient als Grundlage für die manichäische Vorstellung von Gott und der Welt und bildet den Rahmen für die Auseinandersetzung mit dem Problem des Leidens.
IV Die Theodizeefrage im Manichäismus: (Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
V Die Lebensweise der Manichäer: (Es fehlt der Text für dieses Kapitel im bereitgestellten Dokument. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Manichäismus, Mani, Dualismus, Gnosis, Schöpfungsgeschichte, Theodizee, Christentum, Leidensfrage, Weltbild, Gottesbild, arabische Quellen, christliche Quellen.
Häufig gestellte Fragen zum Manichäismus
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Manichäismus. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Welt- und Gottesbild des Manichäismus, insbesondere auf der Theodizeefrage (Problem des Leidens) und einem Vergleich zum Christentum.
Welche Kapitel sind enthalten?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Das Leben und Wirken Manis (aus christlicher und arabischer Perspektive); 2. Die Verbreitung des Manichäismus; 3. Ein Einblick in das Gottesbild des Manichäismus (Gnosis, Dualismus, Schöpfungsgeschichte); 4. Die Theodizeefrage im Manichäismus; 5. Die Lebensweise der Manichäer. Die Kapitel 2, 4 und 5 enthalten im vorliegenden Dokument keine vollständigen Zusammenfassungen, da der Text fehlt.
Wie wird Manis Leben dargestellt?
Das erste Kapitel beleuchtet Manis Leben aus zwei gegensätzlichen Perspektiven: Die christliche Sichtweise präsentiert Mani als Betrüger und Plagiator, während arabische Quellen eine detailliertere und positivere Biografie bieten, die von seiner Geburt, seinen religiösen Erfahrungen und seiner prophetischen Berufung berichtet.
Was ist das manichäische Gottesbild?
Kapitel drei beschreibt den manichäischen Dualismus als zentralen Bestandteil des Gottesbildes. Die Welt wird als Schauplatz eines Kampfes zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis dargestellt. Die Schöpfungsgeschichte erklärt die Entstehung der Welt als Ergebnis dieses kosmischen Kampfes. Dieser Dualismus bildet die Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Problem des Leidens.
Wie wird die Theodizeefrage im Manichäismus behandelt?
Die Zusammenfassung zu Kapitel vier fehlt im bereitgestellten Dokument. Die Arbeit befasst sich jedoch mit der Frage, wie der Manichäismus das Problem des Leidens in der Welt erklärt und warum er für viele Menschen eine überzeugendere Antwort bot als das Christentum.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Manichäismus, Mani, Dualismus, Gnosis, Schöpfungsgeschichte, Theodizee, Christentum, Leidensfrage, Weltbild, Gottesbild, arabische Quellen, christliche Quellen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Welt- und Gottesbild des Manichäismus zu erläutern und die Besonderheiten im Vergleich zum Christentum herauszustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verständnis, warum der Manichäismus für viele Menschen eine überzeugendere Antwort auf das Problem des Leidens bot.
- Quote paper
- Wolfgang Gaßner (Author), 2006, Ein Einblick in das Welt- und Gottesbild des Manichäismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119387