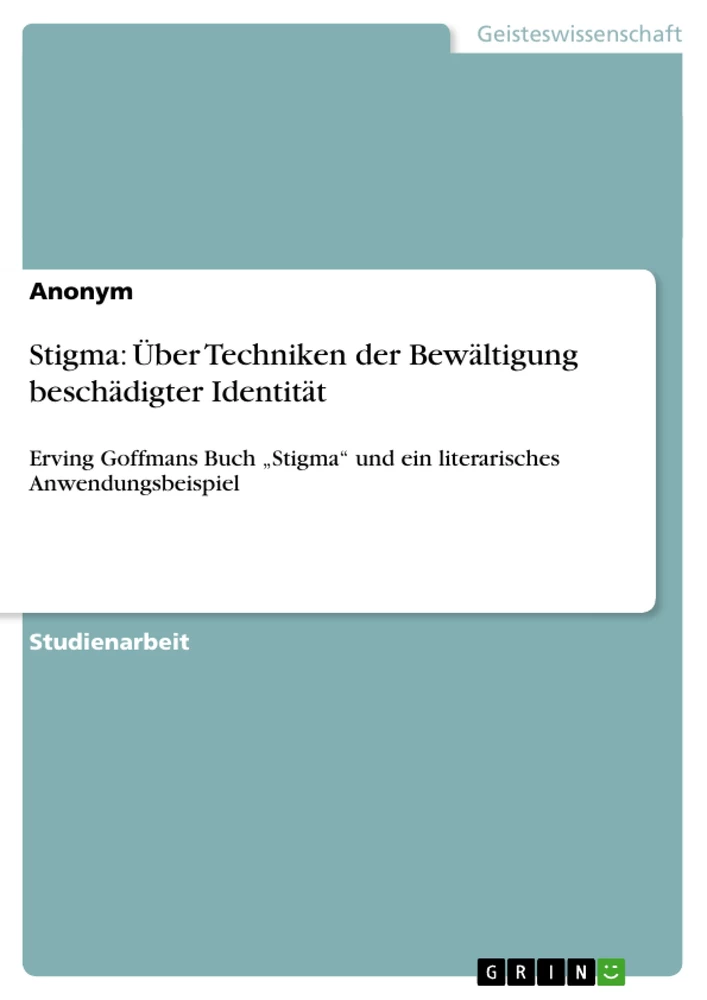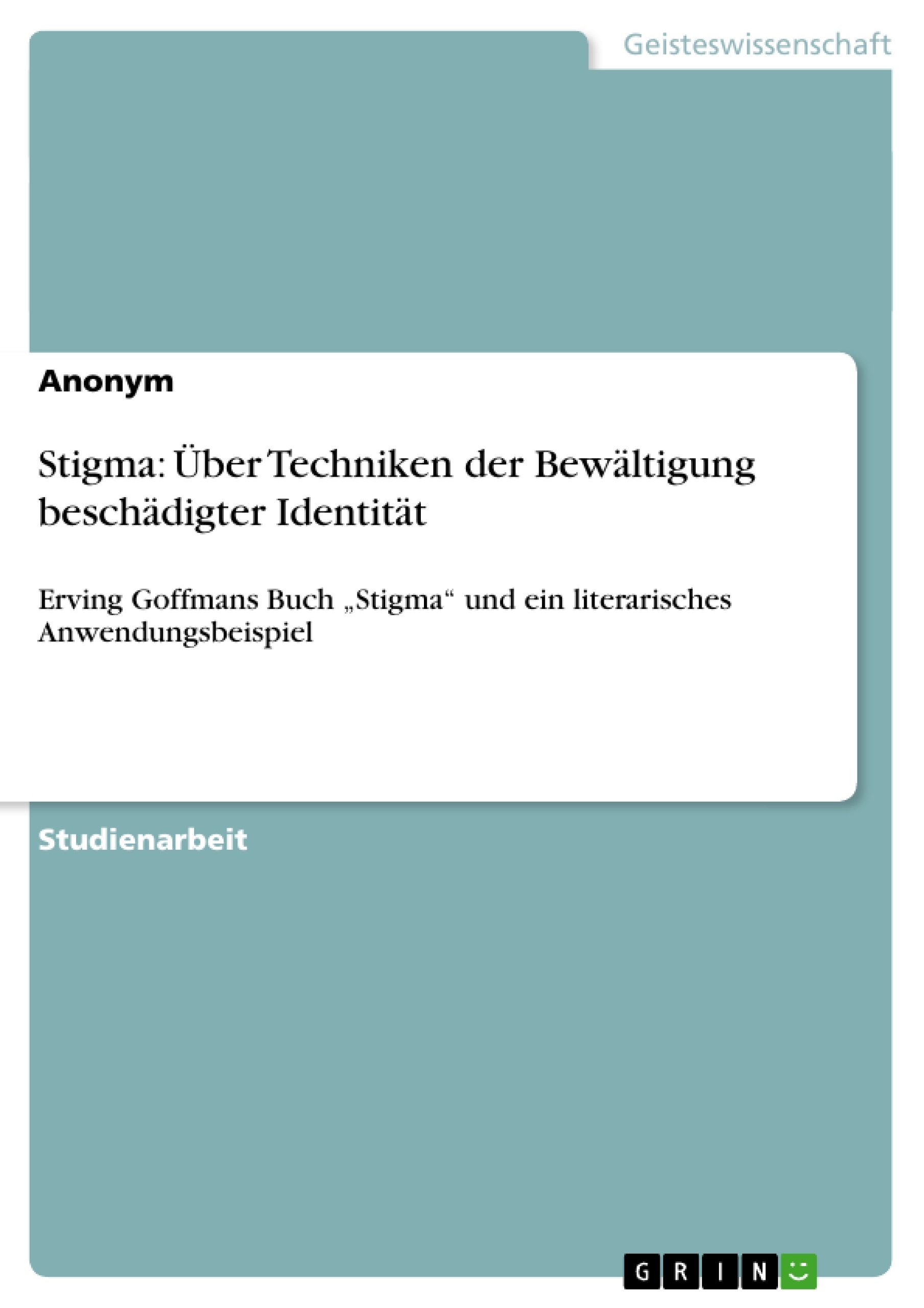Vier Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten großen Erfolges, « The Presentation of Self in Everyday Life » (1959), leistet der amerikanische Soziologe und Anthropologe Erving Goffman (1922-1982) mit seinem Buch « Stigma » (1963) einen soziologischen Beitrag zum Thema gesellschaftlicher Marginalisierung. In Anlehnung an seine zuvor entwickelte Theater-Metaphorik beschreibt Goffman den Umgang des einzelnen und der Gesellschaft mit Eigenschaften, die in negativer Weise von den sozial etablierten Erwartungen eines « normalen » Verhaltens oder Aussehens abweichen. Wie bereits die etymologische Herkunft des « Stigma »-Begriffs andeutet , gelten laut Goffmanscher Definition all diejenigen als « stigmatisiert », die « von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen [sind] » . In der Abhandlung, die zahlreiche Fallbeispiele stigmatisierter Personen aus sozialpsychologischen Untersuchungen einbezieht, macht sich Goffman u.a. zum Ziel, für das Phänomen « Stigma » einen klaren Definitionsrahmen vorzulegen, indem er das « Material über Stigma von anderen benachbarten Sachverhalten abzugrenzen » versucht. Anhand einer Analyse des zugrundeliegenden medizinischen Materials soll sowohl der Wert der darin enthaltenen Erkenntnisse für die gegenwärtige soziologische Forschung als auch die Relation zum Thema « Devianz » geklärt werden. Die folgende Ausarbeitung wird mit einer Darstellung der Kapitel 1 und 2 von Goffmans « Stigma », die in Form der Hauptthesen und wichtigsten begrifflichen Definitionen resümiert werden, eingeleitet, da diese für eine präzise Darstellung und Abgrenzung der Inhalte von Kapitel 3 unverzichtbar sind. Zur Veranschaulichung der Inhalte von Kapitel 3, das daraufhin ausführlicher dargelegt und untersucht wird, soll die fiktive Geschichte eines Stigmatisierten (aus Kafkas Novelle « Die Verwandlung ») beispielhaft herangezogen werden. Parallel hierzu soll auf eventuelle Kritikpunkte in Bezug auf die jeweils getroffenen Aussagen Goffmans eingegangen werden, insbesondere auch im Hinblick auf ihre heutige Gültigkeit und Erfahrbarkeit. Bezüge zu anderen Werken Erving Goffmans können der Verdeutlichung und dem Vergleich der in « Stigma » aufgestellten Thesen dienen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Soziale und Persönliche Identität
2.1 Stigma und soziale Identität
2.2 Informationskontrolle und persönliche Identität
3 Themenschwerpunkt: Gruppenausrichtung und Ich-Identität
3.1 Ein literarisches Anwendungsbeispiel: Franz Kafkas Novelle « Die Verwandlung »- Geschichte eines Stigmatisierten
4 Schlusswort
Bibliographie
1 Einleitung
Vier Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten großen Erfolges, « The Presentation of Self in Everyday Life » (1959), leistet der amerikanische Soziologe und Anthropologe Erving Goffman (1922-1982) mit seinem Buch « Stigma »[1] (1963) einen soziologischen Beitrag zum Thema gesellschaftlicher Marginalisierung. In Anlehnung an seine zuvor entwickelte Theater-Metaphorik beschreibt Goffman den Umgang des einzelnen und der Gesellschaft mit Eigenschaften, die in negativer Weise von den sozial etablierten Erwartungen eines « normalen » Verhaltens oder Aussehens abweichen. Wie bereits die etymologische Herkunft des « Stigma »-Begriffs andeutet[2], gelten laut Goffmanscher Definition all diejenigen als « stigmatisiert », die « von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen [sind] »[3]. In der Abhandlung, die zahlreiche Fallbeispiele stigmatisierter Personen aus sozialpsychologischen Untersuchungen einbezieht, macht sich Goffman u.a. zum Ziel, für das Phänomen « Stigma » einen klaren Definitionsrahmen vorzulegen, indem er das « Material über Stigma von anderen benachbarten Sachverhalten abzugrenzen »[4] versucht. Anhand einer Analyse des zugrundeliegenden medizinischen Materials soll sowohl der Wert der darin enthaltenen Erkenntnisse für die gegenwärtige soziologische Forschung als auch die Relation zum Thema « Devianz » geklärt werden. Die folgende Ausarbeitung wird mit einer Darstellung der Kapitel 1 und 2 von Goffmans « Stigma », die in Form der Hauptthesen und wichtigsten begrifflichen Definitionen resümiert werden, eingeleitet, da diese für eine präzise Darstellung und Abgrenzung der Inhalte von Kapitel 3 unverzichtbar sind. Zur Veranschaulichung der Inhalte von Kapitel 3, das daraufhin ausführlicher dargelegt und untersucht wird, soll die fiktive Geschichte eines Stigmatisierten (aus Kafkas Novelle « Die Verwandlung ») beispielhaft herangezogen werden. Parallel hierzu soll auf eventuelle Kritikpunkte in Bezug auf die jeweils getroffenen Aussagen Goffmans eingegangen werden, insbesondere auch im Hinblick auf ihre heutige Gültigkeit und Erfahrbarkeit. Bezüge zu anderen Werken Erving Goffmans können der Verdeutlichung und dem Vergleich der in « Stigma » aufgestellten Thesen dienen.
2 Soziale und Persönliche Identität
Im späteren Verlauf dieser Arbeit werden uns drei Identitätsbegriffe begegnen, die Goffman in seinem Buch « Stigma » ausführlich beschreibt und voneinander abgrenzt. Eine Stigmatisierung macht sich laut Goffmans Definition insbesondere dort bemerkbar, wo Menschen sich begegnen und miteinander in Interaktion treten. Denn sobald zwei oder mehrere Personen aufeinander treffen, wird jedes Zeichen, d.h. auch jede unsichere Gestik oder Mimik, jedes nervöse Zucken und jedes gestotterte Wort, unmittelbar gedeutet und bestimmten stereotypen Identitäts-Kategorien zugeordnet, so ggf. auch der eines Stigmatisierten. Mittels « symbolischer Interaktion » werden die verschiedenen Identitätsmerkmale eines jeden einzelnen in der täglichen Begegnung mit anderen immer wieder neu verortet, ausgehandelt und definiert.
2.1 Stigma und soziale Identität
Die Soziale Identität bezeichnet in Goffmans Vokabular bestimmte « normative Erwartungen », wie etwa eine « Personenkategorie », in die wir ein neu kennenzulernendes Individuum bereits beim ersten Ansehen desselben einordnen. Aus der Summe aller Zeichen, die wir von ihm empfangen – wie z.B. Aussehen, Artikulation, Gebärden u.v.m.-, schließen wir auf seinen sozialen Status, wie bspw. den möglichen Beruf und das Alter unseres Gegenübers, sowie auf bestimmte, seine Personenkategorie erfahrungsmäßig kennzeichnende « Charaktereigenschaften »[5]. Dieser unbewusste, schnelle Vorgang (die Zuschreibung einer virtualen sozialen Identität), den Goffman auch eine « Charakterisierung im Effekt »[6] nennt, ist gleichzeitig mit der ebenso unbewussten Erwartung verbunden, dass sich die Annahmen, die wir über die soziale Identität der noch unbekannten Person getroffen haben, in der weiteren Interaktion mit ihr bestätigen. Beizeiten stellen wir jedoch in längerer Gegenwart einer Person fest, dass ihre aktuale soziale Identität, also ihre reale Zugehörigkeit zu einer « Personenkategorie » und die ihr tatsächlich zuzurechnenden Eigenschaften, nicht mit der zuvor angenommenen virtualen sozialen Identität, d.h. der von uns ausgegangenen stereotypen Erwartung hinsichtlich ihrer sozialen Identität, übereinstimmen. Handelt es sich um eine « negative » Abweichung dessen, was wir erwartet haben, so läuft die betreffende Person Gefahr, aufgrund ihrer Abnormalität von uns diskreditiert zu werden und durch den Besitz einer von uns als « Unzulänglichkeit » oder als « Fehler » eingestuften Eigenschaft Opfer einer sozialen Diffamierung zu werden. Das entsprechende Attribut, das in der beschriebenen Situation eine Diskrepanz zwischen den beiden sozialen Identitäten ausgelöst hat, durch welches also ein inkohärentes Bild über die soziale Identität einer Person vermittelt wird, bezeichnet Goffman im Folgenden als Stigma und die von ihm betroffene Person als « stigmatisiert »[7]. Wie Goffman desweiteren erläutert[8], sind diejenigen, die über ihr Stigma bescheid wissen und sich über seine Existenz und Visibilität[9] bewusst geworden sind, als Diskreditierte zu bezeichnen, während diejenigen, die zwar von einem Stigma betroffen sind, es aber auf geschickte Weise zu verbergen wissen, in ihrem Fall als (potenziell) Diskreditierbare zunächst keine negativen Folgen für den Grad ihrer sozialen Akzeptanz zu befürchten haben. Zu den drei Typen von Stigmata, die bei Goffman als mögliche Auslöser einer Diskreditierung genannt werden, gehören physische Deformationen, « individuelle Charakterfehler »- zu diesem Typus werden u.a. Willensschwäche und « unnatürliche Leidenschaften » gezählt[10] -, ebenso wie die sog. « phylogenetischen Stigmata der Rasse, Nation und Religion »[11]. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die extern erfolgende Beurteilung der sozialen Identität einer Person ein Moment sozialer Interaktion ist, bei dem es, abhängig vom Grad der Diskrepanz zwischen der vorgefundenen virtualen und aktualen Identität, zu einer Differenzierung zwischen den Rollenkategorien[12] « stigmatisiert » und « normal » kommen kann.
2.2 Informationskontrolle und persönliche Identität
Solange man einen « Makel », sei er nun physischer, psychischer oder sonstiger Art, zu verbergen weiß, ist man zwar « diskreditierbar », da eine bestimmte Wendung der gegebenen sozialen Situation oder eine Fehlentscheidung zur Entlarvung der negativ abweichenden Eigenschaft führen könnten, nicht aber grundsätzlich « diskreditiert ». Befindet man sich in der « gefährlichen », da instabilen, Lage eines Diskreditier baren, in die jeder von uns unweigerlich mehrmals in seinem Leben gerät, so wendet man wirksame Strategien und Techniken an, die verhindern sollen, dass das Stigma für die soziale Umgebung sichtbar wird. Stigma-Management[13] nennt Goffman das Prinzip, dass uns dazu befähigt, mit Hilfe verschiedener Verfahren der Täuschung und Manipulation den Eindruck zu erwecken, als seien wir von jeglichem Stigma befreit und als hätten wir keinerlei Stigmatisierung zu befürchten. Dies gilt sowohl für Personen, die aktuell unter einem evident gewordenen Stigma leiden und mit der daraus resultierenden Diffamierung zu kämpfen haben, als auch für alle anderen, die sich vor der Gefahr einer Marginalisierung schützen wollen. Somit wird der Grad der Visibilität[14] unseres Stigmas möglichst gering gehalten, wenn nötig auch mit Hilfe direkter oder indirekter « Korrekturmaßnahmen »[15], um keine Annäherung an die sozial herabgesetzte Position eines Diskreditierten zu riskieren[16]. Gemäß Goffmans Konzept einer « symbolischen Interaktion » betreibt somit jeder von uns zum Selbstschutz in identitätskritischen Momenten das, teilweise auch von « Professionellen » gelehrte, Verfahren der Eindrucksmanipulation[17]. So können die flüchtigen (Zeichen) und institutionalisierten Zeichen (Symbole), die wir –mal mehr und mal weniger bewusst- unserem sozialen Umfeld zur Verfügung stellen, um sie von ihm « lesen » und deuten zu lassen, gezielt zur Täuschung des von uns vermittelten Bildes eingesetzt werden. Während Goffman bei diskreditierten Personen von einer « Täuschung » spricht, fasst er die Maßnahmen eines « diskreditierbaren » Individuums, die dieses unternimmt, um der Aufdringlichkeit seines noch unentdeckten Stigmas entgegenzuwirken, unter dem Terminus der « Informationskontrolle» zusammen.
[...]
[1] Im Folgenden wird die im Suhrkamp-Verlag erschienene deutsche Ausgabe verwendet: Goffman, Erving: Stigma- Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt/ Main 1967.
[2] Das griech. Etymon „Stigma“ bezeichnet „körperliche Zeichen, die etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers offenbaren“. (Vgl. Goffman, Erving: Stigma, S. 9) Wie sich später zeigen wird, fasst Goffman den Begriff „Stigma“ weiter und sieht Stigmatisierung als ein abstraktes Resultat von Interaktion an.
[3] Vgl. Stigma, S. 7.
[4] Ebd.
[5] Vgl. Stigma, S. 10.
[6] Ebd.
[7] An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die von Goffman angenommene Dichotomie von stigmatisiert- normal (nicht nur aus heutiger Sicht) fragwürdig ist, da er völlig selbstverständlich sich selbst zu den „Normalen“ zählt ebenso wie seine gesamte Leserschaft: „Uns und diejenigen, die von den jeweils in Frage stehenden Erwartungen nicht abweichen, werde ich die Normalen nennen.“, vgl. Stigma, S. 13. Außerdem widerspricht diese Aussage der an späterer Stelle von Goffman selbst relativierten Bedeutung der Bezeichnung „stigmatisiert“, wo er zu dem definitorischen Ergebnis kommt, dass jede Person im Laufe ihres Lebens unweigerlich in beiden „Rollen“, in der des Stigmatisierten und der des Normalen, Erfahrungen machen wird. (Vgl. Stigma, S. 161f.).
[8] Vgl. Stigma, S. 56ff.
[9] Vgl. Stigma, S. 64-67.
[10] Er gibt auch an, dass aus diesen Stigmata diskreditierbare Eigenschaften wie Homosexualität oder Arbeitslosigkeit resultieren können (vgl. Stigma, S. 12f.). Hierbei ist anzumerken, dass der Grad an Diskreditierbarkeit der hier erwähnten Eigenschaften sicherlich in damaliger Zeit um einiges größer war als heutzutage und der Besitz einer dieser Eigenschaften weitaus fatalere Folgen für die Identität und Handlungsoptionen der Stigmatisierten hatte.
[11] Vgl. Stigma, S. 13. Goffman spricht im Zusammenhang mit den „phylogenetischen Stigmata“ von der Tatsache, dass diese i.d.R. an spätere Generationen weitergegeben werden, sodass alle Familienmitglieder in gleicher Weise „kontaminiert“ sind (im Sinne einer „Verschmutzung“, „Verseuchung“), vgl. Stigma, S. 13. Diese Wortwahl ebenso wie der Gebrauch solcher Wörter wie z.B. „Rasse“, „Neger“, „Krüppel“, gilt aus heutiger Sicht als radikal diskriminierend.
[12] Dass es sich entsprechend der Theater-Metaphorik Goffmans um zwei verschiedene „Rollen“ handelt, geht bspw. aus folgendem Satz hervor: „Man kann […] vermuten, daß die Rolle „normal“ und die Rolle „stigmatisiert“ Teile des gleichen Komplexes sind, Zuschnitte des gleichen Standardstoffes.“ (vgl. Stigma, S. 161).
[13] Der Oberbegriff für das Prinzip des Lenkens und Täuschens innerhalb sozialer Interaktion lautet bei Goffman „Impression Managament“; ein Begriff, der auch in anderen Werken immer wieder Verwendung findet.
[14] Vgl. Stigma, S. 64-67. Goffman schlägt anstelle des Begriffs „Visibilität“, den er selbst in Bezug auf Stigmata wie Stottern für „irreführend“ hält (vgl. Stigma, S. 64), den Terminus „Evidenz“ vor, benutzt „Visibilität“ aber trotzdem weiter, ohne dafür eine plausible Begründung zu liefern.
[15] Eine direkte Korrekturmaßnahme wäre bspw. eine Operation im Falle einer körperlichen Verunstaltung, eine indirekte Maßnahme z.B. das Wiedererlernen bestimmter Fähigkeiten nach einem Unfall o.Ä., vgl. Stigma, S. 18f.
[16] Goffman beschreibt, dass sogar nicht selbst stigmatisierte Personen, die eng mit einem Stigmatisierten in Verbindung stehen, durch die bloße Bekanntschaft dieser Person in Misskredit geraten können: „Im allgemeinen liefert die Tendenz eines Stigmas, sich von dem stigmatisierten Individuum auf seine nahen Beziehungen auszubreiten, einen Grund dafür, warum solche Verbindungen vermieden oder, wo sie existieren, abgebrochen werden.“ (vgl. Stigma, S. 43). Eine sehr radikale Aussage Goffmans, die durch das gewählte Vokabular (er spricht von der „Ausbreitung“ eines Stigmas wie von einer ansteckenden Krankheit oder Epidemie) noch forciert wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text ist eine Analyse von Erving Goffmans Buch "Stigma" (1963) und befasst sich mit der gesellschaftlichen Marginalisierung und dem Umgang mit Eigenschaften, die von den sozial etablierten Erwartungen abweichen. Es werden die Konzepte der sozialen und persönlichen Identität im Kontext von Stigmatisierung untersucht.
Was sind die zentralen Begriffe, die in Bezug auf Identität diskutiert werden?
Die zentralen Begriffe sind "Soziale Identität" (normative Erwartungen und Kategorisierungen beim ersten Eindruck), "aktuale soziale Identität" (reale Zugehörigkeit zu einer Personenkategorie), "virtuelle soziale Identität" (stereotypische Erwartungen), "diskreditiert" (Personen, die aufgrund ihres Stigmas diffamiert werden), und "diskreditierbar" (Personen, die ein Stigma verbergen können). Zudem wird der Begriff "persönliche Identität" im Kontext von Informationskontrolle erläutert.
Was versteht Goffman unter "Stigma"?
Goffman definiert "Stigma" als ein Attribut, das eine Diskrepanz zwischen der virtualen und aktualen sozialen Identität einer Person auslöst und zu einer negativen Bewertung oder Diskreditierung führt.
Welche Arten von Stigmata werden genannt?
Goffman unterscheidet drei Typen von Stigmata: physische Deformationen, "individuelle Charakterfehler" (wie Willensschwäche oder "unnatürliche Leidenschaften"), und "phylogenetische Stigmata der Rasse, Nation und Religion".
Was ist "Stigma-Management"?
"Stigma-Management" bezeichnet die Strategien und Techniken, die eingesetzt werden, um den Eindruck zu erwecken, als sei man von jeglichem Stigma befreit und habe keinerlei Stigmatisierung zu befürchten. Es beinhaltet Täuschung und Manipulation zur Kontrolle des vermittelten Bildes.
Was bedeutet "Informationskontrolle" im Zusammenhang mit Stigma?
"Informationskontrolle" bezieht sich auf die Maßnahmen, die ein "diskreditierbares" Individuum ergreift, um die Aufdringlichkeit seines noch unentdeckten Stigmas zu verhindern und dessen Sichtbarkeit zu minimieren.
Welche Kritik wird an Goffmans Konzept geäußert?
Die Dichotomie von "stigmatisiert" und "normal" wird als fragwürdig kritisiert, da Goffman sich selbst und seine Leserschaft selbstverständlich zu den "Normalen" zählt. Außerdem wird auf die veränderte Wahrnehmung und Bewertung bestimmter Eigenschaften (z.B. Homosexualität oder Arbeitslosigkeit) im Vergleich zu Goffmans Zeit hingewiesen.
Inwiefern ist die Theater-Metaphorik für Goffmans Ansatz relevant?
Goffman verwendet eine Theater-Metaphorik, um soziale Interaktion als eine Art Aufführung darzustellen, bei der Individuen verschiedene "Rollen" einnehmen und versuchen, einen bestimmten Eindruck auf ihr Publikum zu machen. "Stigma" wird so zu einer möglichen Abweichung von der erwarteten Rolle.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119361