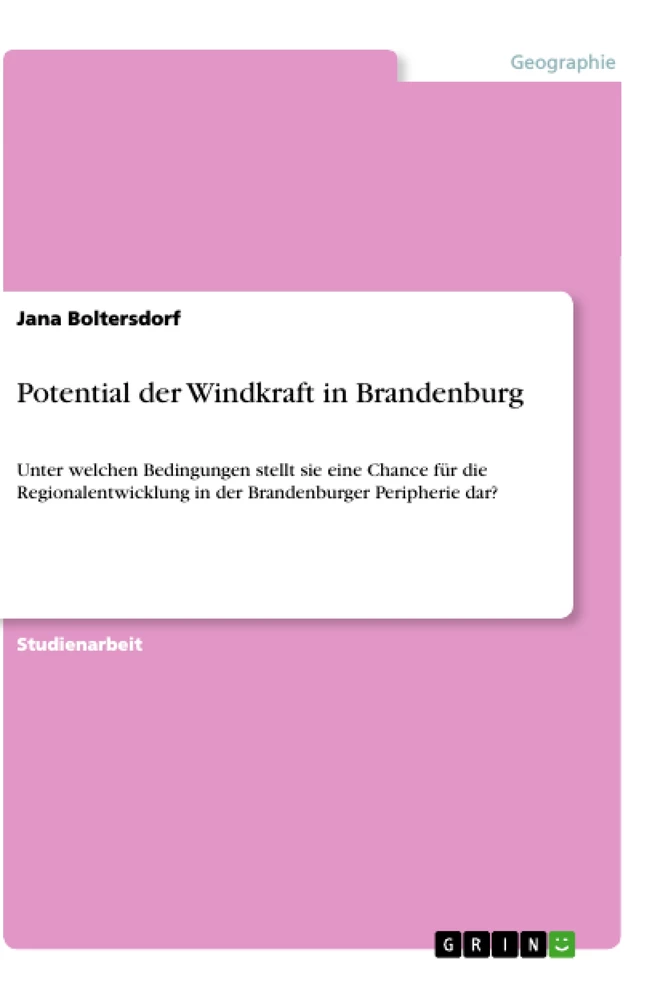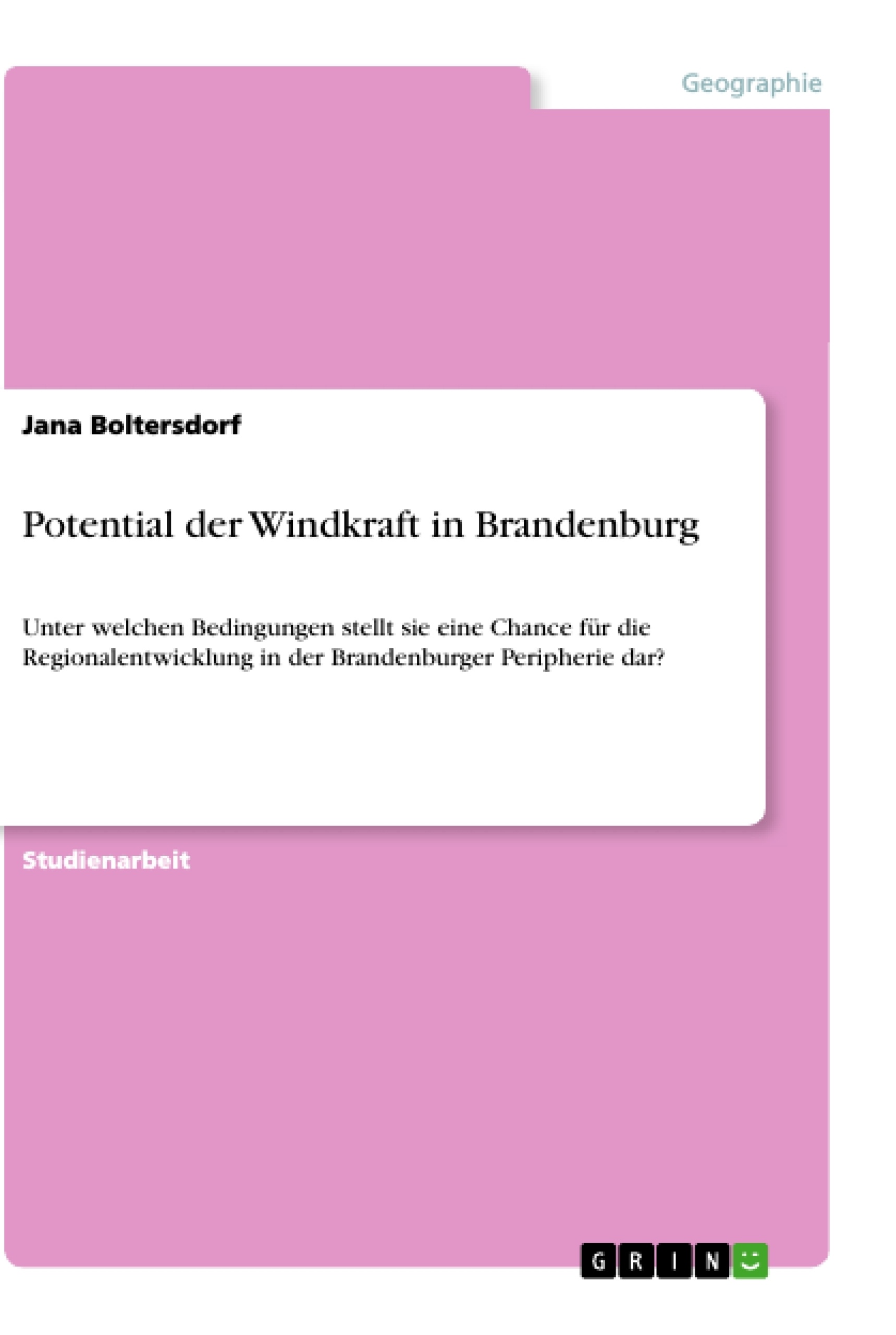Ziel dieser Arbeit ist es, herauszuarbeiten, unter welchen Umständen die fortschreitende Energiewende und der damit verbundene Ausbau der Windkraft für die peripheren Räume in Brandenburg als Chance für die Regionalentwicklung betrachtet werden kann.
Hierbei ist es notwendig, zunächst den Begriff der Peripherie kritisch zu diskutieren und zu erläutern. Anschließend soll die Regionalentwicklung in Brandenburg charakterisiert werden. Daraufhin müssen das Potential der Windkraft vor Ort und entstehende Zielkonflikte umrissen und diskutiert werden. Es handelt sich entsprechend um eine literaturbasierte Arbeit, bei der konzeptionell-empirisch die Region Brandenburg vor der theoretischen Konzeption des Peripheriebegriffes behandelt wird.
Wie in allen neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, ist auch der periphere Raum in Brandenburg nach wie vor durch große wirtschaftliche und demografische Probleme geprägt. Weite Schrumpfungsregionen in Brandenburg zeichnen sich durch mangelnde Innovationskapazität, mangelnde Agglomerationsvorteile und eine damit verbundene selektive Abwanderung und Überalterung aus.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Der Begriff der Peripherie
2.2 Regionalentwicklung in Brandenburg
2.3 Potential der Windkraft in Brandenburg
2.4 Die Notwendigkeit der Beteiligung
3. Fazit und Diskussion
4. Literaturverzeichnis
5. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
„Mit der Energiewende sind in Deutschland wesentliche Rahmenbedingungen für Raumentwicklung auf örtlicher wie auch auf überörtlicher Ebene in Fluss geraten. Denn damit sind materiell-technische, rechtliche und soziale Veränderungsprozesse angestoßen worden.“ (Domhardt, Grotheer, Wohland 2018: 345).
Wie in allen neuen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland, ist auch der periphere Raum in Brandenburg nach wie vor durch große wirtschaftliche und demografische Probleme geprägt. Weite Schrumpfungsregionen in Brandenburg zeichnen sich durch mangelnde Innovationskapazität, mangelnde Agglomerationsvorteile und eine damit verbundene selektive Abwanderung und Überalterung aus (MARETz- KE 2009: 224). Es lässt sich ein durch starke Disparitäten geprägtes Spannungsverhältnis zwischen dem Agglomerationsraum Berlin und dem extrem dünn besiedelten ländlichen Raum ausmachen, wobei Letzterer als Raum mit großen Entwicklungsschwierigkeiten charakterisiert werden kann (BoGAI, WIETHÖLTER 2005: 15).
Insbesondere in diesen ländlichen Gebieten ist aufgrund der vorhandenen Fläche aber auch eine große Standortgunst bezogen auf Windkraftanlagen gegeben. Brandenburg belegt bei der Nutzung von Windenergie den Platz 2 unter den Bundesländern. 1,4 Prozent der ansässigen Unternehmen sind hier bereits in Branchen der erneuerbaren Energien tätig (KLEIN 2012: 7).
Bei der Umsetzung der Energiewende in Brandenburg und dem Bau von Windkraftanlagen im Besonderen, stehen Zielkonflikte und Konfliktpotential, „Leuchtturmprojekten“, wie dem energieautarken Dorf Feldheim gegenüber.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, herauszuarbeiten unter welchen Umständen die fortschreitende Energiewende und der damit verbundene Ausbau der Windkraft für die peripheren Räume in Brandenburg als Chance für die Regionalentwicklung betrachtet werden kann.
Hierbei ist es notwendig, zunächst den Begriff der Peripherie kritisch zu diskutieren und zu erläutern. Anschließend soll die Regionalentwicklung in Brandenburg charakterisiert werden. Daraufhin müssen das Potential der Windkraft vor ort und entstehende zielkonflikte umrissen und diskutiert werden.
Es handelt sich entsprechend um eine literaturbasierte Arbeit, bei der konzeptionellempirisch die Region Brandenburg vor der theoretischen Konzeption des Peripher- riebegriffes behandelt wird.
2.1 Der Begriff der Peripherie
Der Begriff der Peripherie ist angesichts seiner Mehrdimensionalität keineswegs trivial. Die Bedeutung von peripheria (Kreislinie) im lateinischen indiziert, dass es sich bei dem Begriff der Peripherie immer um eine relationale Zuschreibung handelt, die das Vorhandenseins eines Zentrums bedingt (LANG 2018: 1688). Zentrum und Peripherie stehen unmittelbar miteinander in Wechselwirkung und stellen die Verräumli- chung sozialer Ungleichheiten dar (HEINTEL 1999: 257). „In abstract terms, a periphery is a boundary or outer part of any space or body.“ (De SOUZA 2018: 27).
Insbesondere in der Geographie wird die Peripherie hierbei häufig noch auf Basis rein geographischer Faktoren bestimmt. Ob eine Lage peripher ist oder nicht, wird entsprechend des Zentrum-Peripherie-Modells durch die Entfernung zum nächsten Zentrum definiert. Insbesondere die accessibility (Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Infrastruktur) spielt zudem eine Rolle (BEETZ 2008: 563).
Die Zuschreibung von statisch-geographischen Zentrum-Peripherie-Relationen wird dem mehrdimensionalen Charakter des Begriffes allerdings häufig nicht (mehr) gerecht, zumal „Peripherisierung, verstanden als ein sozialräumlicher Abstiegsprozess, der mit Bedeutungs- und Funktionsverlusten einhergeht, nicht nur ländliche Regionen“ (Kühn 2016: 14) betrifft. Peripherie ist somit ein funktionaler und dynamischer Raumbegriff, der weit mehr umfasst als die räumliche Lage einer Region. Peripherie wird vielmehr als eine Rolle und Funktion im Wirtschaftssystem definiert (KüHN 2016: 61). Nach dem Ansatz der „aspatial peripherally“ wird insbesondere in der sozialwissenschaftlichen Raumforschung zunehmend die Wichtigkeit nichtgeographischer Faktoren wie z.B. die Netzwerkbildung zwischen Akteuren für den Status der Peripherie betont (Lindner ET AL. 2005: 4). „The structure of the periphery has been shown to be dynamic rather than fixed.“ (De SOUZA 2018: 30). Die zunehmende Erkenntnis über den dynamischen Charakter peripherer Regionen bietet die Möglichkeit der Abstiegs- und Aufstiegsprozesse peripherer bzw. nicht peripherer Regionen. Eine periphere Region bleibt also nicht zwangsläufig peripher. Insbesondere der Aufstieg von einigen ehemals rural-peripheren Agrarregionen in Tourismusgebiete ist hier beispielhaft zu nennen (KüHN 2016: 61).
Der Begriff der Peripherie ist zusammenfassend also doppeldeutig definierbar: Als geographische Randlage oder als gesellschaftliche Randposition im sozialwissenschaftlichen Verständnis (LINDNER ET AL. 2005: 4).
Insgesamt ist die Peripherie ein Sammelbegriff für unterschiedliche Raumtypen, die sich durch strukturelle Bedingungskonstellationen auszeichnen, die mit Benachteil i- gungen für betroffene Gebiete einhergehen. Hierbei spielt der Zugang zu Infrastruktur, Informationen und Gütern, das Nicht-Vorhandensein von Agglomerations- und Innovationsvorteilen, die selektive Abwanderung, sowie das Fehlen von wirtschaftlicher Dynamik und Wachstum eine Rolle (BEETZ 2008: 567). Gleichzeitig ist auch der „Ausschluß von den jeweils dominierenden Machtressourcen sowie [die] mangelnden Möglichkeit, Fähigkeit oder Bereitschaft zur Bildung von Gegenmacht“ (KRECKEL 2004: 44) beim Peripherisierungsprozess bedeutsam - es bildet sich eine Ungleichverteilung gesellschaftlicher Macht (KÜHN 2016: 66). „Peripherie“ ist also ein Begriff, der die räumliche Dimension sozialer Ungleichheiten multiskalar beschreibt und verschiedene Raumtypen zulässt.
Bei den in dieser Arbeit betrachteten Regionen Brandenburgs, handelt es sich um den Raumtypus der ländlichen Peripherie. Hier spielt insbesondere die „graduelle Schwächung und/oder Abkopplung sozial-räumlicher Entwicklungen gegenüber den dominanten Zentralisierungsvorgängen“ (KÜHN 2006: 68f) eine wichtige Rolle. Der Prozess der Peripherisierung zeichnet sich hier also durch das „Abgehängtsein“ gegenüber Zentren aus. Es muss an dieser Stelle jedoch noch einmal erwähnt werden, dass insbesondere die Debatte um „shrinking cities“ als „one of the symptoms of globalization“ (Martinez-Fernandez et al. 2011: 214), zeigt, dass ebenso in urbanen Räumen Peripherisierungsprozesse stattfinden können. Bei der ländlichen Peripherie handelt es sich also nur um eine spezifische Ausprägung des Modells der Peripherie (Beetz 2008: 565). In der weiteren Abhandlung wird der Begriff der Peripherie also nur scheinbar mit dem Begriff der Ruralität gleichgesetzt.
Zu beachten ist zuletzt der multiskalare Charakter der Peripherien. Periphere Räume können auf globaler, interkontinentaler, nationaler, lokaler und regionaler Ebene betrachtet werden. Für benachteiligte Räume auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene wird auch der Begriff der inneren Peripherie verwendet (LANG 2018: 1688). Um eine innere Peripherie handelt es sich auch bei dem Raumtypus der ruralperipheren Lage vieler Brandenburger Regionen.
2.2 Regionalentwicklung in Brandenburg
Brandenburg ist mit Berlin als Bundeshauptstadt und Oberzentrum, sowie mit einem gleichzeitig räumlich weit ausgedehnten ländlichen Raum, von starken regionalen Disparitäten geprägt (BRENNER 2002: 12).
Das Bundesland Brandenburg und insbesondere die randliche Peripherie des Landes ist wie alle neuen Bundesländer, nach wie vor durch große wirtschaftliche Entwicklungsprobleme gekennzeichnet, die sich unter anderem in einer hohen Arbeitslosenquote und einem unterdurchschnittlichen BIP1 niederschlagen (ELLGER 2000: 66f). Der ländliche Raum im Besonderen, der in weiten Teilen Brandenburgs eine extrem geringe Bevölkerungsdichte und entsprechend eine geringe Dichte an Arbeitsplätzen und Bildungs- sowie Forschungseinrichtungen aufweist, kann insgesamt generalisierend als Region mit großen Entwicklungsproblemen betrachtet werden. (BOGAI, WIETHöLTER 2005: 15).
Auch wenn sich die Arbeitslosenquote in Brandenburg in den letzten Jahren und Jahrzehnten an den Bundesdurchschnitt angenähert hat (Amt für Statistik Berlin- Brandenburg), wird in Abbildung 1 deutlich, dass sie 2010 nach wie vor signifikant über dem Bundesdurchschnitt lag. Zudem sind zwischen dem Berliner Umland sowie den ländlichen Randregionen Brandenburgs regionale Disparitäten zu erkennen.
Eine Ursache, wieso weltweit ländliche Räume entwicklungstechnisch oft hinter Agglomerationsräumen zurückbleiben (BRENKE, ZIMMERMANN 2009: 32), ist das Fehlen von ausreichender öffentlicher Infrastruktur und Agglomerationsvorteilen, die sich häufig aus einer hohen Bevölkerungsdichte ergeben.
Anmerkung der Redaktion: Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Abb. 1: Arbeitslosenquote in Brandenburg und Berlin im Oktober 2010
Formal gliedert Brandenburg sich in 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte. Das Land ist mit einer Fläche von 29.477 km2 zwar das größte neue Bundesland, weist jedoch mit einer Gesamtbevölkerung von 2,57 Millionen eine besonders geringe Bevölkerungsdichte auf (87 Einwohner pro km2) (BOGAI, WIETHÖLTER 2005: 13f). Abbildung 2 verdeutlicht die geringe Bevölkerungsdichte in ländlichen Regionen außerhalb des Agglomerationsraumes Berlin.
Anmerkung der Redaktion: Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Abb.2: Bevölkerungsdichte in Brandenburg 2010
Seit 2001 nimmt die Bevölkerung zudem insbesondere in peripheren Regionen wanderungsbedingt weiter ab (BOGAI, WIETHÖLTER 2005: 13f). Dies reiht sich ein in die Beobachtung, dass ländliche, ostdeutsche Räume generell einen Bevölkerungsrückgang aufweisen. Die Abwanderung in Brandenburg ist weiterhin stark selektiv, was zur Gefährdung der Tragfähigkeit von Infrastruktur einerseits und zu einer Überalterung andererseits führt (ELLGER 2000: 66f). Es ist eine negative demografische Entwicklung erkennbar, was auch die zukünftige Wirtschaftlichkeit der Regionen gefährden kann:
Die wirtschaftliche Entwicklung einer Region hängt nach der traditionellen Standorttheorie maßgeblich mit dem Standortpotential zusammen, das auch durch das Vorhandensein von Humankapital bestimmt wird (BOGAI, WIETHÖLTER 2005: 34). Die Akkumulation von Wissen spielt somit eine bedeutende Rolle beim wirtschaftlichen Aufholprozess strukturschwacher Regionen. In Brandenburg liegt der Anteil der Hochqualifizierten um 0,58 Prozentpunkte unter dem ostdeutschen Mittelwert (BOGAI, WIETHöLTER 2005: 34). Insbesondere die von Berlin weit entfernten Landkreise und alle kreisfreien Städte weisen negative Standorteffekte auf (BOGAI, WIET- HöLTER 2005: 37). Die selektive Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte könnte entsprechend weitere negative Rückkopplungseffekte haben, die das Standortpotential der Region weiter verringern.
Die Regionalentwicklung in Brandenburg insgesamt lässt sich als klar bipolar einordnen: „Eine deutliche Diskrepanz zwischen dem metropolitanen Innenraum einerseits und der strukturschwachen ländlichen Peripherie andererseits“ (Ellger 2000: 64) ist erkennbar.
2.3 Potential der Windkraft in Brandenburg
Der Raumtypus der ländlichen Peripherie, in den weite Teile Brandenburgs einzuordnen sind, sollte aufgrund des Beitrags, den er „für nationale oder supranationale Subsistenzstrategien hinsichtlich natürlicher Ressourcen und der stofflichen sowie energetischen Primärproduktion“ (Beetz 2008: 573) leistet, nicht unterschätzt werden. Die vermeintliche „Leere“ ländlicher Peripherien kann von neuen Raumpionieren, wie z.B. von Investmentfonds für Windräder nutzbar gemacht werden und eine Aufwertung des Raumes bzw. einen wirtschaftlichen Aufstieg nach sich ziehen (BEETZ 2008: 573). Durch ihre Dringlichkeit, Zukunftsfähigkeit und Innovationswirkung, ist insbesondere die Energiewende eine Chance für die Regionalentwicklung strukturschwacher Regionen, die größer ist als viele andere Ansätze, die oft ausschließlich auf dem Konzept der nachholenden Entwicklung basieren (NöLTING ET AL. 2011: 222).
Zu beachten ist hier allerdings, inwieweit die neuen Innovationen zur regionalen, nachhaltigen Wertschöpfungskette beitragen und ob die Menschen vor Ort profitieren und partizipieren können.
Brandenburg belegt derzeit Platz 2 unter den Bundesländern bezogen auf die Menge und Nutzung von Windrädern. Zwei Prozent der Fläche Brandenburgs sind als Windkrafteignungsgebiete ausgewiesen (KLEIN 2012: 31). Ende 2014 existierten in Brandenburg rund 3.300 Windenergieanlagen mit knapp 5.500 MW installierter Leistung (SCHWARZ, ZILLES 2015: 603). 1,4 Prozent der hier ansässigen Unternehmen sind bereits in der Branche der erneuerbaren Energien tätig (KLEIN 2012: 7). Das Land Brandenburg belegt entsprechend eine Vorreiterrolle, bezogen auf die Energiewende und weist hohe Flächennutzungspotentiale als Standort für Windräder auf. Bezogen auf Anstrengungen und Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien generell, ist Brandenburg laut der Leitstemstudie (2010) sogar Spitzenreiter unter den Bundesländern (KEPPLER, NÖLTING 2011: 100).
Die Regionen und Bürger*Innen vor Ort profitieren von dem Ausbau der Windkraft durch Arbeitsplätze, Einkommen und eine langfristige Berufsperspektive in einem zukunftsfähigen Sektor (KEPPLER ET AL. 2011: 34). Der ostdeutsche Raum ist nicht nur eine Region „der es nicht nur an wirtschaftlicher Leistungskraft, sondern überwiegend auch an zukunftsfähigen Entwicklungspotentialen mangelt“ (BUSCH 2006: 20). Von der Energiewende kann entsprechend eine Innovationskraft ausgehen, die in der ostdeutschen Region und insbesondere in der Brandenburger Peripherie fehlt. Darüber hinaus kann die lokale Wertschöpfung durch finanzielle Beteiligungskonzepte profitieren. Einzelnen Kommunen steht so mehr Geld zur Verfügung, das für öffentliche Investitionen genutzt werden kann, die aufgrund der eingangs erwähnten wirtschaftlichen Probleme häufig fehlen. Akteure aus Architektur, Energieversorgung, Verkehr und aus dem Handwerk können weiterhin an dem Ausbau der Windkraft beteiligt werden, was weitere ökonomische Vorteile verspricht (WALK, NÖLTING, KEPPLER 2011: 59).
Die Energiewende in Brandenburg ist durch eine Vielzahl an heterogener werdenden Akteuren gekennzeichnet, aus denen sich entsprechend eine Vielzahl von möglichen Entwicklungspfaden ergibt (BECKER, GAILING, NAUMANN 2012: 30). Diese Akteure umfassen Kommunen, Planungsregionen, Zivilgesellschaft und Unternehmen. Die Menge an hier entstehenden unterschiedlichen Interessenskonstellationen ist auch ein Grund dafür, wieso das Konfliktpotential bezogen auf den Ausbau der Windkraft in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Die Landschaft der Windkraft in Brandenburg reicht entsprechend von Projekten zum Überleben eines Dorfes bis hin zu industriellen Clustern. Insbesondere kleine Projekte im Bereich von erneuerbaren Energien und Windkraft stehen meist im Zusammenhang mit lokalen Initiativen „von unten“ (KEPPLER, NÖLTING 2011: 109). Diese erreichen häufig eine besondere Strahlkraft, wie das folgende Positivbeispiel zeigt:
Als „energiepolitisches Schaufenster“ mit inzwischen überregionaler Bedeutung kann die Gemeinde Feldheim im Landkreis Potsdam-Mittelmark angeführt werden, die als eine der ersten energieautarken Gemeinden der Bundesrepublik gilt (BECKER, GAILING, NAUMANN 2012: 26). Unter anderem tragen 49 Windenergieanlagen zu der energetischen Unabhängigkeit der Gemeinde bei. Der Bau der Windräder wurde von engagierten Bürger*Innen lokal umgesetzt. Durch die Schaffung von Partizipations - und finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten der Anwohner*Innen gab und gibt es keinen aktiven Widerstand gegen das Projekt (BAH 2016: 76). Inzwischen ist durch die Initiative nicht nur ein neues wirtschaftliches Standbein in der Region entstanden, das durch die Schaffung von Arbeitsplätzen gegen den negativen demografischen Wandel wirkt (BAH 2016: 76), Feldheim ist durch die Errichtung eines Forschungsund Bildungszentrum für erneuerbare Energien im ländlichen Raum zudem zu einem Ort der Innovation in einer zukunftsfähigen Branche geworden (BAH 2016: 74). Diese Form der Selbstbestimmung und Demokratisierung des Energiesektors kommt einem Paradigmenwechsel gleich, durch den Kommunen „von abhängigen Energiekonsumenten zu selbstbestimmten Produzenten werden.“ (Nölting ET AL. 2011: 227).
Auch andere Positivbeispiele, wie das der sächsischen Gemeinde Zschadraß, verdeutlichen das Potential der regionalen Energiewende in der ostdeutschen Peripherie : Ein hier erbautes Windrad finanziert durch seine Erträge eine örtliche Kindertagesstätte und konnte unter dieser Bedingung konfliktfrei errichtet werden (WALK, NöLTING, KEPPLER 2011: 65). Die Menschen und die Regionalentwicklung vor Ort profitieren.
Es wird deutlich, dass durch eine zunehmende Dezentralisierung des Energiesektors, wie z.B. durch den Ausbau von Windkraft erzielt, die Einflussmöglichkeiten der Menschen vor Ort steigen und bei richtiger Umsetzung so, neben den erwarteten Vorteilen für die lokale Wertschöpfung, ein Demokratisierungsimpuls von der Energiewende ausgehen kann (RADTKE ET AL. 2018: 24), durch den auch zivilgesellschaftliches Engagement gefördert werden kann. Zwar fügen sich dezentrale Initiativen ohne Gesamtkonzept nicht automatisch zur einer gemeinwohlorientierten Energiewende in Ostdeutschland zusammen, doch können solche Projekte Vorbildfunktionen entfalten.
Die Energiewende darf hierbei also nicht nur aus klimapolitischer Sicht betrachtet werden. ökologie und Soziales dürfen und müssen nicht gegeneinander ausgespielt werden: Vielmehr birgt die Energiewende das Potential, die Lebensqualität der Menschen in ländlich-peripherer Lage zu verbessern, die Regionalentwicklung anzukurbeln und positive Identifikationsmöglichkeiten zu bieten (ZöLLNER ET AL. 2011: 199). Kommunen können den Ausbau der Windkraft also an regionalpolitische Ziele knüpfen, die bisher kaum im Fokus der Energiewende standen (BECKER, GAILING, NAUMANN 2013: 30).
2.4. Die Notwendigkeit der Beteiligung
Trotz der großen Eignung des ländlichen Raumes in Brandenburg und den positiven Entwicklungen, die eine regionale, auf Windkraft basierende Energiewende bieten kann, fällt die Akzeptanz gegenüber Windkraftanlagen in der direkten Nachbarschaft mit 65 Prozent in Brandenburg überdurchschnittlich gering aus (KLEIN 2012: 32). Die Unzufriedenheit der Bevölkerung und die Protestaktivitäten in Brandenburg gegen den Bau von Windkraftanlagen nehmen quantitativ und qualitativ zu (EICHENAUER 2018: 316). Proteste und Klagen gehen hierbei häufig über die Eigenmotivation, die sich aus eigener Betroffenheit ergibt, oder den Naturschutz hinaus: Stattdessen wird aus einer als mangelhaft wahrgenommenen Politik das Fazit geschlossen, selbst Verantwortung für den eigenen Nahraum übernehmen zu müssen (SCHWARZ, ZILLES 2015: 678). Die geringe Akzeptanz kann Brandenburg in seiner Vorreiterrolle in der Energiewende gefährden.
Eine mögliche Ursache für die geringe Akzeptanz: „Die Bevölkerung zieht bisher in der Regel keinen unmittelbaren Nutzen aus steuerlichen Mehreinnahmen durch erneuerbare Energien in ihrer näheren Umgebung.“ (KLEIN 2012: 32). Für das Generieren von aktiver Akzeptanz belegen zahlreiche Studien die Unerlässlichkeit von gerechten Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen vor Ort (BECKER, GAILING, NAUMANN 2013: 27). Obwohl klar ist, dass es sich bei der Energiewende in Deutschland um eine hochkomplexe Frage handelt, die zahlreiche Zielkonflikte mit sich führt (RADTKE ET AL. 2018: 27), gibt es zwei Möglichkeiten, die Akzeptanz für die regionale Energiewende vor Ort zu steigern. Einerseits durch eine Vielzahl professioneller und zielgruppenadäquater Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten für die Menschen vor Ort (WALK, NÖLTING, KEPPLER 2011: 60f) und andererseits durch finanzielle Beteiligungskonzepte, damit die Bürger*Innen nicht nur die Nachteile der Windkraft wie z.B. die Veränderung des Landschaftsbildes ertragen müssen, sondern von diesen Veränderungen auch aktiv profitieren können. Dies wurde im vorherigen Kapitel am Beispiel von Feldheim und Zschadraß deutlich gemacht.
Bis in die jüngste Vergangenheit wurde die Energieerzeugung in Brandenburg von einer relativ kleinen Anzahl großer Unternehmen bestimmt (RADTKE ET AL. 2018: 24), wobei die Aspekte von Akzeptanz und Teilhabe auf Landesebene eine eher untergeordnete Rolle spielten und spielen (NÖLTING ET AL. 2011: 227). Die Bevölkerung vor Ort wird übergangen. Derart negative Erfahrungen mit dem aktuellen politischen System können schließlich in dem Eindruck resultieren, dass „die da oben sowieso machen, was sie wollen“ (Keppler et al. 2011: 194), wodurch die Chance auf einen öffnenden und mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit verbundenen Lern- und Erfahrungsprozess verbaut wird.
Es lässt sich für Brandenburg entsprechend festhalten: „Wenn Ostdeutschland lediglich als Stellfläche für die Anlagen genutzt wird, haben die Menschen weder die Chance, von diesen neuen Technologien Vorteile zu erzielen, noch können sie Einfluss auf deren Gestaltung nehmen. Das führt zu negativen Erfahrungen“ (Nölting, THOMAS, LAND 2011: 31).
Die Beteiligung der Menschen vor Ort ist somit eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende und das Schaffen von Möglichkeiten zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die sich hieraus ergeben. Natürlich bleibt trotzdem festzuhalten, dass auch eine gerechte Beteiligung keine Akzeptanz vor Ort erzwingen kann (KEPPLER ET AL. 2011: 188).
3. Fazit und Diskussion
Im peripheren, Brandenburger Raum, der aufgrund seines Standortpotentials eine Vorreiterrolle in der Energiewende entfalten kann und bereits entfaltet, muss die wirtschaftliche Regionalentwicklung vor Ort, bei der Planung und Umsetzung einer sozialen und nachhaltigen Energiewende berücksichtigt werden.
Das wurde am Beispiel der Windkraft aufgezeigt.
Eine windkraftgetragene Energiewende kann hier eine Ankurbelung der regionalen Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und kommunalen Einnahmen erwirken, sowie einen Innovations- und Demokratisierungsimpuls in peripheren Gebieten setzen. Dieses Potential können derlei Projekte aber nur unter der Voraussetzung entfalten, dass Menschen vor Ort in einem gerechten Beteiligungsprozess eingebunden werden und wenn ein finanzieller Mehrwert für diese Menschen generiert wird. Da diese Voraussetzungen auch in Brandenburg zum Teil noch sehr unzureichend erfüllt werden, verfügt die Region noch über viel bislang ungenutztes Potential.
Natürlich spielen neben der Generierung von Akzeptanz auch andere, zum Teil sehr diverse, Faktoren eine Rolle bei der Umsetzung der Energiewende, die bei weiterer Ausführung den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten und an anderer Stelle untersucht werden müssen. So darf zum Beispiel insbesondere in Brandenburg der lokale Einfluss konventioneller Energieversorgungsunternehmen nicht unterschätzt werden (NÖLTING ET AL. 2011: 227). Die Schaffung von Akzeptanz für Windkraftanlagen vor Ort wurde jedoch als eine entscheidende Bedingung herausgearbeitet.
Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass eine erfolgreiche Energiewende und der Ausbau der Windkraft sich zwar positiv auf Regionen ostdeutscher Peripherie auswirken können, jedoch nur einen kleinen Teil eines weit gefassten Maßnahmenkataloges darstellen können, wenn es darum geht, Entwicklungsproblemen in der ostdeutschen Peripherie zu begegnen. Insbesondere in dünn besiedelten, peripheren Regionen Ostdeutschlands, gibt es zudem Räume, die angesichts regionaler Polarisierungstendenzen kaum Entwicklungschancen haben (MARETZKE 2009: 236). Diese Realität darf nicht geleugnet werden.
Es sollte vielmehr aufgezeigt werden, dass die dringend umzusetzende Energiewende in Deutschland gleichzeitig einen wirtschaftlichen Beitrag für periphere Regionen leisten kann. Ökologie, Ökonomie und Soziales können hierbei unter einigen Voraussetzungen nachhaltig in Einklang gebracht werden und zu einem sozialökologischen Paradigmenwechsel beitragen.
Von Produktionsorten erneuerbarer Energien kann hierbei wirtschaftlicher Mehrwert und überregionale Strahlkraft ausgehen, wodurch insbesondere im ostdeutschen Raum eine typische Win-win-Situation entstehen kann. Eine windkraftgetragene Energiewende kann also dann als Chance für die Peripherie Brandenburgs betrachtet werden, wenn die Interessen der lokalen Bevölkerung ehrlich berücksichtigt und respektiert werden.
Literaturverzeichnis:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021): Arbeitslosenquoten (in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen), Land Brandenburg. Online verfügbar unter https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Arbeitslosenquoten zivile Erwerbspersonen.pdf. Zugriff am 04.08.2021 (Zugriff am 03.08.2021)
Bah, I. (2016): Eine Dorfgemeinschaft koppelt sich ab, S. 74 - 77. In: neue energie.
BECKER, S., GAILING, L., NAUMANN, M. (2012): Neue Akteurslandschaften der Energiewende. Aktuelle Entwicklungen in Brandenburg, S. 42 - 46. In: RaumPlanung, Heft Nr. 162. ifR, Dortmund.
BECKER, S., GAILING, L., NAUMANN, M. (2013): Die Akteure der neuen Energielandschaften - Das Beispiel Brandenburg, S. 19 - 33. In: Gailing, L., Leibenath, M. Neue Energielandschaften - Neue Perspektiven der Landschaftsforschung. Springer VS, Wiesbaden.
BEETZ, S. (2008): Die Natur der Peripherien, S. 562-576. In: REHBERG, K.: Die Natur der Gesellschaft: Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006. Campus Verlag, Frankfurt am Main.
BOGAI, D., WIETHöLTER, D. (2005): Vergleichende Analyse von Länderarbeitsmärkten: Länderstudie Brandenburg. IAB-Regional.
BRENKE, K., ZIMMERMANN, K. (2009): Ostdeutschland 20 Jahre nach dem Mauerfall: Was war und was ist heute mit der Wirtschaft?. IZA Standpunkte. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn.
BRENNER, S. (2002): Regionalentwicklung Brandenburg. Brandenburger zwischen Clusterbildung und ländlichem Raum. Diplomica Verlag GmbH.
BUSCH, U. (2006): Gesamtwirtschaftliche Stagnation und zunehmender Transferbedarf, S. 17 - 26. In: Berliner Debatte Initial Nr. 17/2006, Berlin.
DE SOUZA, P. (2018): The Rural and Peripheral in Regional Development. Routledge, New York.
DOMHARDT, H., GROTHEER, S., WOHLAND, J. (2018): Die Energiewende als Basis für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung in ländlichen Räumen, S. 345 - 368. In: KÜHNE, O., WEBER, F.: Bausteine der Energiewende. Springer VS, Tübingen.
Eichenauer, E. (2018): Energiekonflikte - Proteste gegen Windkraftanlagen als Spiegel demokratischer Defizite, S. 315 - 342. In: RADTKE, J., KERSTING, N. Energiewende. Politikwissenschaftliche Perspektiven. Springer VS.
ELLGER, C. (2000): Ländliche Peripherie statt Zwischenstadt: Entwicklungsprobleme ländlicher Räume in Ostdeutschland: das Land Brandenburg als Beispiel, S. 61 - 72. In: Geographica Helvetica, Heft Nr. 55 (2000). Berlin.
GRÜNHEID, E. (2009): Überblick über die demografische Entwicklung in West- und Ostdeutschland von 1990 bis 2004, S. 12 - 48. In: CASSENS, I., Luy, M., SCHOLZ, R. Die Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland. Demografische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen seit der Wende. VS Research.
HEINTEL, M. (1999): Zentrum, Peripherie und Grenze. Alte und neue Herausforderungen in der europäischen Raumplanungspolitik, S. 257-265. In: SWS- Rundschau 3/1999.
KEPPLER, D., GRÜTTNER, F., HIRSCHL, B., ARETZ, A., BÖTHER, T., NÖLTING, B. (2011): Mecklenburg-Vorpommern als Leitregion für wirtschaftliche Entwicklung durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Eine Studie im Auftrag der SPD Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern. TU Berlin, Berlin.
KEPPLER, D., NÖLTING, B. (2011): Stand und Rahmenbedingungen einer ostdeutschen Energiewende: Ein Überblick. In: KEPPLER, D., NÖLTING, B., SCHRÖDER, C.: Neue Energie im Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunftsfähige sozial-ökologische Energiewende. Peter Lang Verlag, TU Berlin, Berlin.
KLEIN, D. (2012): Widersprüche in der Brandenburger Energiewende. Horizonte sozialökologischer Transformation. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin.
KRECKEL, R. (2004): Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. Campus Verlag, Frankfurt am Main.
KÜHN, M. (2016): Peripherisierung und Stadt. Städtische Planungspolitiken gegen den Abstieg. Transcript Verlag, Bielefeld.
Lang, T. (2018): Peripherie/Peripherisierung, S. 1687 - 1692. In: ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung. Hannover.
LINDNER, C., LÜCKENKÖTTER, J., PANEBIANCO, S., SCHLUSEMANN, B., SPIEKERMANN, C., WEGENER, M. (2005): Aspatial Peripherality in Europe. Cartographic and statistical analyses. Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, Dortmund.
MARETZKE, S. (2009): Die Bevölkerungsentwicklung in den Regionen Deutschlands - Ein Spiegelbild der vielfältigen ökonomischen und sozialen Disparitäten, S. 223 - 260. In: Cassens, U., Luy, M., Scholz, R.: Die Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland. Demografische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen seit der Wende. VS Research, Heidelberg.
MARTINEZ-FERNANDEZ, C., AUDIRAC, I., FOL, S., CUNNINGHAM-SABOT, E. (2011): Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization, S. 213 - 225. In: International Journal of urban an regional research. Heft Nr. 36 (2012). Blackwell Publishing.
NÖLTING, B., SCHRÖDER, C., KOLLMORGEN, R., KEPPLER, D. (2011): Von der Energiewende zum sozialökologischen Pfadwechsel?: Chancen und Grenzen sozial- ökologischer Transformationen in Ostdeutschland, S. 221 - 242. In: KEPPLER, D., Nölting, B., Schröder, C.: Neue Energie im Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunftsfähige sozial-ökologische Energiewende. Peter Lang Verlag, TU Berlin, Berlin.
NöLTING, B., THOMAS, M., LAND, R. (2011): Energie im Osten. Die Energiewende als Chance für einen zukunftsfähigen Entwicklungspfad für Ostdeutschland, S. 15f. In: Keppler, D., Nölting, B., Schröder, C.: Neue Energie im Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunftsfähige sozialökologische Energiewende. Peter Lang Verlag, TU Berlin, Berlin.
RADTKE, J., CANZLER, W., SCHREURS, M., WURSTER, S. (2018): Die Energiewende in Deutschland - zwischen Partizipationschancen und Verfechtungsfalle, S. 17 - 45. In: RADTKE, J., KERSTING, N. Energiewende. Politikwissenschaftliche Perspektiven. Springer VS.
SCHWARZ, C., ZILLES, J. (2015): Bürgerproteste gegen Windkraft in Deutschland. Organisation und Handlungsstrategien, S. 669 - 679. In: Information zur Raumentwicklung, Heft Nr. 6. Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Frank Steiner Verlag, Stuttgart.
WALK, H., NöLTING, B., KEPPLER, D. (2011): Die Suche nach Wegen für eine Energiewende in Ostdeutschland: Eine Herausforderung für die sozialwissenschaftliche Energieforschung, S. 49 - 71. In: KEPPLER, D., Nölting, B., SCHRÖDER, C.: Neue Energie im Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunftsfähige sozial-ökologische Energiewende. Peter Lang Verlag, TU Berlin, Berlin.
ZöLLNER, J., KEPPLER, D., RAU, I., RUPP, J. (2011): Beteiligung als Strategie und Strukturelement einer Energiewende in Ostdeutschland, S. 178 - 206. In: Keppler, D., Nölting, B., Schröder, C.: Neue Energie im Osten - Gestaltung des Umbruchs. Perspektiven für eine zukunftsfähige sozial-ökologische Energiewende. Peter Lang Verlag, TU Berlin, Berlin.
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Arbeitslosenquote in Brandenburg und Berlin im Oktober 2010 (Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, MAZ 2012)
Abbildung 2: Bevölkerungsdichte in Brandenburg 2010 (Regio Kontext 2013)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht, unter welchen Umständen der Ausbau der Windkraft in Brandenburg eine Chance für die Regionalentwicklung darstellen kann, insbesondere in peripheren Räumen.
Was sind die Hauptthemen der Hausarbeit?
Die Hauptthemen umfassen den Begriff der Peripherie, die Regionalentwicklung in Brandenburg, das Potential der Windkraft in Brandenburg und die Notwendigkeit der Beteiligung der Bevölkerung.
Wie wird der Begriff der Peripherie definiert?
Der Begriff der Peripherie wird sowohl als geographische Randlage als auch als gesellschaftliche Randposition definiert. Es handelt sich um einen dynamischen Raumbegriff, der mehr umfasst als nur die räumliche Lage einer Region.
Wie ist die Regionalentwicklung in Brandenburg charakterisiert?
Brandenburg ist durch starke regionale Disparitäten zwischen dem Agglomerationsraum Berlin und dem ländlichen Raum geprägt. Die ländliche Peripherie weist wirtschaftliche Entwicklungsprobleme wie hohe Arbeitslosenquoten und eine geringe Bevölkerungsdichte auf.
Welches Potential hat die Windkraft in Brandenburg?
Brandenburg belegt einen Spitzenplatz bei der Nutzung von Windenergie. Der Ausbau der Windkraft kann zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommen und einer langfristigen Berufsperspektive beitragen. Kommunen und Bürger können von finanziellen Beteiligungskonzepten profitieren.
Warum ist die Beteiligung der Bevölkerung wichtig?
Die Akzeptanz von Windkraftanlagen ist in Brandenburg überdurchschnittlich gering. Gerechte Beteiligungsmöglichkeiten und finanzielle Vorteile für die Menschen vor Ort sind unerlässlich, um die Akzeptanz zu erhöhen und die regionale Wertschöpfung zu fördern.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Eine windkraftgetragene Energiewende kann eine Chance für die Peripherie Brandenburgs sein, wenn die Interessen der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden und ein finanzieller Mehrwert generiert wird.
Welche Rolle spielen Positivbeispiele wie Feldheim?
Feldheim dient als Beispiel für eine energieautarke Gemeinde, in der die Bürger aktiv am Bau von Windrädern beteiligt waren. Durch Partizipation und finanzielle Beteiligung konnte Widerstand vermieden und eine neue wirtschaftliche Basis geschaffen werden.
Was sind die Konsequenzen fehlender Beteiligung?
Fehlende Beteiligung kann zu geringer Akzeptanz und dem Eindruck führen, dass die Bevölkerung übergangen wird. Dies kann die Chancen auf einen öffnenden Lern- und Erfahrungsprozess verbauen.
- Quote paper
- Jana Boltersdorf (Author), 2021, Potential der Windkraft in Brandenburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1193118