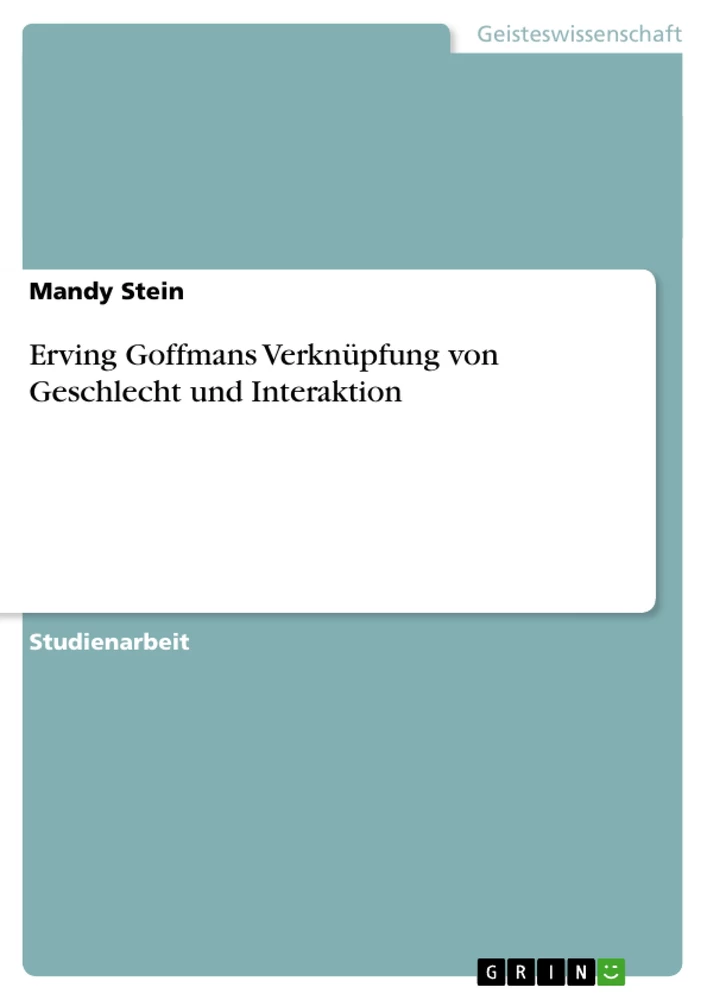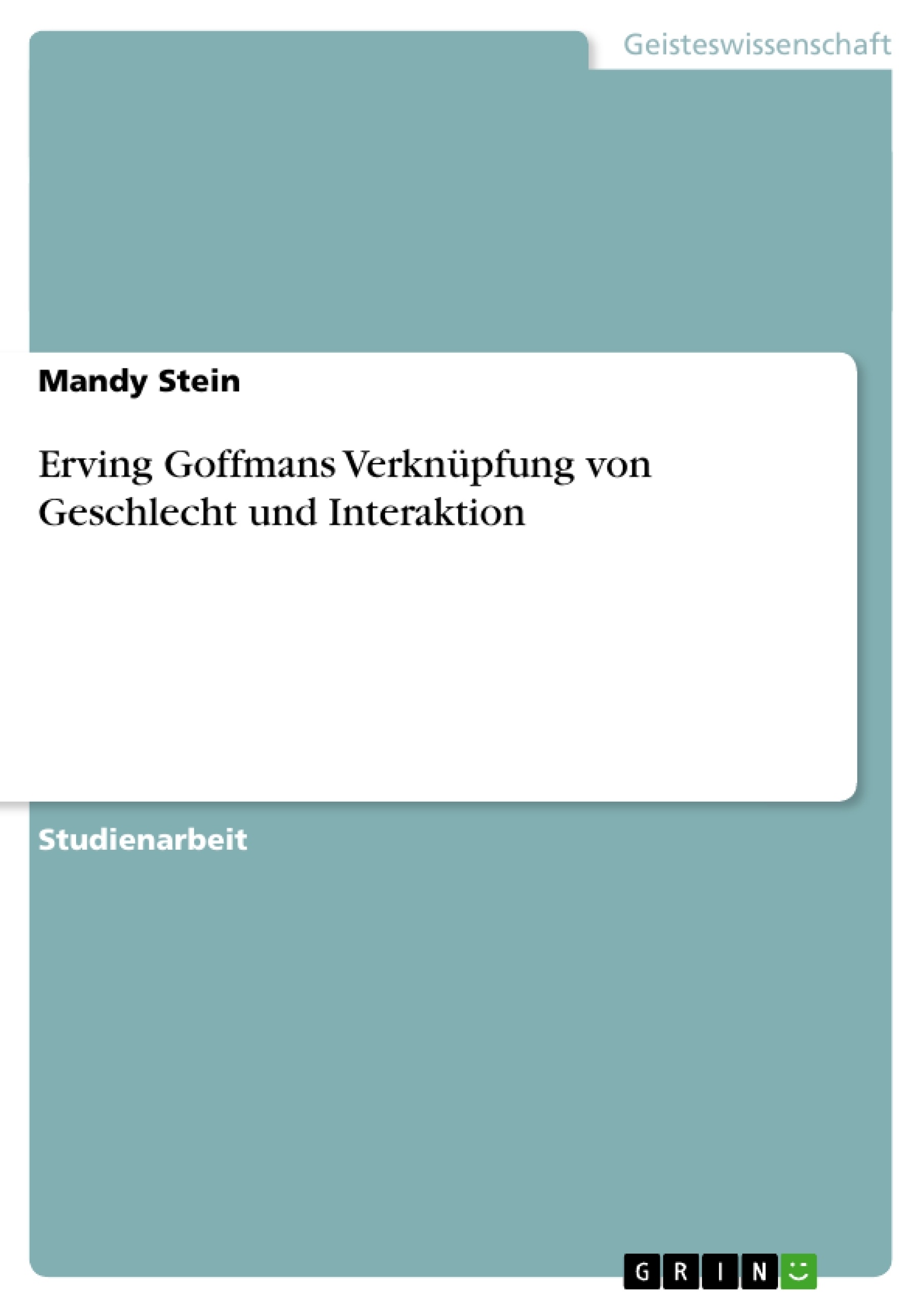„Schatz, kannst du die Kinder morgen in die Schule bringen? Ich habe einen
Frisörtermin!“ „Auf keinen Fall, ich habe morgen ein Meeting, und das ist ja wohl
wichtiger als deine Haare. Außerdem hast du eh den ganzen Tag nichts zu tun.“
Dies ist nur ein Beispiel wie Interaktion zwischen Mann und Frau stattfinden kann.
Doch warum sprechen die beiden Geschlechter in dieser oder ähnlicher Art und
Weise miteinander?
Erving Goffman, einer der populärsten Soziologen und besonders bekannt für
seine Rahmenanalyse, die Theatermetapher oder die Spielanalogie, beschäftigte
sich zum Ende seines Lebens besonders mit dem Gebiet der Interaktion. Da sich
dieser Bereich als Untersuchungsgegenstand bisher als eigenständig zeigte,
versuchte Goffman die Interaktion mit der Gesamtgesellschaft zu verbinden und
stellte die Interaktionsordnung als eine „Wirklichkeit eigener Art“1 dar. Er platzierte
Männer und Frauen durch die Interaktion.
Das Ziel dieser Arbeit ist es zu veranschaulichen wie Goffman Interaktion und
Geschlecht verbindet. Dazu soll zu Beginn eine Übersicht über Goffmans
Interaktionsordnung gegeben werden, im Anschluss wird das Bild der
Geschlechter nach Goffmans Auffassung vorgestellt und den Abschluss soll die
Gegenüberstellung und Verbindung der beiden Themenbereiche bilden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Interaktionsordnung
- 2. Das Geschlechtarrangement bei Goffman
- 2.1. Ausübung der Sozialisation
- 2.2. Geschlechterrollenstereotypen
- 2.3. Biologische Unterschiede und ihre Bedeutung
- 3. Der Vergleich mit traditioneller Rollenverteilung
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Erving Goffman Interaktion und Geschlecht verbindet. Zunächst wird Goffmans Interaktionsordnung erläutert. Anschließend wird Goffmans Sichtweise auf Geschlechterrollen vorgestellt. Abschließend werden beide Bereiche gegenübergestellt und in Beziehung zueinander gesetzt.
- Goffmans Interaktionsordnung
- Goffmans Darstellung von Geschlechterrollen
- Der Einfluss von Sozialisation auf Geschlechterrollen
- Vergleich mit traditionellen Rollenverteilungen
- Die Rolle der Interaktion in der Konstruktion von Geschlecht
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung präsentiert ein Beispiel für Interaktion zwischen Mann und Frau und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für diese Interaktionsmuster. Sie führt Erving Goffman und seine Arbeiten zur Interaktion ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
1. Die Interaktionsordnung: Dieses Kapitel beschreibt Goffmans Konzept der Interaktionsordnung, die als eigenständige Realität betrachtet wird. Es werden die Herausforderungen der Untersuchung alltäglicher Interaktion und die grundlegenden Elemente der Interaktion (Blicke, Gesten, Sprache etc.) erläutert. Die Interaktionsordnung wird als Ergebnis interaktiver Wechselwirkungen dargestellt, nicht als wissenschaftliches Konstrukt.
2. Das Geschlechtarrangement bei Goffman: Dieser Abschnitt befasst sich mit Goffmans Analyse des Geschlechtsarrangements. Die Unterkapitel befassen sich mit Sozialisation, Geschlechterrollenstereotypen und der Bedeutung biologischer Unterschiede im Kontext der Interaktion.
3. Der Vergleich mit traditioneller Rollenverteilung: Dieses Kapitel wird einen Vergleich zwischen Goffmans Analyse und traditionellen Rollenverteilungen durchführen (genaue Inhalte fehlen im vorliegenden Textausschnitt).
Schlüsselwörter
Erving Goffman, Interaktionsordnung, Geschlecht, Geschlechterrollen, Interaktion, Sozialisation, Geschlechterrollenstereotypen, Rollenverteilung, alltägliche Interaktion, Kommunikation.
- Quote paper
- Mandy Stein (Author), 2007, Erving Goffmans Verknüpfung von Geschlecht und Interaktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119288