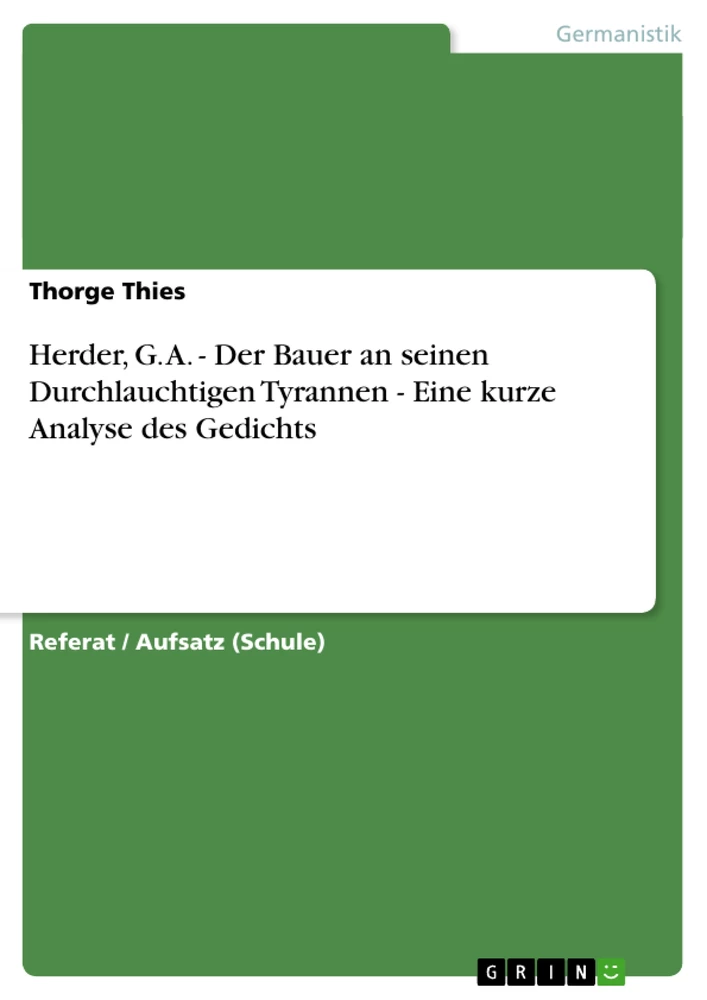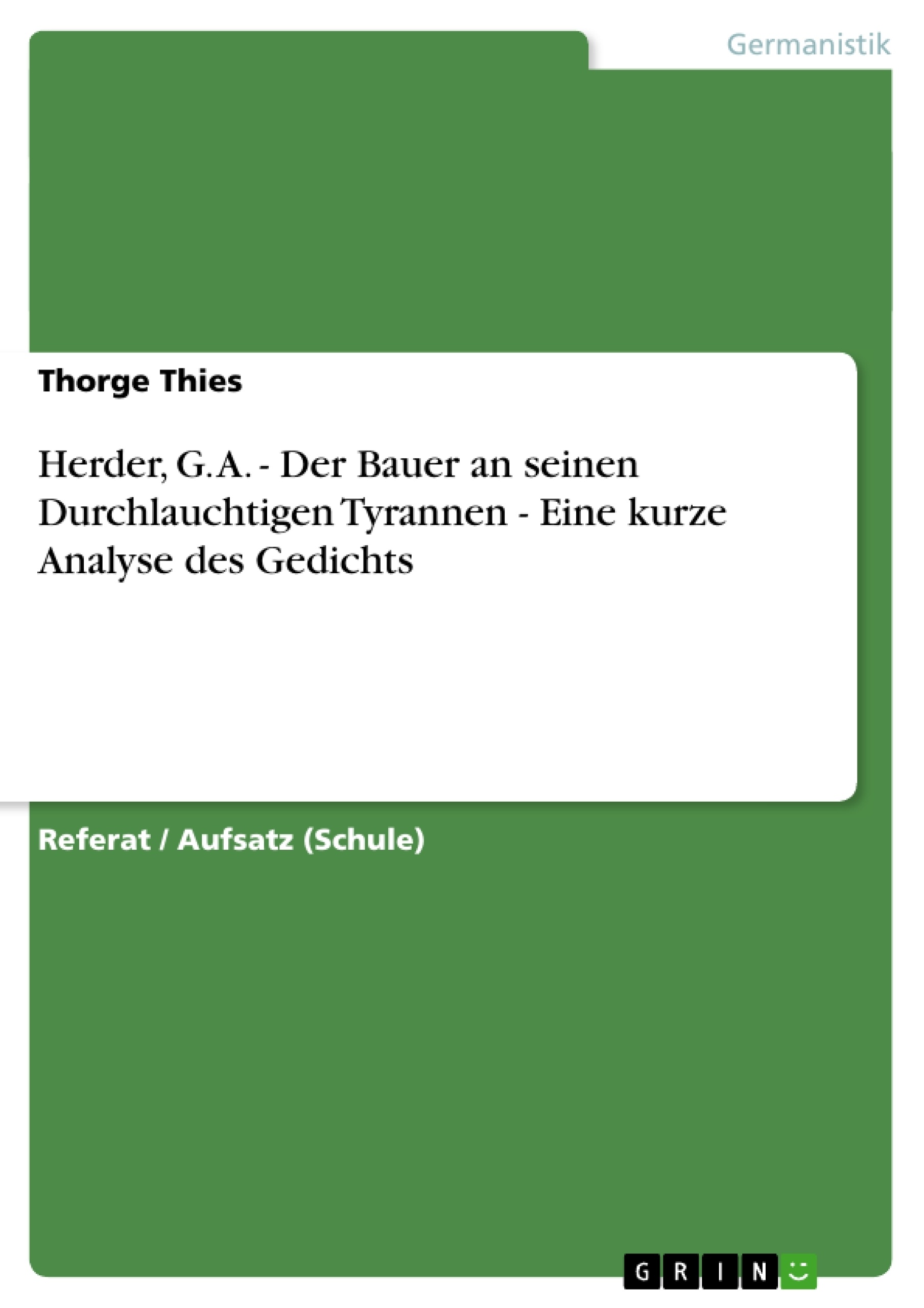Stell dir vor, dein Schweiß tränkt das Brot, das dein Peiniger verschlingt. Gottfried August Bürgers aufrüttelndes Gedicht "Der Bauer an seine Durchlauchtigen Tyrannen", entstanden im Geiste des Sturm und Drang, ist ein flammender Aufschrei gegen soziale Ungerechtigkeit und feudalistische Willkür. In einer Zeit, in der die Kluft zwischen Arm und Reich unüberbrückbar schien, erhebt sich die Stimme eines namenlosen Bauern, um die Verbrechen der herrschenden Klasse anzuprangern. Mit eindringlicher Direktheit und volkstümlicher Sprache entlarvt er die selbsternannten "Obrigkeiten von Gott", die ihre Macht missbrauchen und das einfache Volk ausbeuten. Das Gedicht, formal geprägt von einem gleichmäßigen Jambus und dem Verzicht auf Reimschemata, gewinnt seine Kraft aus der rohen Ehrlichkeit der Anklage. Es ist ein Zeugnis der Unterdrückung, das bis heute nichts von seiner Brisanz verloren hat. Die Analyse dieses Werkes offenbart nicht nur Bürgers Sprachgewalt und sein Gespür für soziale Missstände, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 18. Jahrhunderts. Entdecken Sie, wie Bürger durch die Augen eines einfachen Mannes die Fundamente der feudalen Ordnung in Frage stellt und den Tyrannen entlarvt, der sich hinter dem Deckmantel göttlicher Gnade versteckt. Eine tiefgreifende Interpretation, die die zeitlose Relevanz von Bürgers Werk für die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und sozialer Gerechtigkeit beleuchtet. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Stimme des Volkes gegen die Tyrannei aufbegehrt. Erforschen Sie die sprachlichen und stilistischen Mittel, mit denen Bürger seine Botschaft unmissverständlich vermittelt. Ein Muss für alle, die sich für Literaturgeschichte, politische Lyrik und die Kritik an gesellschaftlichen Ungleichheiten interessieren. Verpassen Sie nicht diese essentielle Analyse eines Gedichts, das bis heute zum Nachdenken anregt und zur Reflexion über Macht und Verantwortung auffordert.
Gedichtsanalyse
Der Bauer an seine Durchlauchtigen Tyrannen (1773)
(Gottfried August Herder (1747-1794))
In seinem Gedicht „Der Bauer an seinen Durchlauchtigen Tyrannen“
aus dem Jahr 1773 kritisiert Gottfried August Bürger die Unterdrückung der Bauern durch den Adel, welche diese mit Gottes Willen begründen.
Wie man bereist auf den ersten Blick erkennt, ist das Gedicht sehr gleichmäßig aufgebaut: Es hat 6 Strophen, die aus 3 Versen bestehen. Besonders auffällig ist das regelmäßige Metrum, ein 4-4-3-hebiger Jambus, der durch das ganz Gedicht geht. Des Weiteren ist am Ende jeweils eine männliche Kadenz. Auffällig ist außerdem, dass sich im gesamten Gedicht keine Reime finden lassen, weder innerhalb noch außerhalb der Verse. Zudem lassen sich in allen Strophen, außer der letzen, Zeilensprünge finden. Eben diese treten auf, da die Strophen 1-5 aus einem Satz bestehen.
Inhaltlich ist das Gedicht wie folgt aufgebaut: In den Strophen 1-3 klagt das
Lyrische-Ich, ein Bauer, dessen Namen man nicht kennt, einen ebenfalls
unbekannten Fürsten für verschiedene Verbrechen an seiner Person an.
Dabei lässt sich in der Intensität bereits eine Klimax, also Steigerung, finden.
Während die in der 1. Strophe beschriebenen Verbrechen nur aus Versehen geschehen sein können, trägt der Fürst durch das Gestatten des Zerfleischens des Bauern durch seine Hunde, in Strophe 2 schon eine Teilschuld. In Strophe 3 lässt sich dann der absolute Höhepunkt dieser Anschuldigungen, die übrigens allesamt in Form Rhetorische Fragen stattfinden, wieder finden.
In dieser wird der Bauer vom Fürsten in einer Treibjagd verfolgt.
In der 4. und 5. Strophe zeigt der Baer dem Fürsten auf, dass das Brot, das dieser ist, eigentlich ihm gehört. Schließlich hat dieser auch dafür auf Äckern, die der Fürst immer wieder zerstört hat (V.10), gearbeitet.
In der 6. Strophe zweifelt der Bauer an der Richtigkeit des Herrschens vom Fürsten, die sich als Herrscher von Gottes Gnaden sehen und nennt ihn im letzten Vers sogar einen „Tyrann“ (V.18).
Sprachlich ist das Gedicht sehr einfach aufgebaut, teilweise sogar schon umgangssprachlich, was der Ausdruck „Ha!“ in Vers 16 beweist.
Weiterhin ist zu erkennen, dass keine Fremdwörter in dem Gedicht vorkommen. Auch das Fehlen von Neologismen, welche zur Zeit Bürgers sehr beliebt waren, deutet auf eine sehr einfache Sprache hin. Ebenfalls Augenfällig sind die Synonyme von „Fürst“. Neben diesem Wort, das er viermal benutzt, verwendet er noch die Begriffe „Durchlauchtigen Tyrann“ (V.0), „Obrigkeit von Gott“ (V.16) und „Tyrann“ (V.18).
Was ebenfalls bemerkenswert ist, ist das der Bauer, den Fürsten, den er stark beschimpft, mit „Du“ anstatt „Sie“ oder „Ihn“ anredet.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Gottfried August Bürgers Gedicht "Der Bauer an seine Durchlauchtigen Tyrannen"?
Das Gedicht, verfasst im Jahr 1773, kritisiert die Unterdrückung der Bauern durch den Adel, welche die Adligen mit Gottes Willen rechtfertigen.
Wie ist das Gedicht formal aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus 6 Strophen mit jeweils 3 Versen. Es hat einen regelmäßigen 4-4-3-hebigen Jambus. Am Ende jeder Strophe steht eine männliche Kadenz. Es gibt keine Reime. Die Strophen 1-5 bestehen jeweils aus einem Satz, was zu Zeilensprüngen führt.
Was ist der Inhalt der einzelnen Strophen?
In den Strophen 1-3 klagt das lyrische Ich, ein Bauer, einen unbekannten Fürsten für verschiedene Verbrechen an. Die Intensität der Anschuldigungen steigert sich. In Strophe 4 und 5 weist der Bauer darauf hin, dass das Brot, das der Fürst isst, eigentlich ihm gehört, da er dafür gearbeitet hat. In der 6. Strophe zweifelt der Bauer an der Rechtmäßigkeit der Herrschaft des Fürsten und nennt ihn einen "Tyrann".
Welche sprachlichen Besonderheiten weist das Gedicht auf?
Das Gedicht ist sprachlich einfach gehalten, teilweise sogar umgangssprachlich. Es kommen keine Fremdwörter oder Neologismen vor. Es werden verschiedene Synonyme für "Fürst" verwendet (z.B. "Durchlauchtigen Tyrann", "Obrigkeit von Gott", "Tyrann"). Der Bauer redet den Fürsten mit "Du" an. Es werden starke Verben verwendet. Es ist ein hypotaktischer Satzbau erkennbar.
Welche Stilmittel werden im Gedicht verwendet?
Es werden rhetorische Fragen in den ersten Strophen verwendet. Außerdem lässt sich eine Klimax in der Steigerung der Anschuldigungen des Bauern gegen den Fürsten feststellen.
- Quote paper
- Thorge Thies (Author), 2008, Herder, G. A. - Der Bauer an seinen Durchlauchtigen Tyrannen - Eine kurze Analyse des Gedichts , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119285