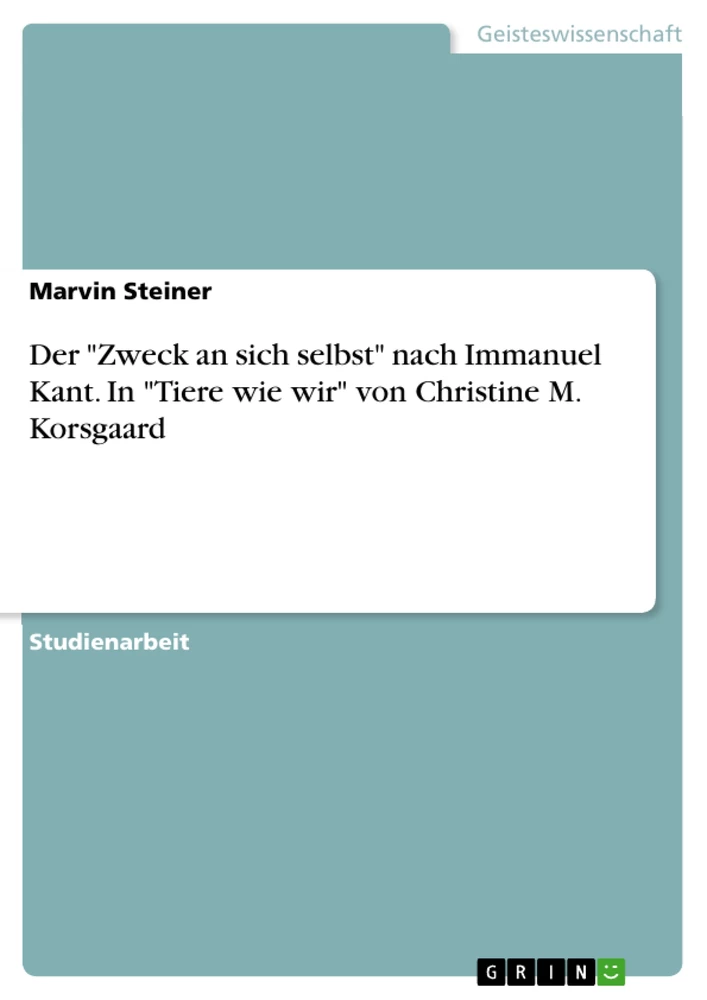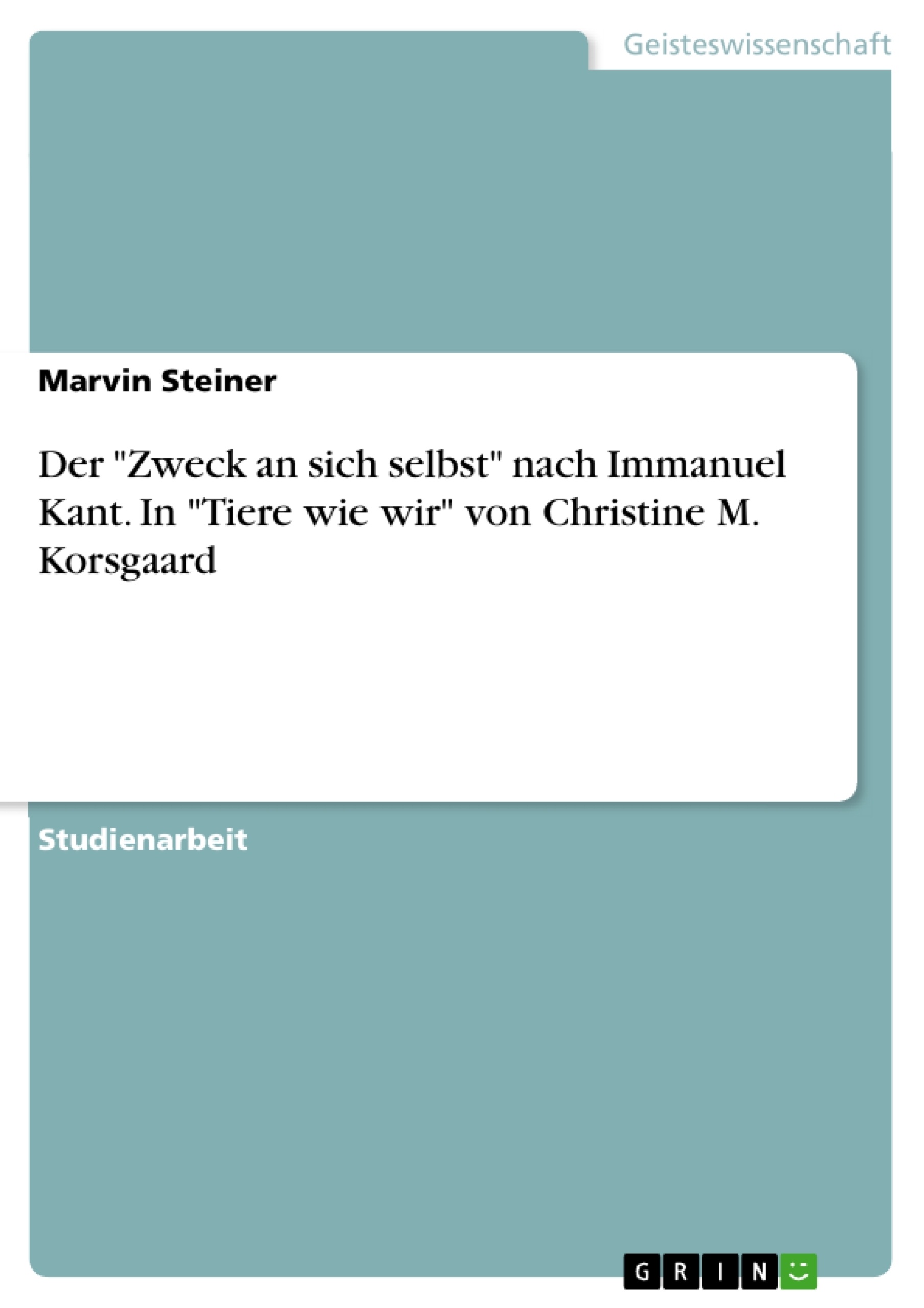Zunächst soll erläutert werden, wie Kant auf den Begriff des Zwecks an sich selbst kommt. Die Selbstzweckformel ist wie die anderen Formeln, die Kant formuliert, eine Ausdrucksweise des kategorischen Imperativs, nach dem sich alle vernünftigen Wesen im rationalen Wollen und Handeln richten sollen. Der Wille von vernünftigen Wesen bestimmt sich im Handeln nach der Vorstellung gewisser Gesetze. Kant kann den Begriff des Zwecks einführen, da der vernünftige Wille einen Zweck braucht, um sich der Vorstellung von Gesetzen gemäß zu bestimmen. Ein Zweck ist etwas, um deswillen etwas geschieht. Ein objektives Gesetz, das für alle vernünftigen Wesen gilt, bräuchte einen für alle ersichtlichen Zweck, der von der Vernunft gegeben wird. Dies wäre ein Zweck an sich selbst. Dieser Zweck an sich selbst wäre, vorausgesetzt, dass es ihn gäbe, ein Zweck um seiner selbst willen, "dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hat".
In dem Buch "Tiere wie wir" versucht Christine M. Korsgaard, einige Elemente von Kants Moralphilosophie für ihre neue tierethische Theorie zu benutzen. In dieser stellt sie die bedeutsame These auf, dass Tiere Zwecke an sich selbst sind. Der Begriff des Zwecks an sich selbst stammt aus Kants berühmter "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (GMS). Der ‚Zweck an sich selbst‘ ist ein Begriff, der bei Kant menschlichen Personen zugeschrieben wird: "Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest".
Inhaltsverzeichnis
- Inwiefern können Tiere Zwecke an sich selbst sein?
- Der Zweck an sich selbst bei Kant
- Korsgaards Interpretation des Zwecks an sich selbst bei Kant
- Autonome praktische Vernunft als Bedingung, ein Zweck an sich selbst zu sein
- Tiere als Zwecke an sich selbst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwiefern Tiere als Zwecke an sich selbst betrachtet werden können, ausgehend von Kants Moralphilosophie und deren Interpretation durch Christine M. Korsgaard. Die Arbeit analysiert den Begriff des „Zwecks an sich selbst“ bei Kant und beleuchtet die Rolle der autonomen praktischen Vernunft in diesem Zusammenhang.
- Kants Konzept des Zwecks an sich selbst
- Korsgaards Interpretation von Kants Moralphilosophie im Hinblick auf Tiere
- Die Rolle der autonomen praktischen Vernunft
- Die Anwendung des Konzepts auf die Tierethik
- Die ethische Behandlung von Tieren
Zusammenfassung der Kapitel
Inwiefern können Tiere Zwecke an sich selbst sein?: Diese Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: die Möglichkeit, Tiere als Zwecke an sich selbst zu betrachten, basierend auf Korsgaards Interpretation von Kants Moralphilosophie. Sie skizziert den methodischen Ansatz, indem sie die Untersuchung des Kant'schen Begriffs des Zwecks an sich selbst ankündigt, Korsgaards Interpretation analysiert und schließlich deren Anwendung auf die Frage der Tierethik diskutiert. Der Bezug auf Korsgaards Werk „Tiere wie wir“ und die Bedeutung der Selbstzweckformel werden hervorgehoben. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage klar und strukturiert den weiteren Verlauf der Arbeit.
Der Zweck an sich selbst bei Kant: Dieses Kapitel analysiert Kants Begriff des Zwecks an sich selbst, ausgehend von dessen Herleitung im Kontext des kategorischen Imperativs. Es wird die Unterscheidung zwischen subjektiven und objektiven Zwecken erläutert, wobei Kant subjektive Zwecke, bedingt durch Neigungen und die damit verbundene Relativität des Wertes, ausschließt. Objektive Zwecke, die aus der Vernunft entspringen und für jedes vernünftige Wesen erstrebenswert sind, werden als einzige Kandidaten für den absoluten Wert eines Zwecks an sich selbst betrachtet. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle der praktischen Vernunft und deren Bedeutung für die Verwirklichung des Zwecks an sich selbst. Die Ausführungen beleuchten, wie Kant durch ein Ausschlussverfahren zu dem Schluss kommt, dass nur vernünftige Wesen aufgrund ihrer praktischen Vernunft den Status eines Zwecks an sich selbst erlangen.
Korsgaards Interpretation des Zwecks an sich selbst bei Kant: Dieses Kapitel untersucht Korsgaards Interpretation von Kants Konzept des Zwecks an sich selbst. Sie bietet einen Lösungsansatz für die Problematik, dass Kant inhärente Werte als nicht von Menschen einsehbar beschrieb. Die detaillierte Auseinandersetzung mit Korsgaards Argumentation und deren Relevanz für die Tierethik steht im Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf der Klärung, wie Korsgaard Kants Philosophie neu interpretiert und wie diese Interpretation die Behandlung von Tieren als Zwecke an sich selbst rechtfertigt.
Schlüsselwörter
Tierethik, Kant, Korsgaard, Zweck an sich selbst, Autonome praktische Vernunft, kategorischer Imperativ, Selbstzweckformel, moralische Handlung, vernünftiges Wesen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Inwiefern können Tiere Zwecke an sich selbst sein?
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Tiere als Zwecke an sich selbst betrachtet werden können, basierend auf Kants Moralphilosophie und deren Interpretation durch Christine M. Korsgaard. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Konzepts des "Zwecks an sich selbst" auf die Tierethik.
Welche Konzepte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Kants Konzept des Zwecks an sich selbst, die Rolle der autonomen praktischen Vernunft, Korsgaards Interpretation von Kants Moralphilosophie im Hinblick auf Tiere, und die Anwendung dieser Konzepte auf die ethische Behandlung von Tieren. Der kategorische Imperativ und die Selbstzweckformel spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie wird Kants Konzept des "Zwecks an sich selbst" erläutert?
Die Arbeit analysiert Kants Begriff des Zwecks an sich selbst im Kontext des kategorischen Imperativs. Es wird die Unterscheidung zwischen subjektiven und objektiven Zwecken erläutert, wobei nur objektive Zwecke, die aus der Vernunft entspringen, als Zwecke an sich selbst betrachtet werden. Die Rolle der praktischen Vernunft bei der Verwirklichung des Zwecks an sich selbst wird hervorgehoben. Kant kommt zu dem Schluss, dass nur vernünftige Wesen aufgrund ihrer praktischen Vernunft den Status eines Zwecks an sich selbst erlangen.
Welche Rolle spielt Christine M. Korsgaard in dieser Arbeit?
Korsgaard bietet eine Interpretation von Kants Philosophie, die einen Lösungsansatz für die Problematik bietet, dass Kant inhärente Werte als nicht von Menschen einsehbar beschrieb. Ihre Interpretation ist zentral für die Argumentation der Arbeit, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob Tiere als Zwecke an sich selbst betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert detailliert Korsgaards Argumentation und deren Relevanz für die Tierethik.
Wie wird die Frage der Tierethik in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit wendet die Konzepte von Kant und Korsgaard auf die Tierethik an. Sie untersucht, ob und inwiefern sich aus Kants Philosophie und Korsgaards Interpretation ein Argument für die Berücksichtigung von Tieren als Zwecke an sich selbst ableiten lässt. Die ethische Behandlung von Tieren im Lichte dieser philosophischen Überlegungen wird diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Inwiefern können Tiere Zwecke an sich selbst sein? (Einleitung); Der Zweck an sich selbst bei Kant; Korsgaards Interpretation des Zwecks an sich selbst bei Kant; Autonome praktische Vernunft als Bedingung, ein Zweck an sich selbst zu sein; Tiere als Zwecke an sich selbst; Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tierethik, Kant, Korsgaard, Zweck an sich selbst, Autonome praktische Vernunft, kategorischer Imperativ, Selbstzweckformel, moralische Handlung, vernünftiges Wesen.
- Quote paper
- Marvin Steiner (Author), 2021, Der "Zweck an sich selbst" nach Immanuel Kant. In "Tiere wie wir" von Christine M. Korsgaard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191270