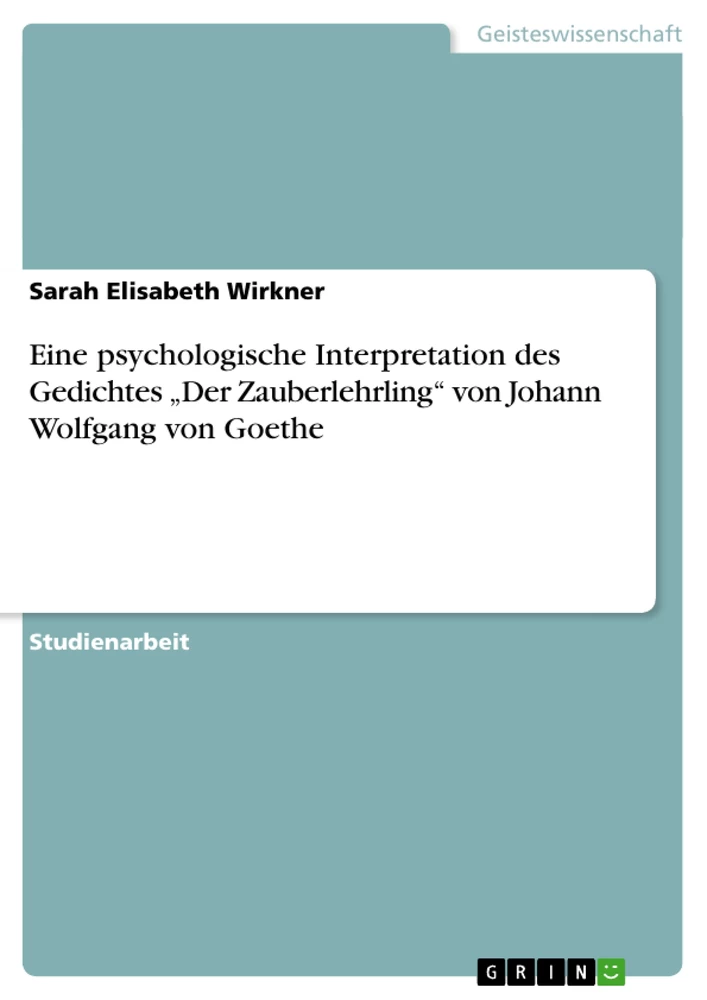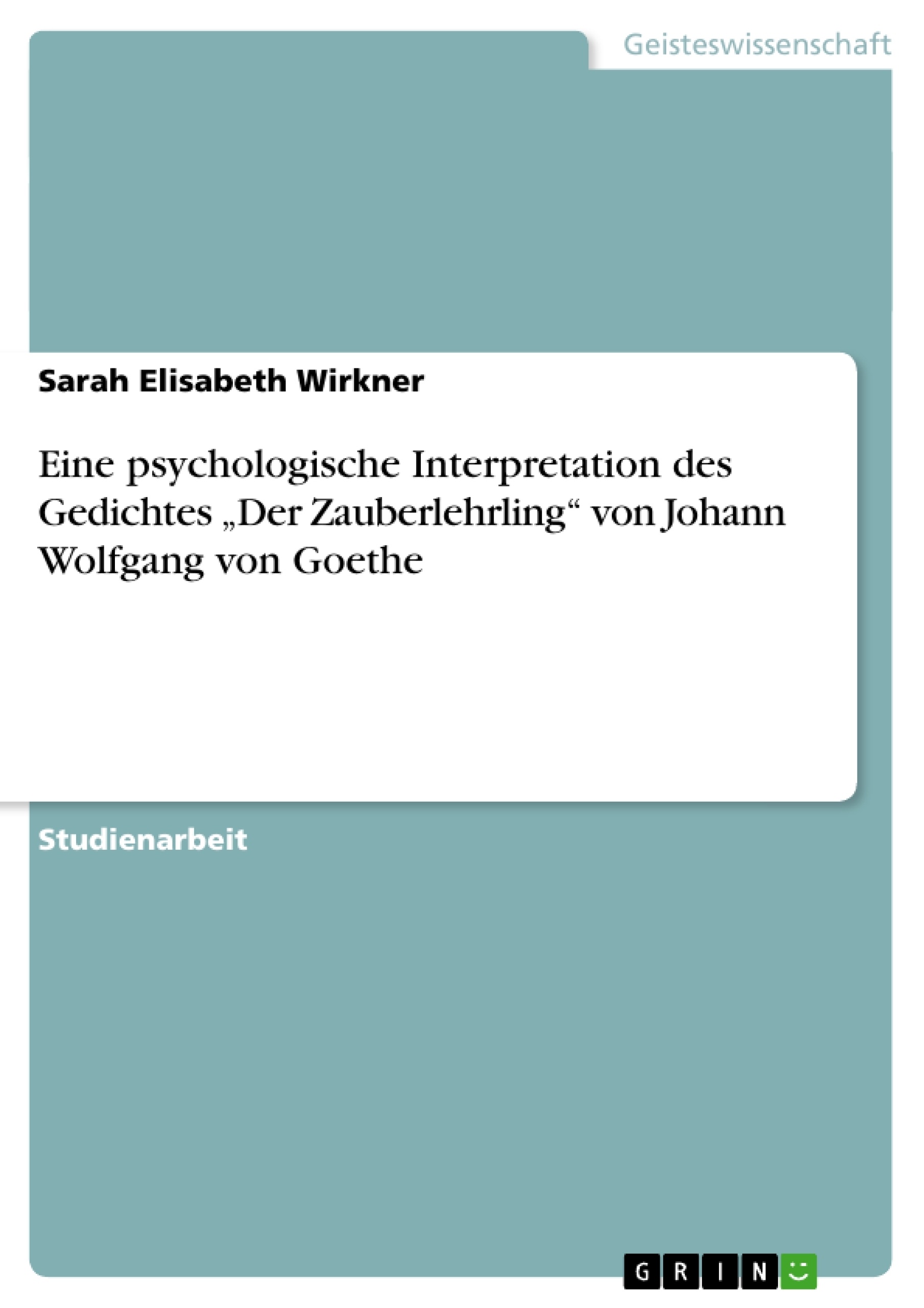In der Veranstaltung „Psychologische Interpretation von Gedichten“ von Prof. Dr. Rumpf begann ich damit, mich mit Gedichten auf eine für mich neue Art und Weise auseinanderzusetzen. Mir war schon bald klar, dass ich mich gerne im Rahmen einer Studienarbeit mit einem Gedicht und dessen Interpretation befassen würde. Dazu wählt ich die Ballade „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe. Zu dieser Ballade habe ich schon seit jüngster Kindheit ein besonderes Verhältnis. Ich bekam im Alter von etwa acht Jahren eine Hörspielkassette mit Gedichten und Balladen für Kinder geschenkt und konnte schon wenig später den Zauberlehrling auswendig aufsagen.
Erst heute ist mir bewusst, dass es sich bei dieser Ballade nicht etwa um ein für Kinder geschriebenes Stück handelt, sondern ursprünglich für Erwachsene gedacht war. Trotzdem finden wir den Zauberlehrling heute in Kinderzimmern und dem Deutschunterricht der siebten Klasse wieder.
Auch der „Struwwelpeter“ war ein Begleiter meiner Kindheit. Einige der Verse sind mir noch heute im Kopf. Und selbst die Illustrationen sehe ich vor meinem Inneren Auge.
Beide Gedichte könnten unterschiedlicher nicht sein. Zum einen, weil sie ursprünglich an verschiedene Adressaten gerichtet waren, zum anderen weil sie zwei konträre Enden haben.
In dieser Arbeit möchte ich nun nicht nur beide Geschichten interpretieren, sondern auch ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Ich denke, dass sie mehr Gemeinsamkeiten haben, als dies auf den ersten Blick erscheint.
Zum Schluss möchte ich noch kurz erwähnen, dass als Quelle für den „Struwwelpeter“ ein Reprint der ersten Auflage dient. Da es in der ursprünglichen Fassung keine Seitenzahlen gab, kann ich ebenfalls keine Seitenzahlen bei den Zitaten angeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neugier
- Interesse
- Der Zauberlehrling
- Stilistischer Aufbau
- Inhaltliche Interpretation
- Analyse
- Nachahmendes Verhalten im Zauberlehrling
- Umgang mit dem nachahmenden Verhalten
- Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug (Paulinchen aus: „Der Struwwelpeter“)
- Stilistischer Aufbau
- Inhaltliche Interpretation
- Nachahmendes Verhalten bei Paulinchen
- Umgang mit dem nachahmenden Verhalten
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Erziehungsstile von Goethe bis Hoffmann
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychologische Interpretation der Gedichte „Der Zauberlehrling“ von Goethe und „Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug“ aus dem Struwwelpeter. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Texte herauszuarbeiten und das Thema des nachahmenden Verhaltens bei Kindern zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den stilistischen Aufbau und die inhaltliche Interpretation beider Gedichte im Kontext der kindlichen Entwicklungspsychologie.
- Psychologische Interpretation von Kindergedichten
- Analyse des nachahmenden Verhaltens
- Vergleich der Erziehungsstile in den Gedichten
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gedichte
- Die Rolle von Neugier und Interesse in der kindlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungskontext der Arbeit im Rahmen einer Veranstaltung zur psychologischen Interpretation von Gedichten. Die Autorin erläutert ihre persönliche Verbindung zu den beiden ausgewählten Gedichten, „Der Zauberlehrling“ und „Paulinchen“ aus dem Struwwelpeter, und ihre Absicht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Texten zu analysieren. Die Arbeit nutzt einen Reprint der ersten Auflage des Struwwelpeters, der keine Seitenzahlen enthält, was die Zitierweise beeinflusst.
Neugier: Dieses Kapitel definiert Neugier als kurzzeitige Zuwendung zu einem Gegenstand oder einer Situation, ein Grundbedürfnis höher entwickelter Säugetiere, insbesondere Jungtiere. Es unterscheidet zwischen motivierter und kognitiver Neugier und setzt diese in Kontrast zu Bindungsverhalten und Angst vor unbekannten Reizen. Die Autorin betont den Zusammenhang zwischen Neugier, Angst und Problemlösefähigkeit und erläutert die Rolle der visuellen und proximalen Exploration in der kindlichen Entwicklung. Sie schließt mit der Feststellung, dass Neugier, obwohl essentiell für Entwicklung und Fortschritt, auch Gefahren birgt, wie am Beispiel des Atombombenabwurfs illustriert.
Interesse: Im Gegensatz zur Neugier kennzeichnet Interesse eine längere Zuwendung zu einem Gegenstand. Das Kapitel beschreibt exploratives Verhalten bei Kindern, dessen Höhepunkt im zweiten Lebensjahr liegt, und die Bedeutung des „Sinns im Dienste der Tätigkeit“ für die Entstehung von Interesse. Es werden geschlechtsspezifische Interessen und die Tendenz jüngerer Kinder zum schnellen Wechsel des Interesses thematisiert. Die Autorin hebt die Unterschiede zwischen sachorientiertem und personenorientiertem Interesse hervor, wobei unsichere Kinder eher sachorientiert sein sollen.
Schlüsselwörter
Psychologische Interpretation, Kindergedichte, Goethe, Struwwelpeter, Nachahmung, Neugier, Interesse, Erziehungsstil, kindliche Entwicklung, „Der Zauberlehrling“, Paulinchen, vergleichende Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Psychologische Interpretation von "Der Zauberlehrling" und "Paulinchen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die psychologische Interpretation der Gedichte "Der Zauberlehrling" von Goethe und "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug" (Paulinchen) aus dem Struwwelpeter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Texte hinsichtlich des nachahmenden Verhaltens bei Kindern, des stilistischen Aufbaus und der inhaltlichen Interpretation im Kontext der kindlichen Entwicklungspsychologie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die psychologische Interpretation von Kindergedichten, die Analyse des nachahmenden Verhaltens bei Kindern, einen Vergleich der Erziehungsstile in den Gedichten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen "Der Zauberlehrling" und "Paulinchen", sowie die Rolle von Neugier und Interesse in der kindlichen Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Neugier, Interesse, Der Zauberlehrling (mit Unterkapiteln zu stilistischem Aufbau, inhaltlicher Interpretation, Analyse, nachahmendem Verhalten und Umgang damit), Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug (mit ähnlichen Unterkapiteln wie bei "Der Zauberlehrling"), Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Erziehungsstile von Goethe bis Hoffmann und Fazit.
Wie werden Neugier und Interesse definiert und unterschieden?
Neugier wird als kurzzeitige Zuwendung zu einem Gegenstand definiert, während Interesse eine längere Zuwendung beschreibt. Die Arbeit differenziert zwischen motivierter und kognitiver Neugier und setzt diese in Bezug zu Bindungsverhalten und Angst. Interesse wird im Kontext von explorativem Verhalten und dem "Sinn im Dienste der Tätigkeit" erläutert, mit Betonung geschlechtsspezifischer Interessen und des schnellen Interessenwechsels bei jüngeren Kindern.
Wie werden die Gedichte "Der Zauberlehrling" und "Paulinchen" analysiert?
Die Analyse der Gedichte umfasst den stilistischen Aufbau, die inhaltliche Interpretation und die Betrachtung des nachahmenden Verhaltens der Protagonisten. Die Arbeit untersucht, wie dieses Verhalten dargestellt wird und wie damit in den jeweiligen Gedichten umgegangen wird. Ein Vergleich der beiden Gedichte hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede bildet einen zentralen Aspekt der Analyse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der vergleichenden Analyse von "Der Zauberlehrling" und "Paulinchen" zusammen. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Texte im Hinblick auf das Thema des nachahmenden Verhaltens und der Erziehungsstile herausgearbeitet. Die Arbeit liefert eine Interpretation der Gedichte im Kontext der kindlichen Entwicklungspsychologie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychologische Interpretation, Kindergedichte, Goethe, Struwwelpeter, Nachahmung, Neugier, Interesse, Erziehungsstil, kindliche Entwicklung, "Der Zauberlehrling", Paulinchen, vergleichende Literaturanalyse.
Welche Quelle wurde für den Struwwelpeter verwendet?
Die Arbeit verwendet einen Reprint der ersten Auflage des Struwwelpeters, der keine Seitenzahlen enthält, was die Zitierweise beeinflusst.
- Citar trabajo
- Sarah Elisabeth Wirkner (Autor), 2008, Eine psychologische Interpretation des Gedichtes „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119126