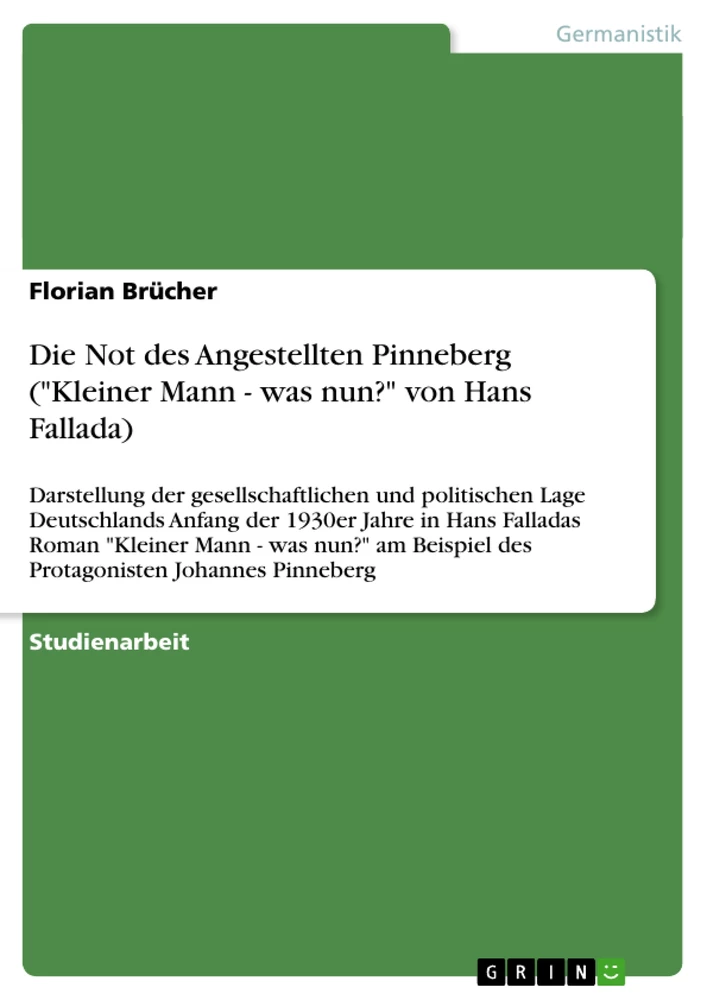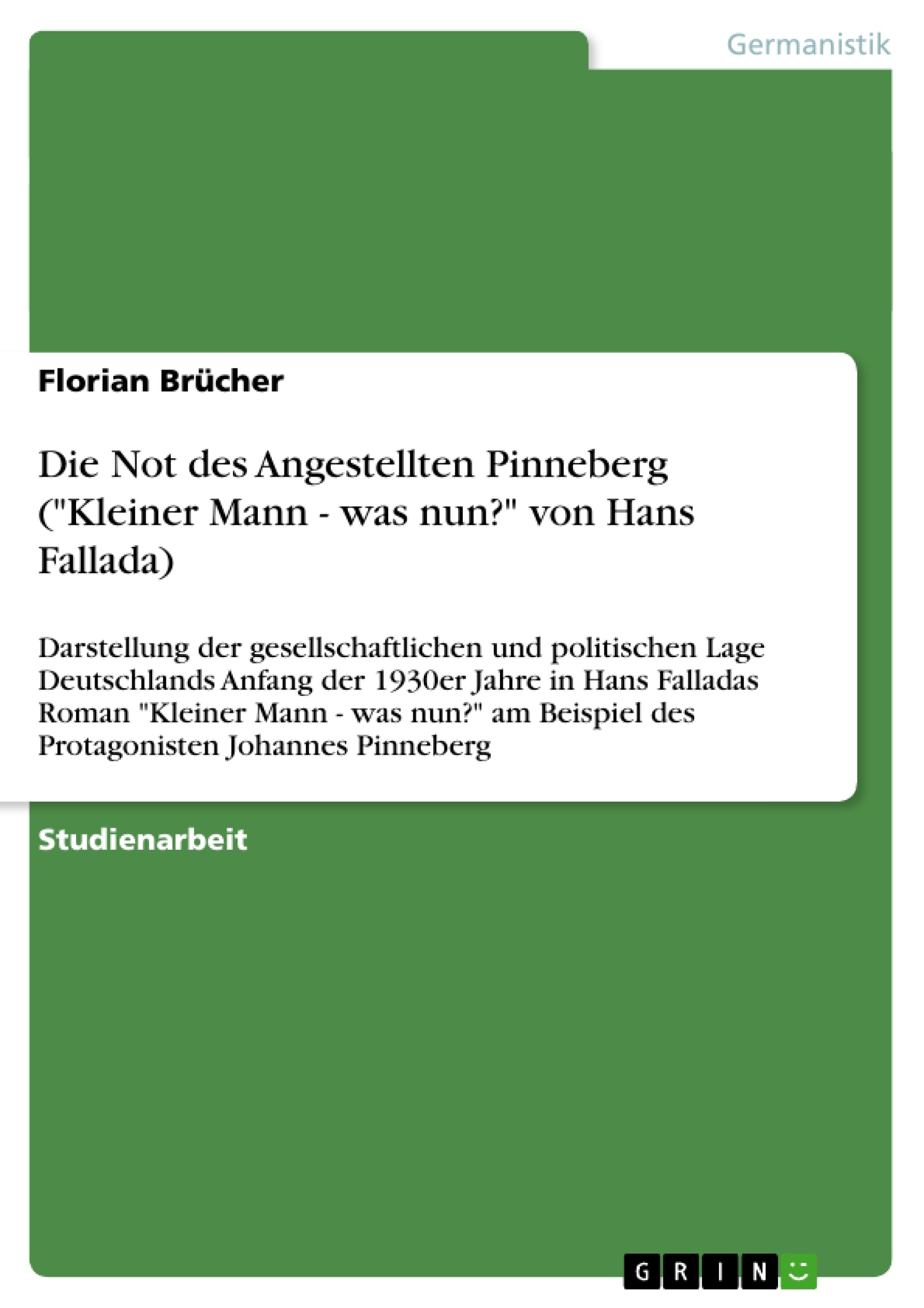Siegfried Kracauer veröffentlichte 1929 im Feuilleton der Frankfurter Zeitung seine Aufsehen erregende Studie „Die Angestellten. Aus dem neuen Deutschland“, in welcher er eine Berufsgruppe porträtiert, deren Situation „sich seit den Jahren vor dem Krieg von Grund auf verändert“ hat. In Deutschland gab es zu dieser Zeit 3,5 Millionen Angestellte, davon 1,2 Millionen Frauen.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg wuchsen die Städte sehr stark. Dadurch wandelte sich auch die Struktur der Wirtschaft: Es entstanden neue Arbeitsfelder, die es außerhalb dieser großen Städte vorher nicht gegeben hatte. Das Zusammenleben so vieler Menschen auf verhältnismäßig kleinem Raum musste organisiert werden, was von Stadtverwaltungen und ihren Angestellten erledigt wurde. Die vielen Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen, die sich im urbanen Raum ansiedelten, stellten u.a. kaufmännische Angestellte ein, die mit 2,25 Millionen Menschen die größte Gruppe innerhalb der Angestellten darstellte. Es folgten 1,35 Millionen Industrieangestellte und jeweils ungefähr 250.000 Büroangestellte, Techniker und Werkmeister.
Die schnell wachsende Zahl der Angestellten wurde nach dem Krieg noch größer, da vor allem durch die Inflation ruinierte Selbstständige aus Handwerk und Handel in die Angestelltenberufe drängten.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Soziologie der Angestellten
- Überblick über das Leben der Angestellten
- Die wirtschaftliche und soziale Lage in den Jahren von 1930 bis 1932
- Angestellte versus Arbeiter
- Fallada und der Angestelltenroman
- Zur Entstehung: Motivation und Intention
- Gattungsfragen
- Der Weg des Protagonisten
- Die Arbeitswelt
- Die Darstellung im Roman
- Aus der Sicht von Johannes Pinneberg
- Der Blick auf andere
- Die Kollegen
- Kube
- Heilbutt
- Fazit
- Vitamin B
- Biographische Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung der gesellschaftlichen und politischen Lage Deutschlands Anfang der 1930er Jahre am Beispiel des Protagonisten Johannes Pinneberg in Hans Falladas Roman „Kleiner Mann – was nun?“. Ziel ist es, die Lebensumstände und Probleme der Angestelltenklasse in dieser Zeit zu beleuchten und deren Bedeutung für die politische und soziale Entwicklung Deutschlands zu verdeutlichen.
- Die wirtschaftliche und soziale Lage der Angestellten in der Weimarer Republik
- Die Folgen der Wirtschaftskrise für die Angestelltenklasse
- Die Rolle der Angestellten im gesellschaftlichen Wandel
- Die Darstellung der Arbeitswelt in Falladas Roman
- Die literarische Bedeutung von „Kleiner Mann – was nun?“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die soziologische Situation der Angestellten in Deutschland Anfang der 1930er Jahre. Es geht auf die wachsende Bedeutung dieser Berufsgruppe ein, die durch die Industrialisierung und Urbanisierung entstand. Zudem werden die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der politischen Instabilität auf die Lebensumstände der Angestellten dargestellt.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit Falladas Roman „Kleiner Mann – was nun?“ und untersucht die Entstehung und die literarische Bedeutung des Werks. Insbesondere werden die Motivation und Intention Falladas sowie die Gattungsfragen des Romans beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die Arbeitswelt in „Kleiner Mann – was nun?“. Es betrachtet die Darstellung der Arbeitsbedingungen, die Perspektiven des Protagonisten Johannes Pinneberg und die Beziehungen zwischen den Kollegen.
Schlüsselwörter
Angestellte, Weimarer Republik, Wirtschaftskrise, Sozialismus, Arbeitslosigkeit, Proletarisierung, Hans Fallada, „Kleiner Mann – was nun?“, Johannes Pinneberg, „Die Angestellten“ von Siegfried Kracauer, „Die Umschichtung des Proletariats“ von Emil Lederer.
- Quote paper
- Florian Brücher (Author), 2008, Die Not des Angestellten Pinneberg ("Kleiner Mann - was nun?" von Hans Fallada), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119036