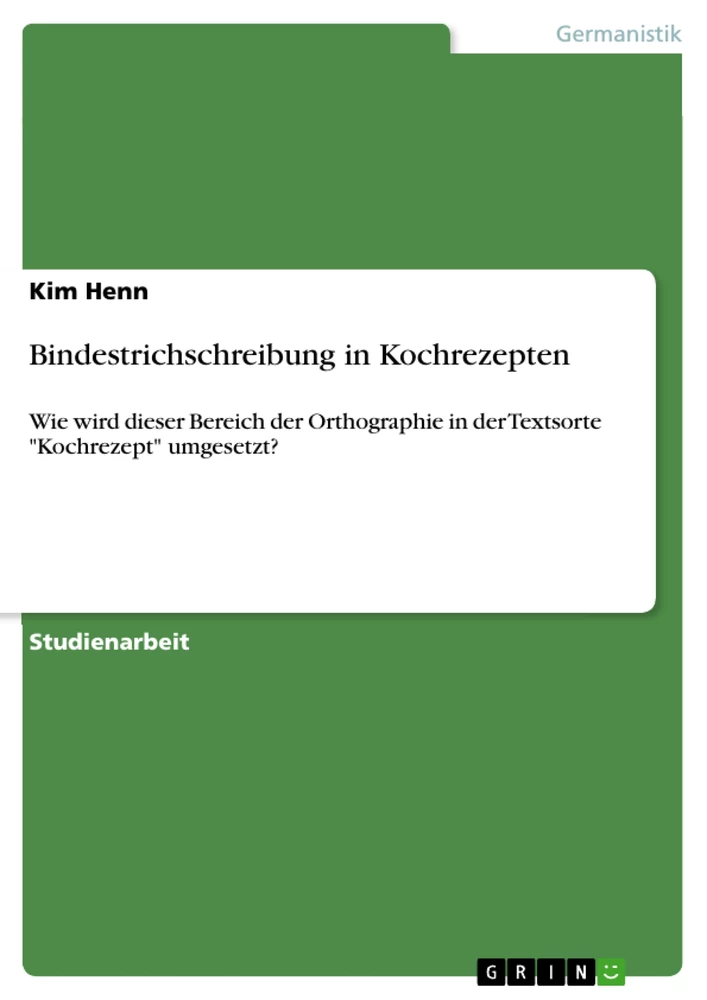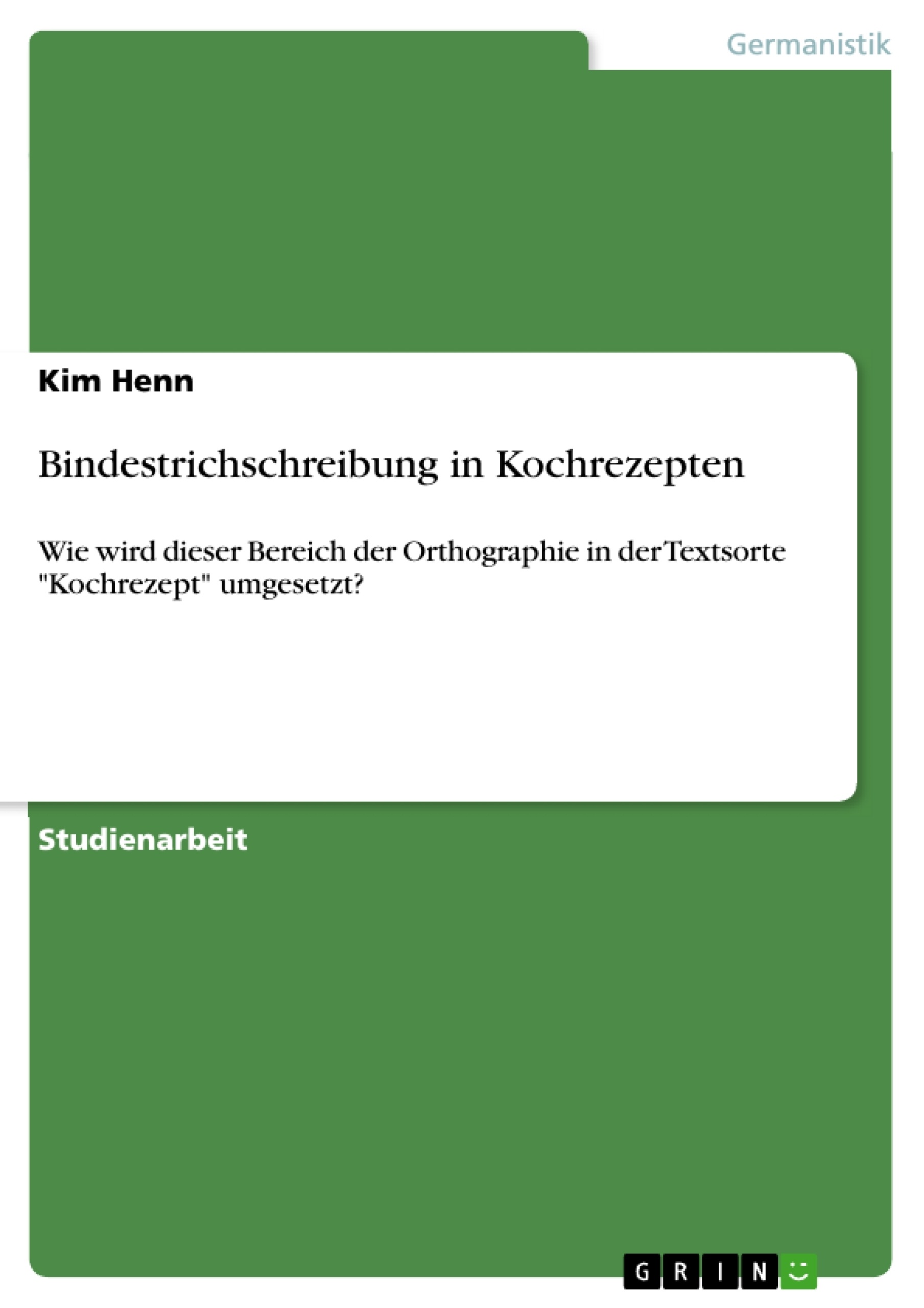Die „Schreibung mit Bindestrich“ ist in der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung ein eigenständiges Kapitel. Dies, obwohl die Bindestrichschreibung eng mit der Getrennt- und Zusammenschreibung verbunden ist und ebenfalls als Wortzeichen, also Unterkapitel der Zeichensetzung, angesehen werden kann.
Themen wie Kochen und verschiedene Ernährungsweisen scheinen in unserer heutigen Gesellschaft, durch eine Steigerung am Interesse gesunder Lebensweisen, immer beliebter zu werden. Deshalb scheint es interessant eine Textsorte, die mit diesem Trend zunimmt und dadurch beeinflusst wird, auf ihre Orthographie, in diesem Fall die Bindestrichschreibung, zu analysieren: Kochrezepte.
Die Aufgabe dieser Arbeit ist es diesen Bereich der Orthographie und seine Bedeutung in Kochrezepten zu analysieren. Hierfür werden Kochbücher deutschsprachiger Autoren verwendet. Es wird sich in dieser Arbeit rein auf Kochbücher fokussiert, da ein Vergleich mit anderen Medien (wie z.B. Kochrezepte aus dem Internet oder Zeitschriften) den Umfang dieser Seminararbeit überschreiten würde. Außerdem wird, neben den Hauptkochbüchern von deutschen Autoren, ein Kochbuch einer schweizer Autorin hinzugezogen, da in diesem weitere wichtige Beispiele festgestellt wurden. Ein Kochrezept besteht aus verschiedenen Teilen, wie Text, Fotos und Layout. Diese Analyse bezieht sich rein auf das Kochrezept im üblichen Sinne, d.h. Titel, Zutaten und Mengenangaben, Herstellungsanweisung und Tipps, die in direktem Bezug zur Herstellungsanweisung stehen. Kurze Beschreibungen (meist unter dem Titel) und Anekdoten oder Meinungen des Autors zum Rezept oder zum Kochbuch werden nicht einbegriffen, da diese nicht zur Herstellung eines Gerichtes notwendig sind. Der Verlauf der Arbeit beginnt mit der Klärung der Begrifflichkeiten. Darauf folgt eine kurze Erläuterung über die verschiedenen Verwendungen des Bindestrichs und abschließend wird der „Erläuterungsbindestrich“, dessen Regeln und deren Verwendung in Kochrezepten ausführlich dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gebrauch des Bindestrichs
- 2.1. Trennstrich
- 2.2. Ergänzungsstrich
- 2.3. Erläuterungsbindestrich
- 3. Die Regeln zur Bindestrichschreibung
- 3.1. „Kann-Regeln“
- 3.1.1. Unübersichtliche Zusammensetzungen und/oder Hervorhebung einzelner Bestandteile (§45)
- 3.1.2. (Geografische) Eigennamen (§51 – §52)
- 3.2. „Muss-Regeln“
- 3.2.1. Der Erläuterungsbindestrich mit Abkürzungen und Ziffern (§40 – §42)
- 3.2.2. Der Erläuterungsbindestrich in substantivisch gebrauchten, mehrteiligen Zusammensetzungen (§43 – §44)
- 3.2.3. Der Erläuterungsbindestrich bei Eigennamen (§46, §48 — §50)
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Verwendung des Bindestrichs in deutschsprachigen Kochrezepten. Das Ziel ist es, die Bedeutung der Bindestrichschreibung in dieser Textsorte zu untersuchen und die Anwendung der entsprechenden Regeln der deutschen Rechtschreibung zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswahl deutschsprachiger Kochbücher, um den Umfang der Arbeit zu begrenzen.
- Analyse der Bindestrichverwendung in Kochrezepten
- Untersuchung der verschiedenen Bindestricharten (Trennstrich, Ergänzungsstrich, Erläuterungsbindestrich)
- Anwendung der „Kann-“ und „Muss-Regeln“ der Bindestrichschreibung im Kontext von Kochrezepten
- Bedeutung der Orthographie für die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Kochrezepten
- Vergleich der Bindestrichverwendung in verschiedenen Kochbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bindestrichschreibung in Kochrezepten ein und begründet die Relevanz der Arbeit. Sie stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Der Fokus liegt auf deutschsprachigen Kochbüchern, um den Rahmen der Arbeit zu definieren. Die Einleitung erwähnt die drei Hauptteile eines Kochrezepts (Titel, Zutaten/Mengenangaben, Herstellungsanweisung) und klärt, welche Aspekte der Analyse zugrunde liegen. Die Arbeit gliedert sich in die Klärung der Begrifflichkeiten, die verschiedenen Verwendungen des Bindestrichs und eine ausführliche Darstellung des Erläuterungsbindestrichs und dessen Anwendung in Kochrezepten.
2. Gebrauch des Bindestrichs: Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Verwendungsweisen des Bindestrichs, wobei die terminologische Unschärfe in der Fachliteratur (Eisenberg vs. Nerius) thematisiert wird. Es werden der Trennstrich (Worttrennung am Zeilenende), der Ergänzungsstrich (Auslassung gemeinsamer Wortbestandteile in Aufzählungen) und der Erläuterungsbindestrich unterscheiden und definiert. Die Wahl der Terminologie in dieser Arbeit wird begründet. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die verschiedenen Funktionen des Bindestrichs klar abgrenzt.
3. Die Regeln zur Bindestrichschreibung: Dieses Kapitel behandelt die Regeln der Bindestrichschreibung, unterteilt in „Kann-Regeln“ (z.B. bei unübersichtlichen Zusammensetzungen oder zur Hervorhebung) und „Muss-Regeln“ (z.B. bei Abkürzungen, Ziffern und in substantivisch gebrauchten Zusammensetzungen). Die Regeln werden im Kontext der Bindestrichverwendung in Kochrezepten erläutert, wobei die jeweiligen Paragraphen der amtlichen Rechtschreibung genannt werden. Das Kapitel stellt die grammatikalischen Grundlagen zur Verfügung, um die Analyse der Kochrezepte fundiert vorzunehmen.
Schlüsselwörter
Bindestrichschreibung, Kochrezepte, deutsche Rechtschreibung, Orthographie, Trennstrich, Ergänzungsstrich, Erläuterungsbindestrich, „Kann-Regeln“, „Muss-Regeln“, Textsorte, Analyse, Worttrennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Bindestrichschreibung in deutschsprachigen Kochrezepten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Verwendung des Bindestrichs in deutschsprachigen Kochrezepten. Sie untersucht die Bedeutung der Bindestrichschreibung in dieser Textsorte und beleuchtet die Anwendung der entsprechenden Regeln der deutschen Rechtschreibung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, die Verwendung des Bindestrichs in Kochrezepten zu untersuchen und die Bedeutung der korrekten Bindestrichschreibung für die Lesbarkeit und Verständlichkeit dieser Texte zu ergründen. Die Analyse konzentriert sich auf eine Auswahl deutschsprachiger Kochbücher.
Welche Bindestricharten werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Trennstrich (Worttrennung am Zeilenende), Ergänzungsstrich (Auslassung gemeinsamer Wortbestandteile) und Erläuterungsbindestrich. Die terminologische Unschärfe in der Fachliteratur wird dabei thematisiert.
Welche Regeln der Bindestrichschreibung werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen „Kann-Regeln“ (z.B. bei unübersichtlichen Zusammensetzungen oder zur Hervorhebung) und „Muss-Regeln“ (z.B. bei Abkürzungen, Ziffern und in substantivisch gebrauchten Zusammensetzungen) der deutschen Rechtschreibung. Die jeweiligen Paragraphen der amtlichen Rechtschreibung werden genannt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Gebrauch des Bindestrichs, ein Kapitel zu den Regeln der Bindestrichschreibung, und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Die Kapitel erläutern die verschiedenen Bindestricharten und die entsprechenden Regeln der deutschen Rechtschreibung. Der Fokus liegt auf dem Erläuterungsbindestrich und dessen Anwendung in Kochrezepten.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Forschungsfrage), Gebrauch des Bindestrichs (Beschreibung der verschiedenen Bindestricharten), Regeln der Bindestrichschreibung (Erklärung der „Kann-“ und „Muss-Regeln“ im Kontext von Kochrezepten).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bindestrichschreibung, Kochrezepte, deutsche Rechtschreibung, Orthographie, Trennstrich, Ergänzungsstrich, Erläuterungsbindestrich, „Kann-Regeln“, „Muss-Regeln“, Textsorte, Analyse, Worttrennung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die amtliche deutsche Rechtschreibung und thematisiert die terminologische Unschärfe in der Fachliteratur (Eisenberg vs. Nerius).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Germanisten, Rechtschreibinteressierte und alle, die sich für die Anwendung orthographischer Regeln in verschiedenen Textsorten interessieren.
Wo finde ich mehr Informationen?
Der vollständige Text dieser Arbeit bietet eine detaillierte Analyse der Bindestrichschreibung in deutschsprachigen Kochrezepten.
- Citar trabajo
- Kim Henn (Autor), 2018, Bindestrichschreibung in Kochrezepten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190307