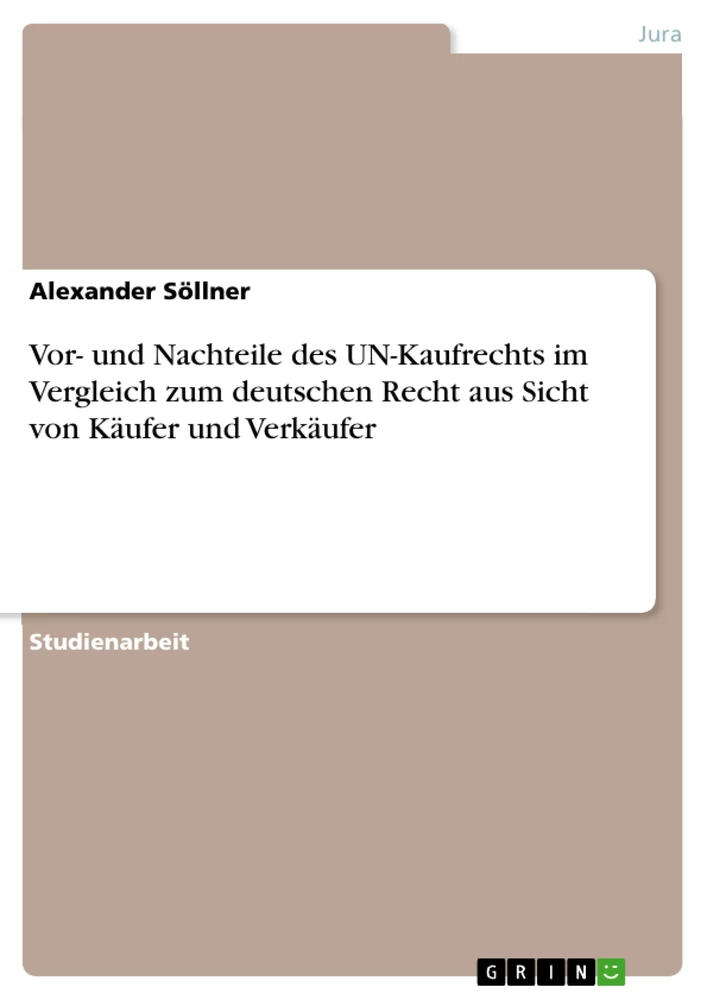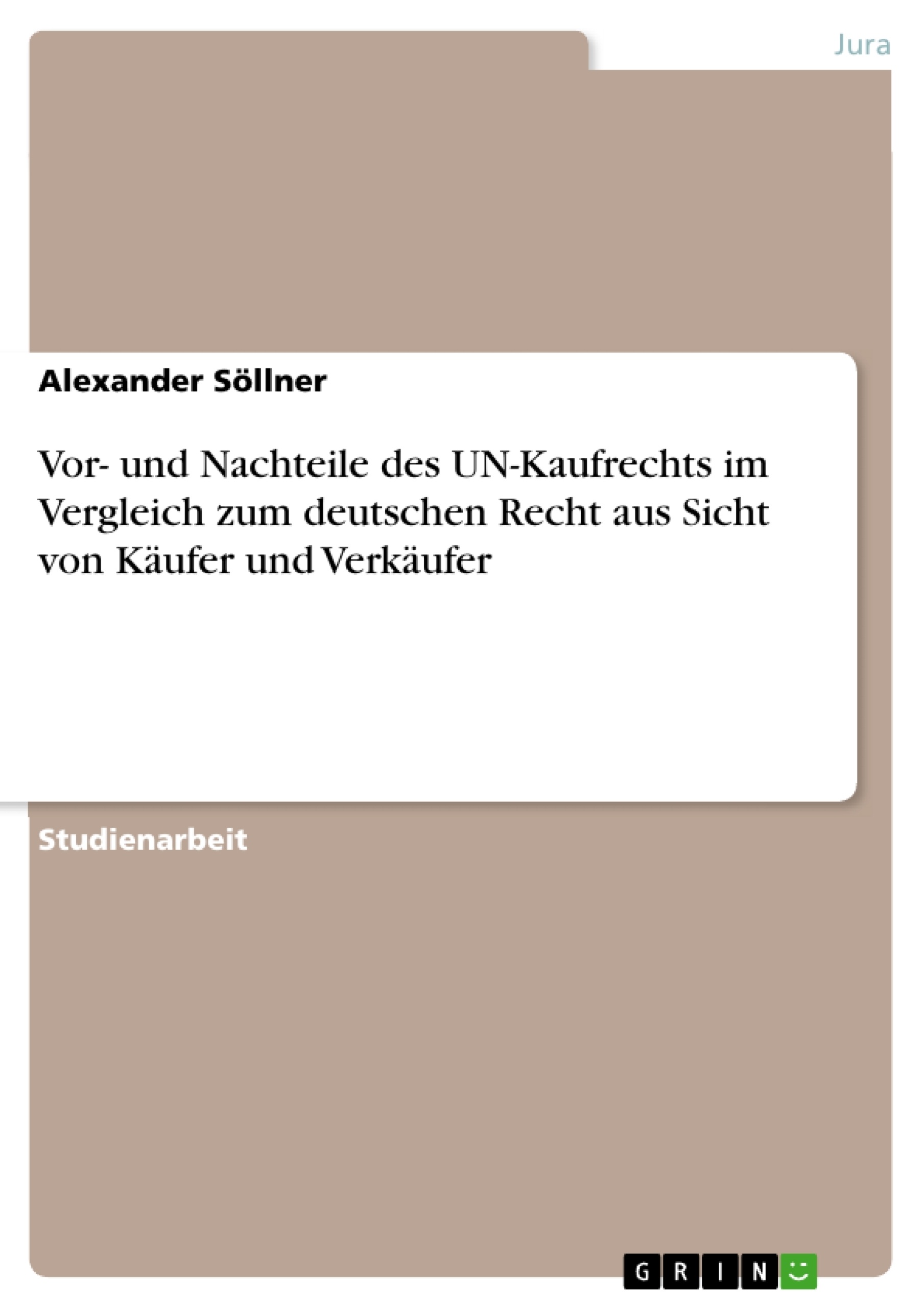Ziel dieser Arbeit ist die Gegenüberstellung des UN-Kaufrechts mit dem deutschen Recht und welche möglichen Vor- und Nachteile sich für den Käufer und Verkäufer ergeben können, um somit eine Handelsempfehlung aussprechen zu können, welche der drei Varianten vorteilhaft sein kann.
Einleitend wird der Hintergrund der Entstehung des UN-Kaufrechts beschrieben, um Zweck und Motive des Übereinkommens zu verstehen. Anschließend wird auf die Anwendbarkeit eingegangen, um die Abgrenzung des CISG zu nationalem und fremdem Recht vornehmen zu können. Schwerpunktmäßig werden die Regelungen des UN-Kaufrechts mit den deutschen Regeln verglichen - mit Beispielen belegt -, um mögliche Vor- und Nachteile beleuchten zu können.
Es wird sich zeigen, dass eine konkrete Einzelfallbetrachtung angezeigt ist, um als Käufer oder Verkäufer zu entscheiden, welches Recht Grundlage des Vertrages werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Hintergrund des UN-Kaufrechts
- II. Anwendbarkeit des CISG
- III. Aufbau und Grundzüge des UN-Kaufrechts
- IV. Bedeutung des UN-Kaufrechts in der Praxis
- V. Vor- und Nachteile des CISG im Vergleich zum deutschen Recht
- 1. Schadensersatzanspruch
- 2. Vertragsschluss
- 3. Begriff des Mangels
- a.) Beispiel „Muschelfall“
- b.) Ergebnis
- 4. Vertragsaufhebung
- 5. Leistungszeit
- 6. Flexibilität des UN-Kaufrechts
- 7. Unbestimmte Rechtsbegriffe
- 8. Einheitliches Regelwerk und niedrige Transaktionskosten
- a.) Beispiel Lieferung „frei Haus“
- b.) Ergebnis
- 9. Regelungslücken
- B. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des UN-Kaufrechts (CISG) im Vergleich zum deutschen Recht aus der Perspektive von Käufern und Verkäufern im internationalen Handel. Ziel ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Wahl des anwendbaren Rechts bei grenzüberschreitenden Kaufverträgen zu schaffen.
- Vergleich der Regelungen zum Schadensersatz im CISG und im deutschen Recht
- Analyse der Anwendbarkeit des CISG und der Möglichkeiten seines Ausschlusses
- Untersuchung der Unterschiede beim Begriff des Mangels und der Vertragsaufhebung
- Bewertung der Flexibilität des UN-Kaufrechts im Vergleich zum deutschen Recht
- Diskussion der Auswirkungen einheitlicher Regelwerke auf Transaktionskosten
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des grenzüberschreitenden Handelskaufs ein und stellt die drei möglichen Rechtswahlvarianten vor: das Recht des Käufers, das Recht des Verkäufers und das UN-Kaufrecht (CISG). Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit – einen Vergleich des CISG mit dem deutschen Recht und die Ableitung einer Handlungsempfehlung zur Rechtswahl – und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer Einzelfallbetrachtung bei der Wahl des anwendbaren Rechts.
I. Hintergrund des UN-Kaufrechts: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des CISG, beginnend mit den frühen Bemühungen um ein einheitliches internationales Kaufrecht im Jahr 1929. Es beschreibt die Rolle von Ernst Rabel und die Entwicklung von Vorläufer-Übereinkommen in Den Haag. Die Verabschiedung des CISG in Wien 1980 und dessen Inkrafttreten für Deutschland 1991 werden detailliert dargestellt, ebenso wie die wachsende Anzahl der Vertragsstaaten. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit eines einheitlichen Regelwerks angesichts des zunehmenden internationalen Handels.
II. Anwendbarkeit des CISG: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des CISG. Es erklärt die Bedeutung der grenzüberschreitenden Komponente, die Unterscheidung zwischen Warenkauf und Konsumentenkauf, sowie die Rolle des Internationalen Privatrechts (IPR). Die Kapitel beschreibt verschiedene Möglichkeiten, das CISG auszuschließen (Opting-out) und analysiert verschiedene Klauseln zur Rechtswahl. Die Bedeutung der Unterscheidung von Waren für den privaten Gebrauch und Waren für gewerbliche Zwecke wird hervorgehoben. Der Abschnitt beleuchtet die verschiedenen rechtlichen und faktischen Kriterien die erfüllt sein müssen, damit das CISG Anwendung findet.
III. Aufbau und Grundzüge des UN-Kaufrechts: Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des CISG in vier Teile und erläutert die zentralen Inhalte der ersten drei Teile, die das einheitliche Kaufrecht für grenzüberschreitende Warenkaufverträge regeln. Es werden die Regelungen zu Willenserklärungen, Niederlassung, Rechtsgeschäftsform, Vertragsabschluss, Rechten und Pflichten der Vertragsparteien, sowie die Ansprüche bei Leistungsstörungen detailliert dargestellt. Der Vergleich mit dem EKG und EAG sowie dem deutschen BGB verdeutlicht den Anspruch auf größere Übersichtlichkeit und Transparenz sowie die Notwendigkeit größerer Auslegungsspielräume durch die Gerichte. Der Schwerpunkt liegt auf der Struktur und den grundlegenden Prinzipien des CISG.
Schlüsselwörter
UN-Kaufrecht, CISG, Internationaler Handelskauf, Deutsches Recht, BGB, HGB, Rechtswahl, grenzüberschreitender Kaufvertrag, Schadensersatz, Gewährleistung, Vertragsabschluss, Mangelfreiheit, Leistungsstörungen, Vertragsaufhebung, Transaktionskosten, Rechtsvergleich.
Häufig gestellte Fragen zum UN-Kaufrecht (CISG) im Vergleich zum deutschen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht das UN-Kaufrecht (CISG) mit dem deutschen Recht (BGB, HGB) im internationalen Handelskauf. Sie untersucht Vor- und Nachteile für Käufer und Verkäufer und zielt darauf ab, eine fundierte Entscheidungshilfe für die Rechtswahl bei grenzüberschreitenden Kaufverträgen zu bieten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Anwendbarkeit des CISG, die Unterschiede in den Regelungen zu Schadensersatz, Vertragsabschluss, Mangelbegriff, Vertragsaufhebung und Leistungszeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Flexibilität des CISG, der Behandlung unbestimmter Rechtsbegriffe und dem Einfluss einheitlicher Regelwerke auf die Transaktionskosten. Beispiele wie der „Muschelfall“ und die Lieferung „frei Haus“ illustrieren die praktischen Implikationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Hintergrund des UN-Kaufrechts (inkl. Entstehungsgeschichte und Entwicklung), ein Kapitel zur Anwendbarkeit des CISG (inkl. Ausschlussmöglichkeiten und Rechtswahlklauseln), ein Kapitel zum Aufbau und den Grundzügen des UN-Kaufrechts (inkl. Vergleich mit deutschem Recht), und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der relevanten Aspekte.
Wie wird der Vergleich zwischen CISG und deutschem Recht durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt auf verschiedenen Ebenen: Es werden die jeweiligen Regelungen zu zentralen Aspekten des Kaufrechts gegenübergestellt und die Unterschiede hinsichtlich Flexibilität, Auslegungsspielraum und Transaktionskosten analysiert. Konkrete Fallbeispiele verdeutlichen die praktischen Auswirkungen der unterschiedlichen Rechtsordnungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Entscheidungsträgern im internationalen Handel eine fundierte Grundlage für die Wahl des anwendbaren Rechts zu liefern. Sie soll Klarheit über die Vor- und Nachteile des CISG im Vergleich zum deutschen Recht schaffen und zu einer informierten Rechtswahl beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: UN-Kaufrecht, CISG, Internationaler Handelskauf, Deutsches Recht, BGB, HGB, Rechtswahl, grenzüberschreitender Kaufvertrag, Schadensersatz, Gewährleistung, Vertragsabschluss, Mangelfreiheit, Leistungsstörungen, Vertragsaufhebung, Transaktionskosten, Rechtsvergleich.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist klar strukturiert und bietet neben einer Einleitung und einem Fazit auch Kapitel zu den zentralen Themen des UN-Kaufrechts. Die Kapitel sind prägnant gefasst und liefern umfassende Informationen zu den jeweiligen Aspekten des internationalen Kaufrechts. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen guten Überblick über den Inhalt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit internationalem Handelskauf befassen, insbesondere für Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, und Entscheidungsträger in Unternehmen, die grenzüberschreitende Kaufverträge abschließen.
- Quote paper
- Alexander Söllner (Author), 2021, Vor- und Nachteile des UN-Kaufrechts im Vergleich zum deutschen Recht aus Sicht von Käufer und Verkäufer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189618