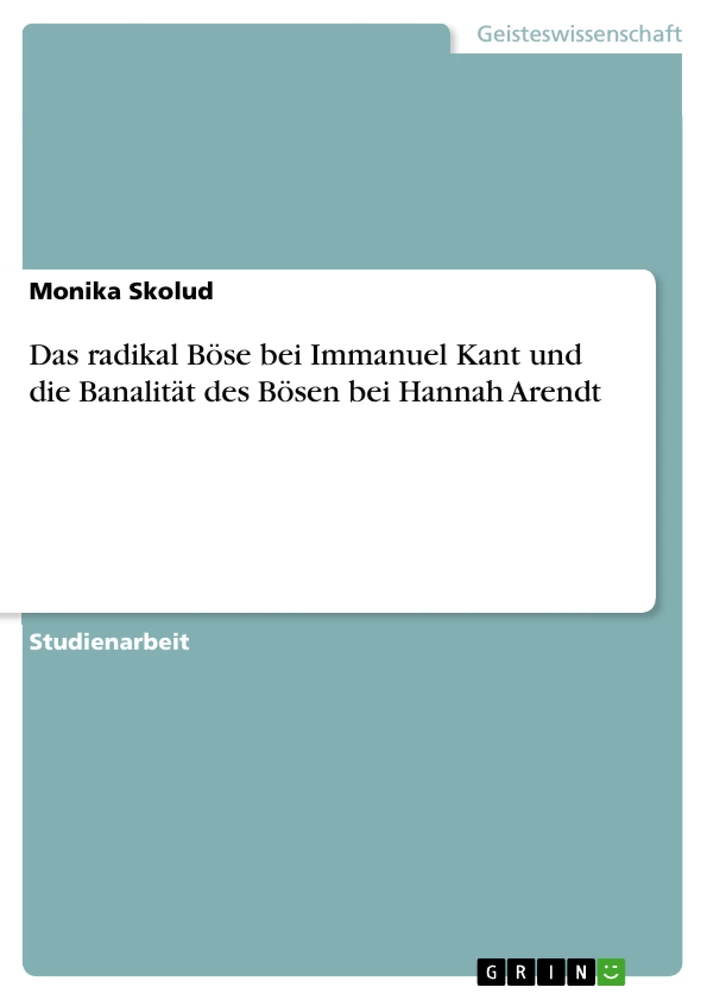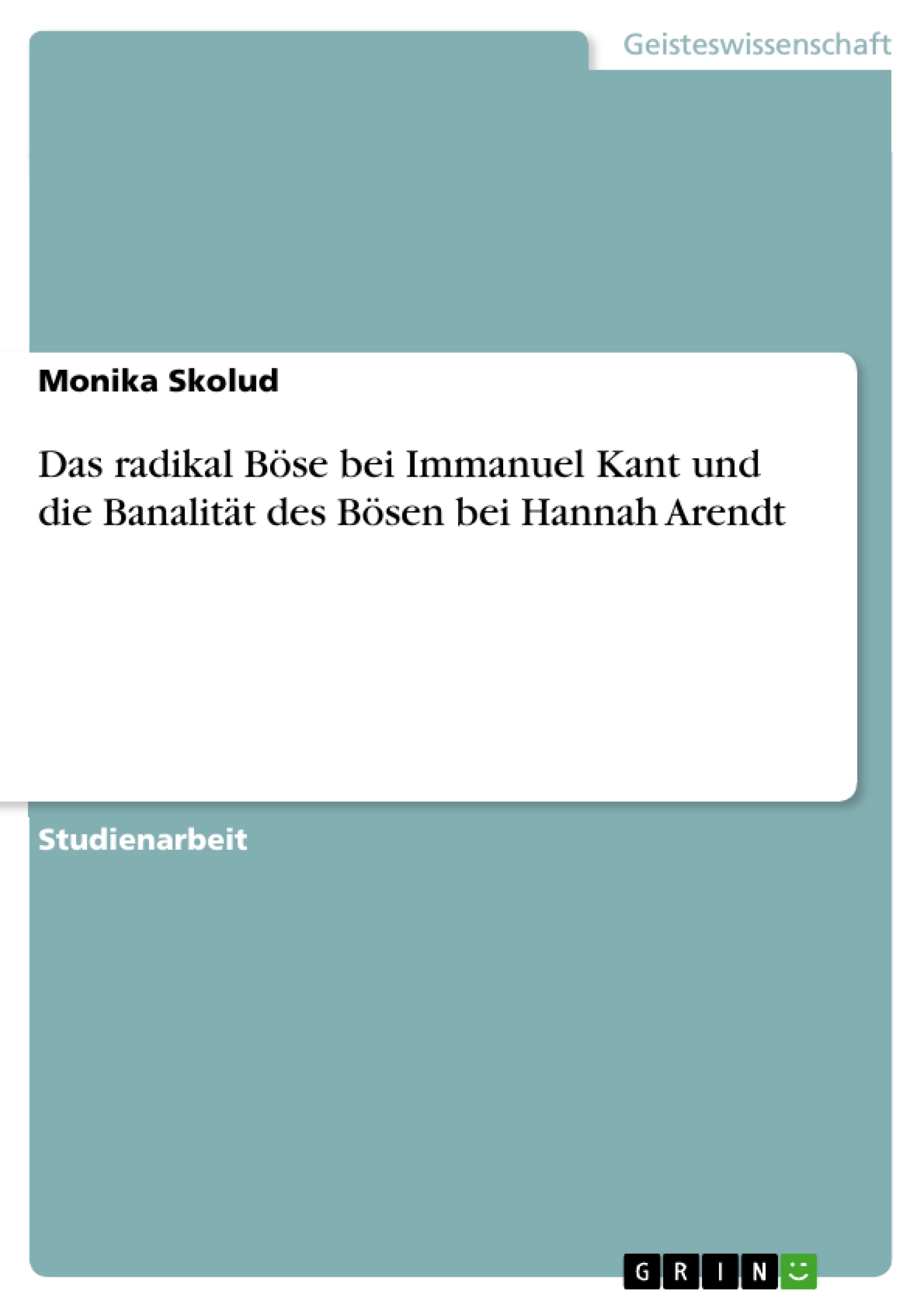„Εναντίον δέ έοτιν άγαθώ μεν έξ άναγκης κακόν.“
Gegenüberliegend ist dem »gut« notwendig das »schlecht«.
Dem Guten wie dem Schlechten oder dem Bösen eignet keine präzise und allgemeingültige Bestimmung. Die Begriffe bilden eine Entgegensetzung, so sind Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gegenüberliegende Gegensätze die einer Seinsgattung angehören und, nach Aristoteles, in der menschlichen Seele auftreten. Im Unterschied dazu sind »gut« und »böse« >nicht in einer Gattung, sondern das sind selbst Seinsgattungen von anderem.<
Damit ist gesagt, dass das Böse in unterschiedlicher Weise ausgesagt werden kann. Es kann ebenso »ein böses Geschwür« wie »eine böse Handlung« bezeichnen. Diese Arbeit betrachtet und diskutiert Positionen des moralisch Bösen.
Das moralisch Böse ist bei Immanuel Kant ein radikal Böses in der menschlichen Natur.
Hannah Arendt prägte – für das moralisch Böse - im Anschluss an ihre Auseinandersetzung mit dem »Fall Eichmann« den Begriff der Banalität des Bösen. In beiden Moralkonzeptionen geht es um die menschliche Fähigkeit Recht von Unrecht zu scheiden, die Möglichkeit gut oder böse sein zu können. Das gute wie das böse Handeln stellen Seinsmöglichkeiten der Menschen dar und so geht es, bei Kant und Arendt, um die Auseinandersetzung angesichts des Bösen das Gute zu erkennen, zu wollen und zu tun.
Diese Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Nach einer kurzen Einführung in den Begriff und die Definition des Bösen wird im zweiten Kapitel die Entwicklung des Begriffs des radikal Bösen bei Immanuel Kant beschrieben. Dies geschieht auf der Grundlage seiner Moralphilosophie und vor allem an Hand der Schrift: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft von 1793. Der dritte Abschnitt zeigt die Argumentation, die Hannah Arendt für die Entwicklung der »Linie der moralischen Kompetenzen« geltend macht. Die Entfaltung ihrer Moralkonzeption geschieht vor dem Hintergrund der Philosophie Kants. Textgrundlage ist hier vor allem ihre Vorlesung zu Fragen der Ethik aus dem Jahre 1965: Über das Böse. Im vierten Kapitel werden die Differenzen der Denkmodelle von Kant und Arendt an Hand der Konzeptionen der Persönlichkeit, des Gewissens, der Vernunft und der Kompetenzen im Hinblick auf die Grundlagen und Motivationen für moralisches Handeln, diskutiert. Der abschließende fünfte Abschnitt resümiert die vorgetragenen Positionen und stellt die Frage:
Was sollen wir tun? im Sinne eines Ausblicks.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Böse
- Begriff und Definition des Bösen
- Das radikal Böse bei Immanuel Kant
- Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikal Böse in der menschlichen Natur
- Von der ursprünglichen Anlage zum Guten in der menschlichen Natur
- Von dem Hange zum Bösen in der menschlichen Natur
- Der Mensch ist von Natur böse
- Vom Ursprung des Bösen in der menschlichen Natur
- Von der Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihre Kraft
- Die Banalität des Bösen bei Hannah Arendt
- Eichmann und der ‚Kategorische Imperativ für den Hausgebrauch’
- Das Denken
- Das Wollen
- Das Urteilen
- Freiheit und Verantwortung
- Grundlagen des moralischen Handelns bei Immanuel Kant und Hannah Arendt
- Die Persönlichkeit bei Immanuel Kant und Hannah Arendt
- Die Persönlichkeit bei Immanuel Kant
- Die Persönlichkeit bei Hannah Arendt
- Moralisches Gefühl versus Ergebnis des Denkens
- Das Gewissen bei Immanuel Kant und Hannah Arendt
- Das Gewissen bei Immanuel Kant
- Das Gewissen bei Hannah Arendt
- Kultivierte Pflicht versus moralische Vorschrift
- Kant: Mit Vernunft und Hoffnung gegen das radikal Böse
- Arendt: Mit moralischen Kompetenzen gegen die Banalität des Bösen
- Die Persönlichkeit bei Immanuel Kant und Hannah Arendt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte des radikalen Bösen bei Immanuel Kant und der Banalität des Bösen bei Hannah Arendt. Ziel ist es, die jeweiligen Moralkonzeptionen zu vergleichen und die Unterschiede in ihren Ansätzen zur Erklärung und Bewältigung des moralischen Bösen herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert die zugrundeliegenden philosophischen Positionen und deren Implikationen für das Verständnis menschlichen Handelns.
- Das Konzept des radikalen Bösen bei Kant
- Die Banalität des Bösen bei Arendt im Kontext des Holocaust
- Vergleich der Konzepte von Persönlichkeit und Gewissen bei Kant und Arendt
- Untersuchung der Grundlagen moralischen Handelns bei beiden Philosophen
- Analyse der Strategien zur Überwindung des Bösen bei Kant und Arendt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des moralisch Bösen ein und stellt die gegensätzlichen Positionen Kants und Arendts gegenüber. Sie beschreibt das radikal Böse bei Kant als in der menschlichen Natur verwurzeltes Merkmal und die Banalität des Bösen bei Arendt als erschreckende Alltäglichkeit. Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile, wobei die Hauptaugenmerke auf Kants Religionsschrift und Arendts Vorlesung über das Böse liegen. Das Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie das Gute angesichts des Bösen erkannt, gewollt und getan werden kann.
1. Das Böse: Dieses Kapitel analysiert den vagen Begriff des Bösen und die Schwierigkeit einer präzisen Definition. Es unterstreicht die Evidenz des Bösen in der Erfahrung und verweist auf Kants und Arendts jeweilige Ausgangspositionen. Die Definition des moralisch Bösen als absichtliche, nicht zu rechtfertigende Handlung wird skizziert, wobei die Zurechenbarkeit und uneingeschränkte Negativität hervorgehoben werden.
2. Das radikal Böse bei Immanuel Kant: Dieses Kapitel beschreibt Kants Konzept des radikalen Bösen, das in der menschlichen Natur verankert ist und nicht aus Naturtrieben, sondern aus der Freiheit des Menschen entspringt. Es analysiert die drei Anlagen zum Guten und den Hang zum Bösen, wobei die Unvordenklichkeit des ersten subjektiven Grundes der Maximen betont wird. Die Unterscheidung zwischen intelligibler und sensibler Tat sowie die Unmöglichkeit eines moralisch indifferenten Willens werden erläutert.
3. Die Banalität des Bösen bei Hannah Arendt: Dieses Kapitel beleuchtet Arendts Konzept der Banalität des Bösen, basierend auf ihrer Analyse des Eichmann-Prozesses. Es hebt die Instrumentalisierung der Vernunft und den Verzicht auf persönliches Urteil hervor. Arendts Kritik an der bloßen Pflichterfüllung ohne eigenständiges Denken wird diskutiert. Die Zerstörung des Denkens als Kern des Bösen und die Unfähigkeit zur Reue als charakteristische Merkmale werden hervorgehoben.
4. Grundlagen des moralischen Handelns bei Immanuel Kant und Hannah Arendt: Dieses Kapitel vergleicht die Konzepte von Persönlichkeit und Gewissen bei Kant und Arendt. Es analysiert Kants Betonung des moralischen Gefühls und der Achtung vor dem moralischen Gesetz im Gegensatz zu Arendts Fokus auf geistige Kompetenzen wie Denken, Wollen und Urteilen. Die jeweiligen Strategien zur Überwindung des Bösen werden gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Radikal Böse, Banalität des Bösen, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Moralphilosophie, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Eichmann-Prozess, Persönlichkeit, Gewissen, Vernunft, Freiheit, Verantwortung, moralische Kompetenzen, Denken, Wollen, Urteilen, Pflicht, Glückseligkeit, Maximen, Gesinnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konzepte des Bösen bei Kant und Arendt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Konzepte des „radikalen Bösen“ bei Immanuel Kant und der „Banalität des Bösen“ bei Hannah Arendt. Sie untersucht die jeweiligen Moralkonzeptionen, ihre Unterschiede in der Erklärung und Bewältigung moralischen Bösen, und analysiert die zugrundeliegenden philosophischen Positionen und deren Implikationen für das Verständnis menschlichen Handelns.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kants Konzept des radikalen Bösen, Arendts Banalität des Bösen im Kontext des Holocaust, einen Vergleich der Konzepte von Persönlichkeit und Gewissen bei Kant und Arendt, die Grundlagen moralischen Handelns bei beiden Philosophen und deren Strategien zur Überwindung des Bösen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum allgemeinen Begriff des Bösen, Kapitel zu Kants radikalem Bösen und Arendts Banalität des Bösen, sowie ein Kapitel zum Vergleich der Grundlagen moralischen Handelns bei beiden Philosophen. Der Fokus liegt auf Kants Religionsschrift und Arendts Vorlesung über das Böse.
Was ist Kants Konzept des radikalen Bösen?
Kant versteht das radikale Böse als in der menschlichen Natur verwurzeltes Merkmal, das nicht aus Naturtrieben, sondern aus der menschlichen Freiheit entspringt. Er analysiert die Anlagen zum Guten und den Hang zum Bösen, wobei die Unvordenklichkeit des ersten subjektiven Grundes der Maximen betont wird. Die Unterscheidung zwischen intelligibler und sensibler Tat sowie die Unmöglichkeit eines moralisch indifferenten Willens werden erläutert.
Was ist Arendts Konzept der Banalität des Bösen?
Arendts Konzept der Banalität des Bösen basiert auf ihrer Analyse des Eichmann-Prozesses. Sie betont die Instrumentalisierung der Vernunft und den Verzicht auf persönliches Urteil. Arendts Kritik an der bloßen Pflichterfüllung ohne eigenständiges Denken, die Zerstörung des Denkens als Kern des Bösen und die Unfähigkeit zur Reue werden als charakteristische Merkmale hervorgehoben.
Wie werden Kant und Arendt verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte von Persönlichkeit und Gewissen bei Kant und Arendt. Sie analysiert Kants Betonung des moralischen Gefühls und der Achtung vor dem moralischen Gesetz im Gegensatz zu Arendts Fokus auf geistige Kompetenzen wie Denken, Wollen und Urteilen. Die jeweiligen Strategien zur Überwindung des Bösen werden gegenübergestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Radikal Böse, Banalität des Bösen, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Moralphilosophie, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Eichmann-Prozess, Persönlichkeit, Gewissen, Vernunft, Freiheit, Verantwortung, moralische Kompetenzen, Denken, Wollen, Urteilen, Pflicht, Glückseligkeit, Maximen, Gesinnung.
Welches ist das zentrale Problem der Arbeit?
Die zentrale Frage ist, wie das Gute angesichts des Bösen – sei es das radikale oder das banale Böse – erkannt, gewollt und getan werden kann. Die Arbeit untersucht, wie Kant und Arendt diese Frage jeweils beantworten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Philosophie, insbesondere der Ethik und Moralphilosophie, sowie für alle, die sich für die philosophischen Konzepte des Bösen und die Werke von Immanuel Kant und Hannah Arendt interessieren.
- Quote paper
- Monika Skolud (Author), 2008, Das radikal Böse bei Immanuel Kant und die Banalität des Bösen bei Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118950