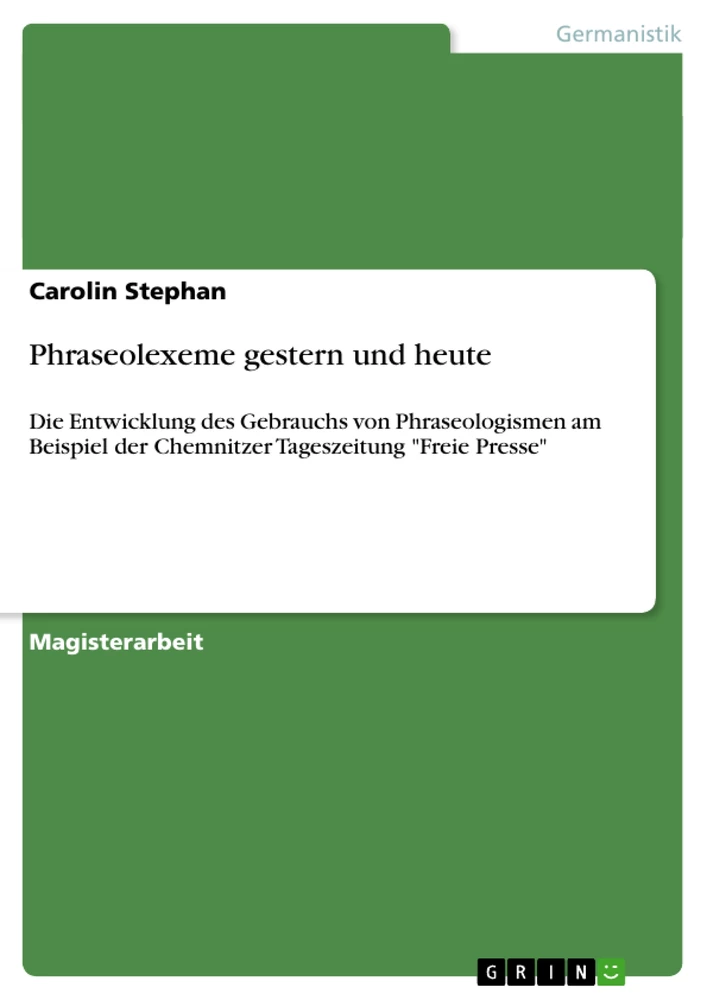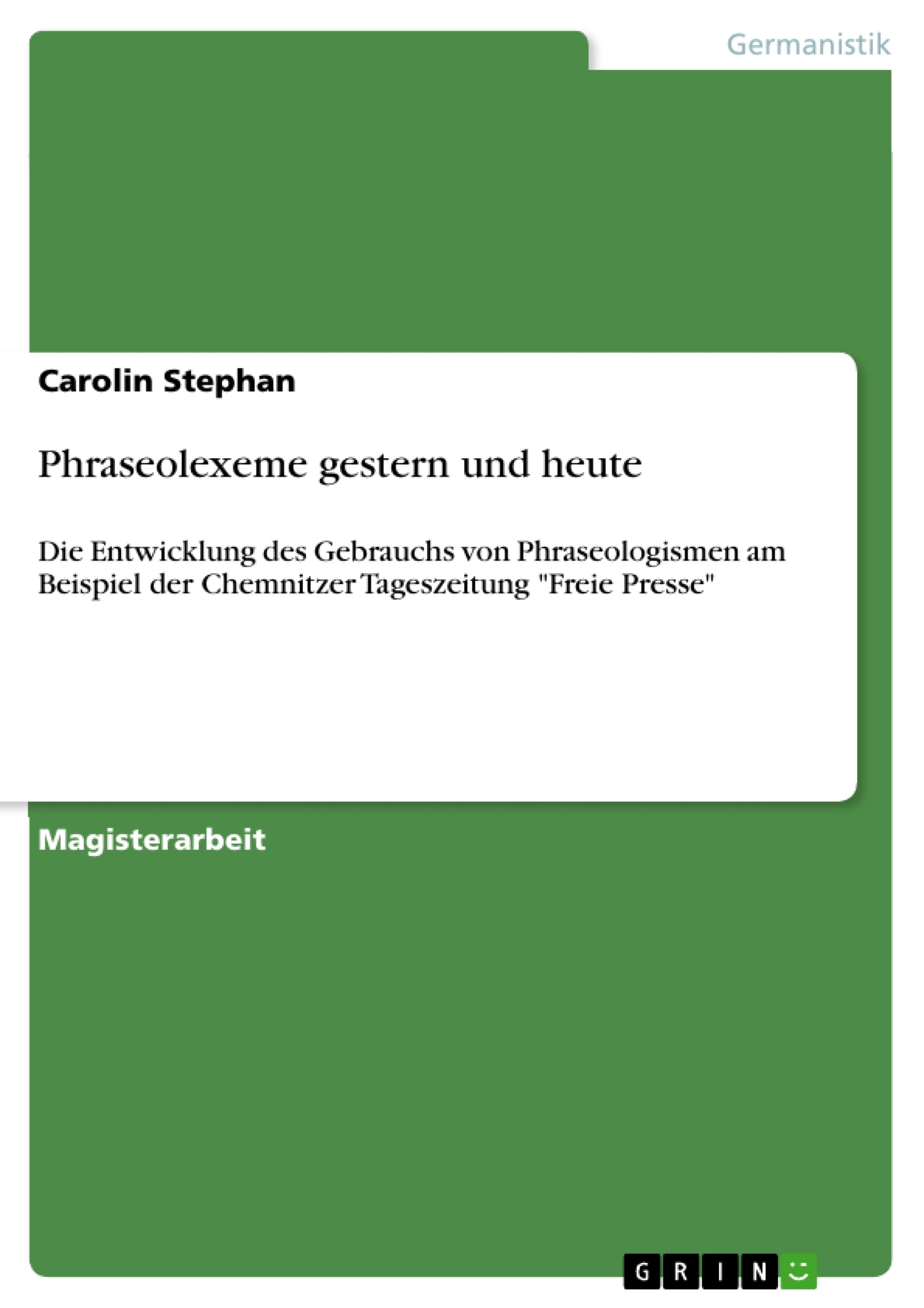Untersucht werden soll in der vorliegenden Arbeit die Gebrauchsentwicklung eines ganz konkreten sprachlichen Phänomens: der Phraseologismen, genauer gesagt der Phraseolexeme. Feste, idiomatische Wortverbindungen also, die als Einheit im mentalen Lexikon gespeichert sind und durch ihren hohen Wiedererkennungswert die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen. Dank dieser Eigenschaft tragen Phraseolexeme, wenn schon nicht zwangsläufig zur Informationsübermittlung, so doch auf jeden Fall zur Steigerung des Unterhaltungswerts eine Pressetextes bei. Unterhaltung wiederum verkauft sich gut. Letztlich sind Zeitungen in der heutigen Zeit nichts anderes als Unternehmen, die wirtschaftlich arbeiten müssen. Der Leser ist gleichzeitig zahlender Kunde, dem unter anderem durch abwechslungsreiche, unterhaltsame Sprache eine möglichst vergnügliche Lektüre geboten werden muss. Im Gegensatz dazu konnten viele Zeitungsmacher in der DDR wegen ihrer Funktion als Parteiorgan wirtschaftliche Aspekte außer Acht lassen. Vor allem im regionalen Bereich gab es oft keine Alternative zu den verstaatlichten „Blättern“. Eine ansprechende Textgestaltung zum Leser-Werben war damit schlichtweg unnötig und oft auch gar nicht möglich, da die Journalisten strengen sprachlichen Regelungen zu folgen hatten. Die Folge waren monotone Texte, in denen wenig Raum für außergewöhnliche Wortwahl oder Sprachspielereien blieb. Die Vermutung liegt nahe, dass sich dieser Umstand auch auf den Gebrauch von Phraseologismen auswirkte. Man könnte sich daher die Frage stellen, ob vor lauter „leeren Phrasen“ möglicherweise kein Platz mehr für Phraseolexeme war. Dieser – zugegebenermaßen etwas überspitzt formulierten – These gilt es im Laufe dieser Arbeit auf den Grund zu gehen. Als Untersuchungsobjekt dienen dabei die Mai-Ausgaben der Chemnitzer Tageszeitung „Freie Presse“ aus den Jahren 1967 und 2007.
Inhaltsverzeichnis
- I Theoretische Grundlagen und Überblick über den Forschungsstand
- 1. Einleitung
- 1.1 Thesen
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Phraseologische Grundbegriffe
- 2.1 Phraseolexeme - Kernbereich der Phraseologie
- 2.2 Eigenschaften
- 2.3 Modifikation versus Variation
- 2.4 Modifikationsarten
- 3. Allgemeines zur Pressesprache
- 3.1 Äußere Faktoren
- 3.2 Sprachliche Merkmale der DDR-Presse
- 4. Klassifikation von Pressetexten
- 4.1 Presse-Textsorten
- 4.2 Klassifikationen
- 4.3 Eigene Einteilung
- 1. Einleitung
- II Analyse
- 1. Untersuchtes Textkorpus
- 2. Quantitative Analyse
- 2.1 Presse-Textsorten
- 2.2 Phraseolexeme
- 2.3 Modifikationen
- 3. Qualitative Analyse
- 3.1 Pressetexte von 1967
- 3.1.1 Häufig auftretende Phraseolexeme
- 3.1.2 Modifikationen
- 3.2 Pressetexte von 2007
- 3.2.1 Häufig auftretende Phraseolexeme
- 3.2.2 Modifikationen
- 3.3 Zusammenfassung
- 3.1 Pressetexte von 1967
- 4. Problemfälle
- 5. Auswertung: Entwicklungstendenzen beim Gebrauch von Phraseolexemen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Gebrauchs von Phraseologismen in der Chemnitzer Tageszeitung „Freie Presse“ zwischen 1967 und 2007. Ziel ist es, anhand der Analyse von Pressetexten aus beiden Zeitperioden die Veränderungen im Sprachgebrauch zu untersuchen und die Faktoren zu identifizieren, die diese Entwicklung beeinflusst haben.
- Entwicklung des Phraseologismus-Gebrauchs in der „Freien Presse“
- Vergleich des Sprachgebrauchs in der DDR- und der Bundesrepublik-Presse
- Einfluss von gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auf den Sprachgebrauch
- Untersuchung von Modifikationen und Variationen von Phraseologismen
- Bedeutung von Phraseologismen für die Gestaltung von Pressetexten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Phraseologismus-Gebrauchs in der „Freien Presse“. Es werden wichtige Begriffe der Phraseologie definiert, verschiedene Modifikationsarten von Phraseologismen erläutert und die Besonderheiten der Pressesprache im Kontext der DDR und der Bundesrepublik Deutschland dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird das untersuchte Textkorpus vorgestellt und die quantitative Analyse der Pressetexte aus den Jahren 1967 und 2007 präsentiert. Hier werden die Häufigkeit von Phraseologismen und Modifikationen untersucht, um erste Erkenntnisse über die Entwicklung des Phraseologismus-Gebrauchs zu gewinnen.
Das dritte Kapitel widmet sich der qualitativen Analyse der Pressetexte. Es werden die häufigsten Phraseolexeme und Modifikationen in den Texten aus beiden Jahren untersucht und die Unterschiede im Sprachgebrauch der „Freien Presse“ in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland herausgearbeitet.
Das vierte Kapitel behandelt Problemfälle, die bei der Analyse von Phraseologismen auftreten können, und die Ergebnisse der Untersuchung werden im fünften Kapitel zusammengefasst und interpretiert. Entwicklungstendenzen im Gebrauch von Phraseologismen werden aufgezeigt und die Ergebnisse in den Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte eingeordnet.
Schlüsselwörter
Phraseologie, Phraseolexeme, Modifikationen, Pressetext, Sprachgebrauch, DDR-Presse, Bundesrepublik-Presse, „Freie Presse“, Entwicklungstendenzen, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Phraseolexeme?
Das sind feste, idiomatische Wortverbindungen, die als Einheit im Gedächtnis gespeichert sind und oft dazu dienen, die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhöhen.
Wie unterschied sich die DDR-Pressesprache von heutiger Sprache?
In der DDR waren Zeitungen oft Parteiorgane mit strengen sprachlichen Regeln, was zu monotonen Texten führte, während heutige Zeitungen als Wirtschaftsunternehmen stärker auf Unterhaltung setzen.
Warum werden Phraseologismen in Zeitungen verwendet?
Sie steigern den Unterhaltungswert eines Textes und helfen dabei, Leser zu binden, indem sie Sprachspielereien ermöglichen und Texte lebendiger gestalten.
Was wurde in der Studie zur "Freien Presse" untersucht?
Es wurde der Gebrauch von Phraseolexemen in den Mai-Ausgaben der Chemnitzer Zeitung aus den Jahren 1967 (DDR) und 2007 (BRD) quantitativ und qualitativ verglichen.
Was ist der Unterschied zwischen Modifikation und Variation?
Variation beschreibt gebräuchliche Varianten eines Phraseologismus, während Modifikation eine bewusste, oft spielerische Abwandlung für einen spezifischen Texteffekt ist.
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Carolin Stephan (Autor:in), 2007, Phraseolexeme gestern und heute, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118917